Verheerende Folgen mangelnden Anscheins innerbetrieblicher Demokratie : Schriften
- 132 Seiten
- 5 Lesestunden
Volker Braun ist ein politischer Dichter mit ausgeprägten ästhetischen Qualitäten, dessen literarische Bedeutung alle Genres umfasst. Sein umfangreiches Werk, obgleich vielschichtig, konzentriert sich auf die Frage der politischen Emanzipation. In der DDR kritisierte er den „realen Sozialismus“, verlor aber nie die Hoffnung auf eine Verbesserung, auch durch Literatur. Brauns Lyrik identifiziert sich häufig mit einer nicht realisierten Möglichkeit, wobei die Diskrepanz zwischen Utopie und Realität durch die Sprache selbst ausgedrückt wird, gekennzeichnet durch innere Spannung und dialektische Beziehungen.
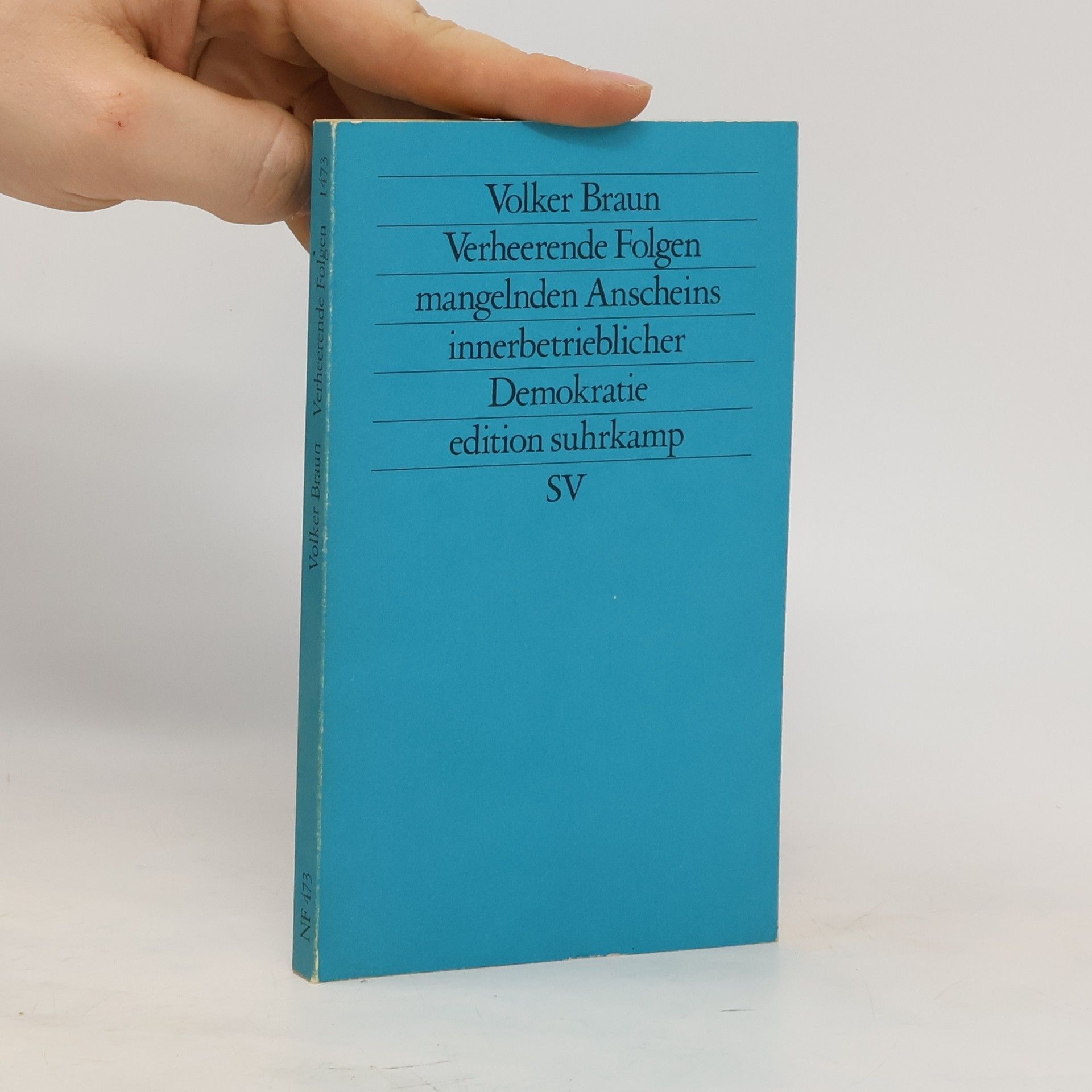

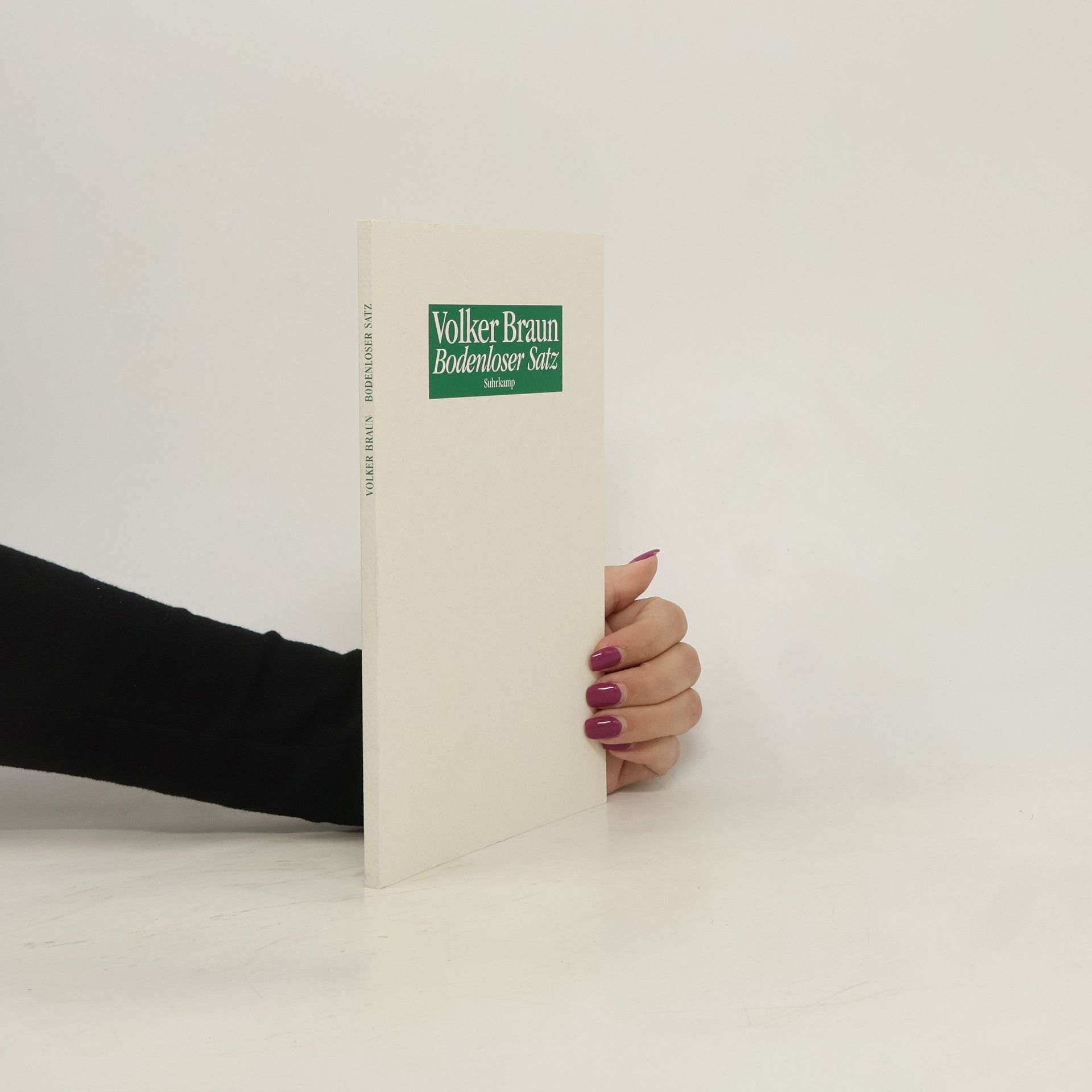
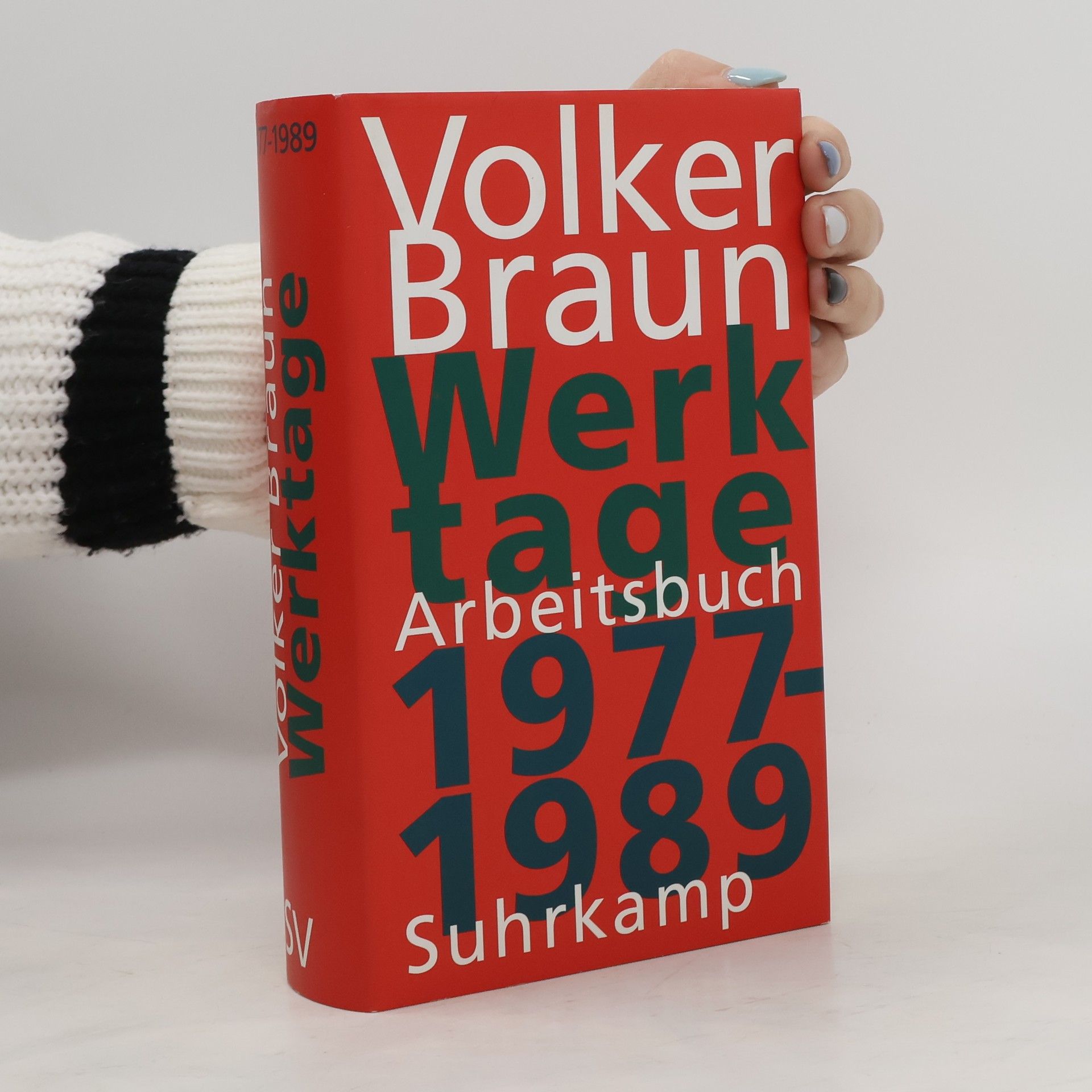
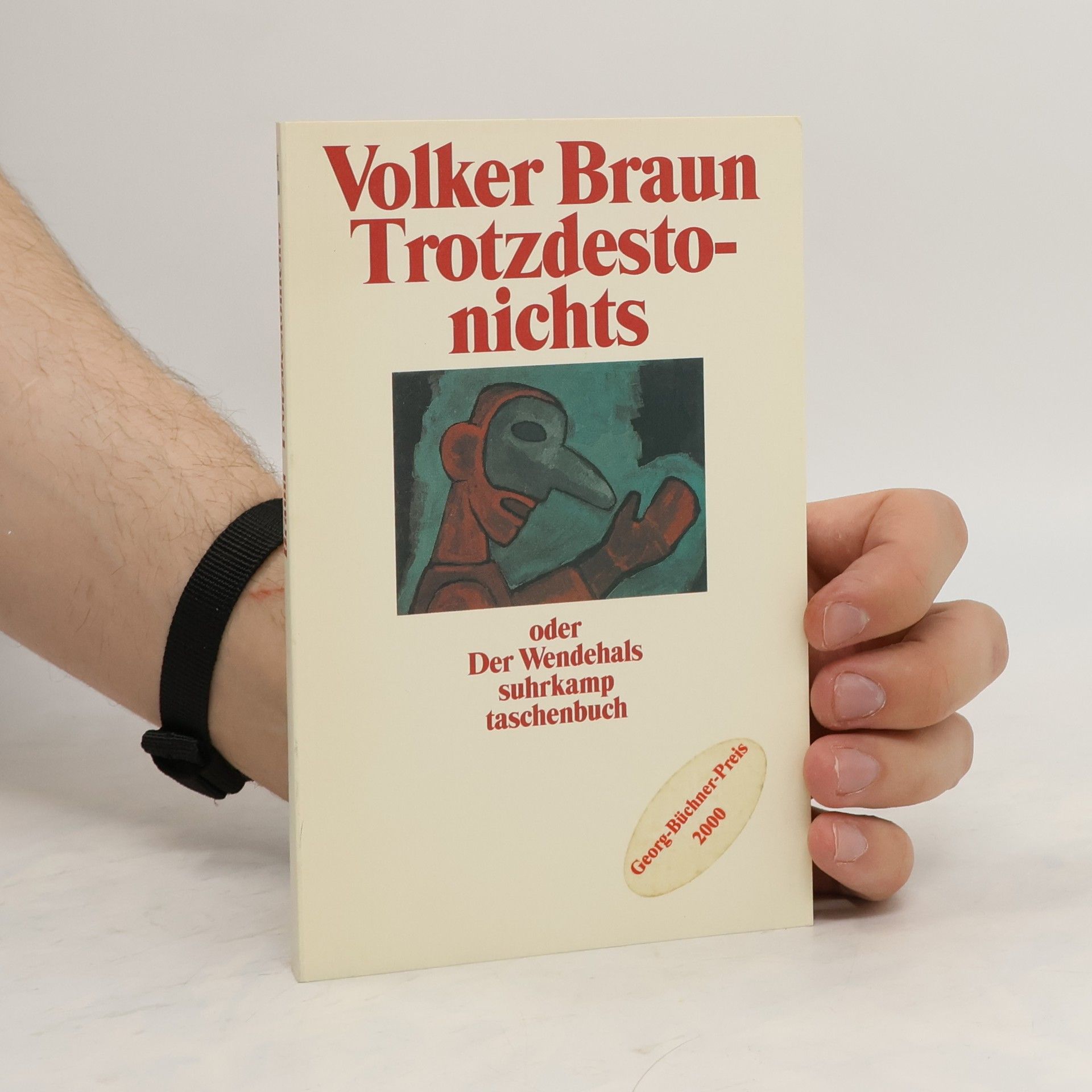

Drei Texte, entstanden 1992/93 nach der »Wende«, die Volker Braun nun Umbruch nennt, zeigen seine ungebrochene Lust, in die Verhängnisse zu sehen. Auf die bittere Geschichte Das Nichtgelebte folgt der satirische Dialog Der Wendehals, und dieser wird kommentiert von den kafkaesk gestimmten Kurzerzählungen der Fußgängerzone.
Unbekanntes, hoch Wichtiges ist zu vermelden. Volker Braun hat, beginnend im Januar 1977, bis in die Gegenwart ein Werktagebuch geführt. Dessen erster Band, teils kurze, teils längere Notate, erlaubt nicht allein den erhellenden Einblick in die Werkstatt des »lauteren, spielwütigen Autors«. Solche Mitschriften des täglichen Lebens machen erfahrbar, wie Volker Braun sich und seine Arbeit, die Kollegen und die politische Situation – in Ost und West – sieht. Und seine Beobachtungen, mal giftig, mal ironisch, Reflexionen und Erzählungen zeigen erneut die Kunst dieses Dramatikers, Lyrikers und Prosaisten: Mit jedem Satz von ihm steigert er humoristisch-traurig die Einsicht in die Verbesserungswürdigkeit und Verbesserungsnotwendigkeit unserer Lage. In diesem Lebens-, Lese- und Arbeitsbuch ist also zu erfahren, wie Volker Braun nach der Publikation der Unvollendeten Geschichte – 1975 in der DDR, 1977 in der BRD – seine Dramen zum Druck befördert und auf die Bühne bringt, wie er listig den Hinze-und Kunze-Roman zuerst in Frankfurt und dann in Halle veröffentlicht, was die im Westen so alles mit ihm anstellen, warum er 1988 das Stück Lenins Tod schreibt, und im Jahr 1989 der erste Band seiner Werkausgabe erscheint.
Volker Brauns Bodenloser Satz ist ein schmerzhafter, doppelter Schnitt, der einen bodenlosen Satz entfaltet, der alles verschlingt: Land, Menschen, Lebende und Tote, Kriegs- und Friedenszeiten, Liebe und mehr. Dieser Satz dringt tief in sein Weltall ein und thematisiert die Unerhörtheit und Lückenlosigkeit seiner Erzählung. Die Geschichte beginnt in der schwarzen Nacht auf einem fremd duftenden Laken, wo der Erzähler in einem Zustand müder Entspanntheit und im Übergang zum Schlaf eine leibhaftige Liebe mit Natali erlebt, während Sophie in der Kammer nebenan liegt. Doch dies ist nur der Anfang einer umfassenden Erzählung über die Rückkehr in ein Land, das zum Bergbauschutzgebiet erklärt wird. Es folgt eine Zerstörungswelle, die Haus, Hof, Wohlstand und Zuversicht hinwegfegt. Der Erzähler fühlt sich verantwortlich für das Geschehen und beginnt seinen Satz. Dieser bodenlose Satz ist in seiner Dichte, Präzision und Spannkraft ein ergreifendes Werk, das in alle Tiefen vordringt und selbst die Oberfläche überprüft. Entstanden im September 1988, wurde es 1989 mit dem Berliner Preis für deutschsprachige Literatur ausgezeichnet.
Bei den Berichten von Hinze und Kunze handelt es sich um Studien am lebenden Objekt. Hinze und Kunze sind, wie der Name sagt, ein Paar, aber ein ungleiches - sie legen Wert darauf, daß das deutlich bleibt. Ein sehr zeitgenössisches Team. Sie urteilen verschieden über sich und die Welt, indem ihnen ihre Stellung unterschiedliche Blickwinkel erlaubt. Das ist der Witz an den beiden, vielmehr, das ermöglicht, ihnen mit Witz zu begegnen.
In »Schriften« thematisiert Volker Braun aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen wie Rüstung, Waldsterben und Demokratie am Arbeitsplatz. Auch die moderne Kopfarbeit und der Stand der Aufklärung werden kritisch beleuchtet.
Am 1. Mai 1992 demonstrieren 4000 streikende Arbeiter an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze und errichten einen Zaun mit der Aufschrift: »Kein Kolonialgebiet«. Der Protest nimmt immer größere Dimensionen an, man marschiert gen Berlin, debattiert die Belagerung von Erfurt, kurz: es kommt zum großen Arbeiterkrieg. Der Fabulierkraft und -lust, dem Witz und dem Humor Volker Brauns ist es zu verdanken, wenn Die hellen Haufen konkret und einfühlsam, ironisch und bitterernst, von einem Aufstand berichten, der nicht stattgefunden hat. Zwar streift ein Heerhaufen Entlassener und Arbeitsloser durch Mitteldeutschland – daß sie aber nicht kämpfen ist der bittere, süße Faden der Erzählung. Sie sammeln sich auf einem Schlackeberg, dem Schutt ihrer Existenz, die nicht zu verteidigen ist, eines Besitzes, den sie nicht besessen haben, eines Lebens, für das man das seine nicht in die Schanze schlägt. So wird eine Niederlage erfochten und ein Widerstand erdacht. Diese klare, einfache, harte Geschichte mußte geschrieben werden, einmal für allemal. »Was wir nicht zustande gebracht haben, müssen wir überliefern.« (Ernst Bloch)
„Das ist der Roman von Hinze und Kunze. Wer sind Hinze und Kunze? Wie die Redensart es will und der Sozialismus, sollten sie Gleiche sein; um so auffälliger, daß sie es nicht sind. Kunze ist Funktionär, Hinze ist sein Fahrer. Kunze sagt wohin: und Hinze fährt davon.“
"Das ist das Glücksverlangen des einzelnen. Und die, die in Volker Brauns Geschichte nach ihrem Glück suchen, es finden und sich nicht gegen die Zerstörung ihres Glücks durch die Gesellschaft zur Wehr setzen können, sind Karin, die achtzehn-jährige Volontärin an einer Bezirkszeitung, und ihr Freund Frank, ein ehemaliger Rowdy, ein Einzelgänger; er arbeitet als Fernmeldetechniker."