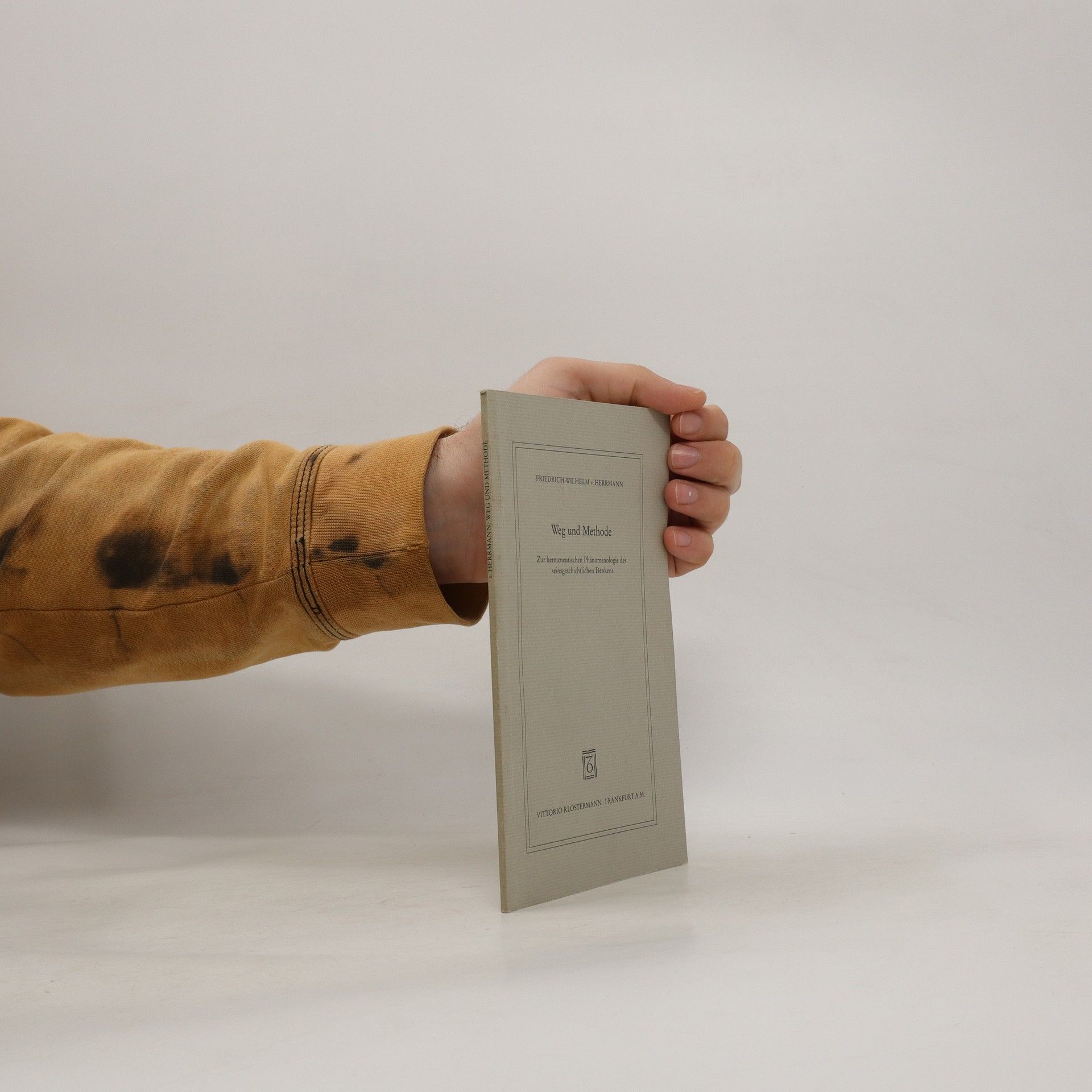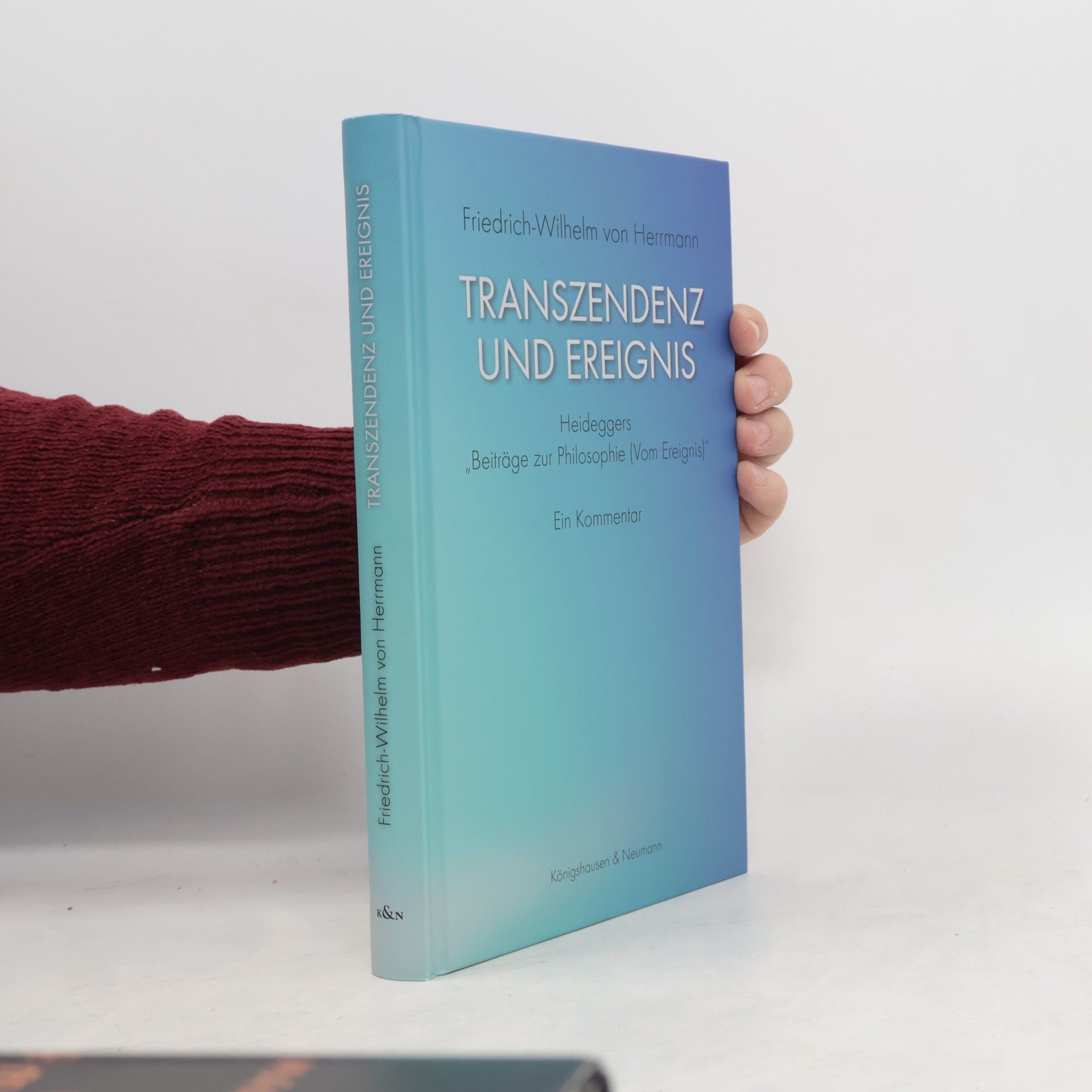Wahrheit - Freiheit - Geschichte
Eine systematische Untersuchung zu Heideggers Schrift "Vom Wesen der Wahrheit"
- 228 Seiten
- 8 Lesestunden
Dass Heideggers berühmter Vortrag „Vom Wesen der Wahrheit“ (1930) die Wahrheitsfrage ins Zentrum stellt, dass er auf diesem Wege die ek-sistente Freiheit des Da-seins freilegt, dass er schließlich die Verbergung im Wesen der Wahrheit als die Herkunft der geschichtlichen Entborgenheitsweisen des Seienden im Ganzen enthüllt, zeigt ein Dreifaches: 1. Die Wahrheitsfrage ist zur Zugangsfrage zur Seinsfrage geworden. 2. Die Freiheit der Ek-sistenz liegt, weil sie als Vollzieherin des Wahrheitswesens ursprünglicher denn die Zeitlichkeit und Temporalität ist, noch vor „Sein und Zeit“. 3. Das volle, in sich gestufte Wesen der Wahrheit ist selbst geschichtlich. Somit vollzieht der Wahrheitsvortrag den Übergang von der fundamentalontologischen Frageweise in die seinsgeschichtliche Blickbahn. Diese sachlich-immanenten Verschiebungen in einer systematischen Durchdringung des Text- und Sachgefüges und in hermeneutischer Inneneinstellung herauszuarbeiten ist die Aufgabe der Untersuchung.