Zum WerkDas auf die verwaltungsrechtlichen und planerischen Bedürfnisse ausgerichtete und dabei zugleich als Kommentar des erstens Zugriffs konzeptionierte Werk erläutert die aktuelle Fassung der BauNVO kompakt und zugleich detailliert. Abgerundet werden die Darstellungen durch Hinweise auf die Altfassungen, die in der Praxis noch immer eine Rolle spielen.Vorteile auf einen Blick systematisch aufbereitete Darstellungen von einem mit der Materie bestens vertrauten Expertenteam Einbeziehung der einschlägigen, bis September 2021 veröffentlichten Rechtsprechung und Literatur mit dem Baulandmobilisierungsgesetz 2021 Zur NeuauflageDie 5. Auflage enthält insbesondere eine Erörterung des mit dem Baulandmobilisierungsgesetz eingeführten 5a über die neue Baugebietskategorie "Dörfliches Wohngebiet" sowie der Neufassung des 17, womit den Gemeinden die für ihre Planungen nötige Flexibilität gegeben werden soll.ZielgruppeFür Planungs-, Bau- und Umweltbehörden, Richterschaft, Rechtsanwaltschaft, Architektinnen und Architekten und Ingenieurinnen und Ingenieure.
Helmut König Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
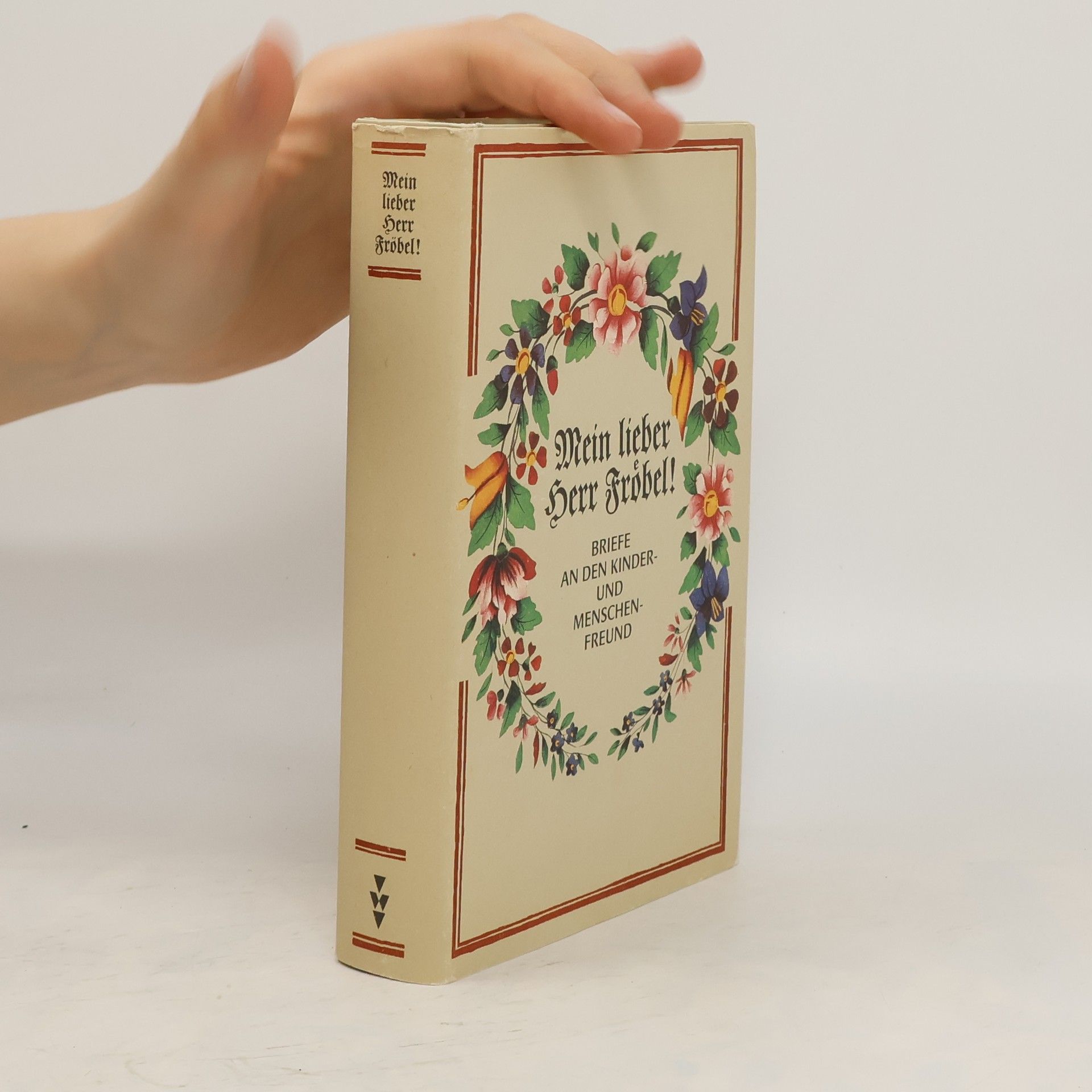
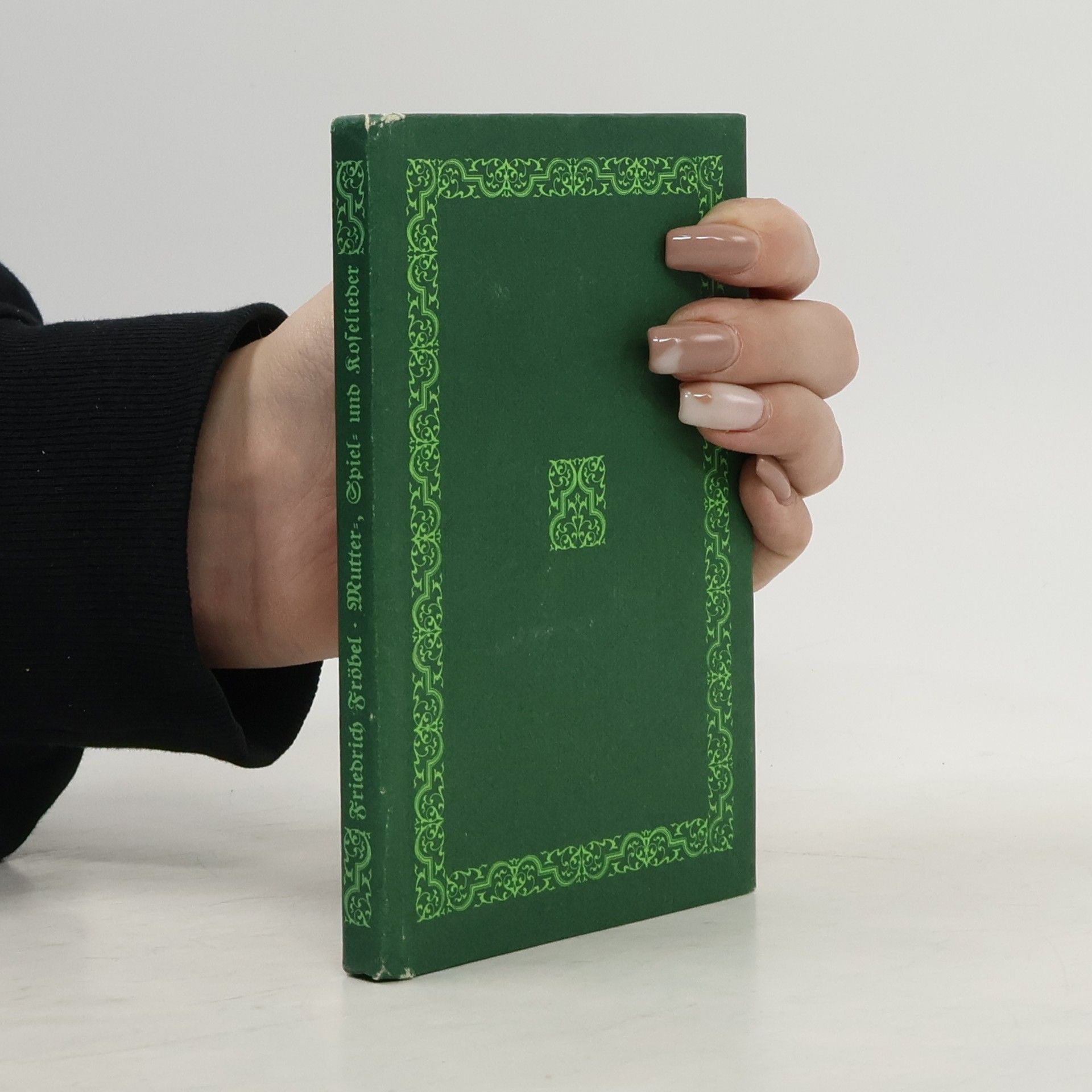


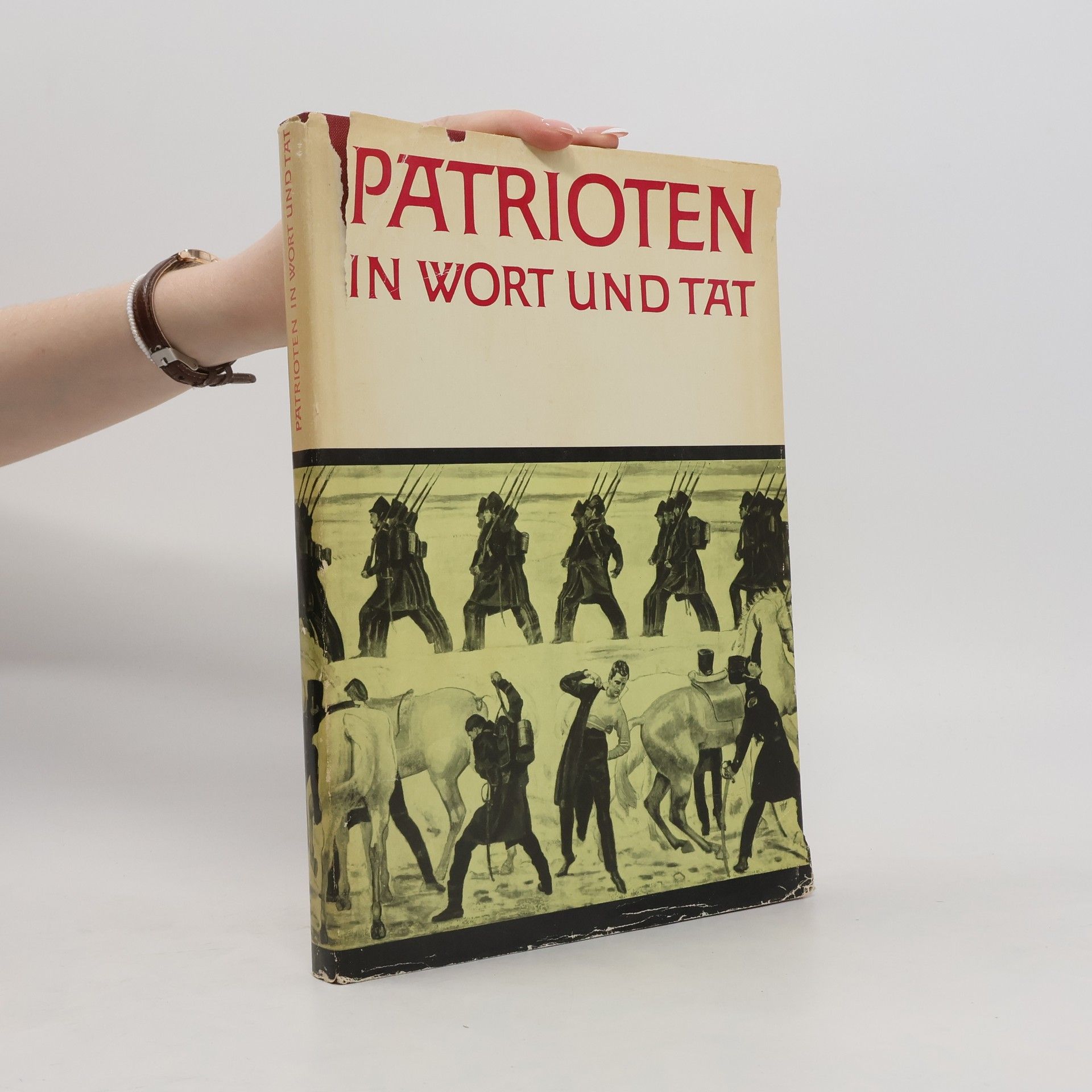

Politik und Gedächtnis
- 760 Seiten
- 27 Lesestunden
Das Buch untersucht das komplexe Zusammenspiel von Politik, Gedächtnis und Vergangenheit, indem es zunächst die sozialen Bedingungen der Erinnerung analysiert. Im Anschluss werden vier historische Fallstudien präsentiert, die von der Zeit des Alten Testaments bis zur Gegenwart der Bundesrepublik Deutschland reichen. Dabei werden die sozialen und politischen Auswirkungen des Gedächtnisses beleuchtet. Die fundierte und gut lesbare Analyse richtet sich nicht nur an Fachleute, sondern empfiehlt sich auch für Geschichtslehrer und interessierte Leser.
Der "Schwarzer/König" Kommentar schließt die Lücke zwischen einfachen Gesetzestext-Sammlungen und umfangreichen Kommentaren und bietet Nutzern eine erste Orientierung. Die Vorteile umfassen eine prägnante, an der Rechtsprechung des Bayerischen VGH orientierte Kommentierung sowie handliche Erläuterungen, die verlässlich über die Grundzüge und praxisrelevanten Einzelfragen informieren. Zudem werden Hinweise auf höchstrichterliche Rechtsprechung und weiterführende Literatur gegeben. In der Neuauflage wurden mehrere Änderungsgesetze berücksichtigt, darunter das Gesetz zur Änderung der BayBO und des Baukammerngesetzes, das Gesetz zur Bereinigung des Landesrechts sowie Verordnungen zur Anpassung des Landesrechts an die geltende Geschäftsverteilung. Auch die Bauordnungsnovelle 2020 wurde eingearbeitet. Die Zielgruppe umfasst Richter, Anwälte, Baubehörden, Bauherren sowie Architekten und Ingenieure.
Lüge und Täuschung in den Zeiten von Putin, Trump & Co.
- 358 Seiten
- 13 Lesestunden
Putin und Trump gelten gegenwärtig als die mächtigsten Männer der Welt. Beide greifen in ihrer politischen Praxis unentwegt zu Lügen, Täuschungen und Tricks, und zwar nicht nur gegenüber ihren eigenen Bevölkerungen, sondern auch in den internationalen Beziehungen. Warum tun sie das und warum sind sie damit so erfolgreich? Und unterscheiden sie sich damit überhaupt von dem, was ohnehin immer schon in der Politik üblich war und ist - überall auf der Welt?Helmut König unternimmt eine prinzipielle Analyse der Bedeutung von Wahrheit und Lüge in der Politik und geht mit vielen Beispielen ausführlich auf die Lügenpraxis in Trumps Amerika und Putins Russland ein.
Hledání rodného listu
- 247 Seiten
- 9 Lesestunden
Příběh je kusem reálného života, zachyceným z autorova pohledu, je to skutečný osud se všemi zvraty, vyprávějící o životě v Československu, dozrávání, emigraci a návratech.

