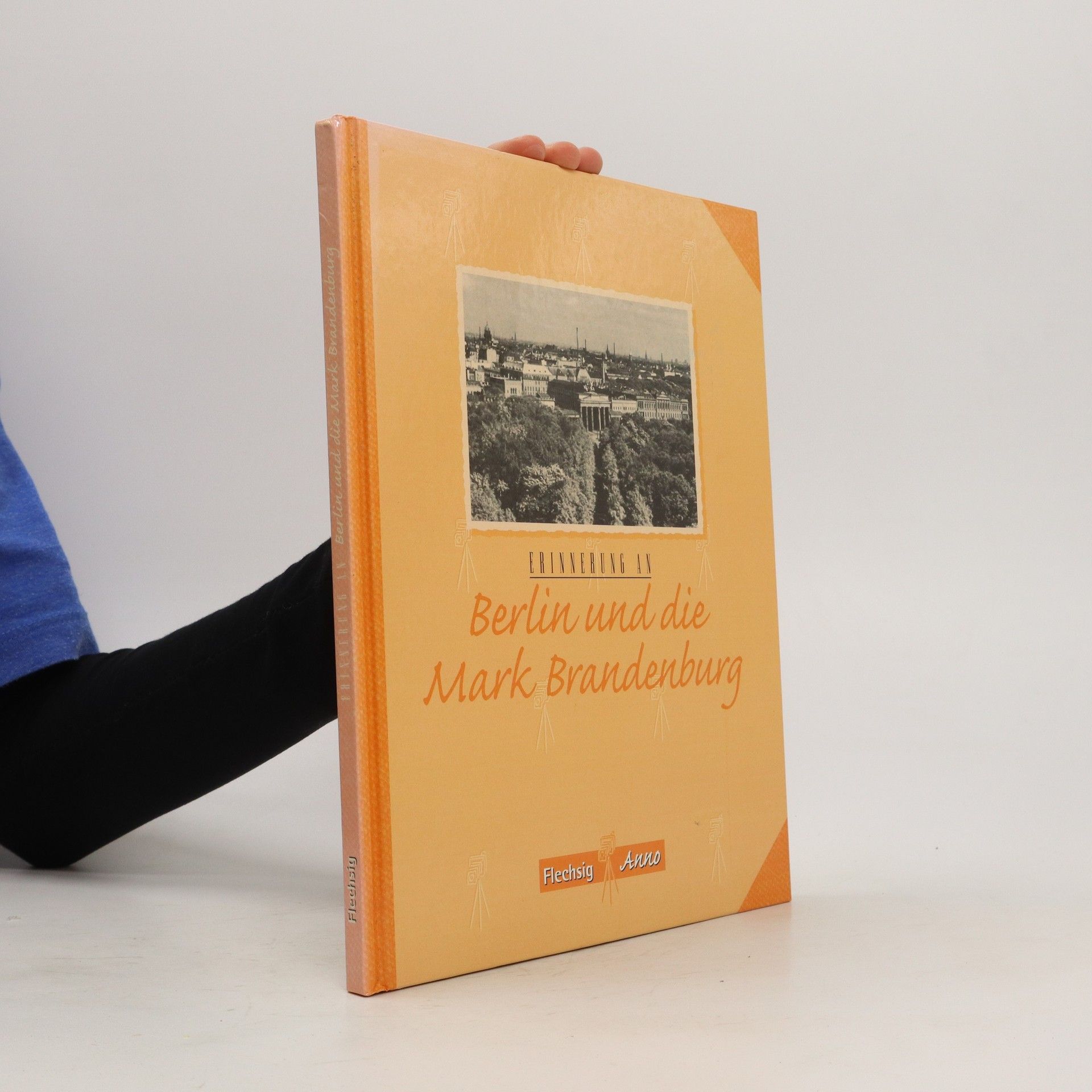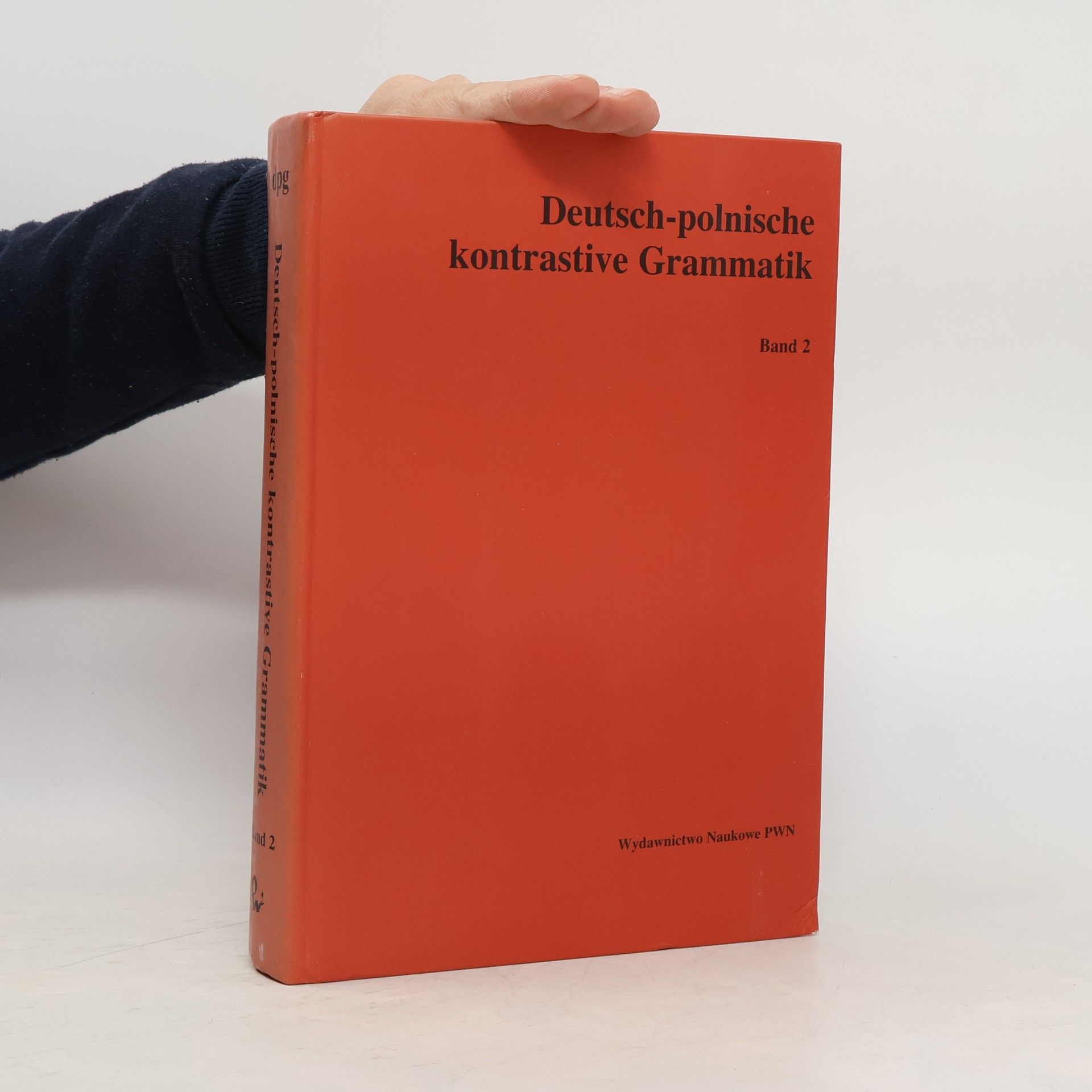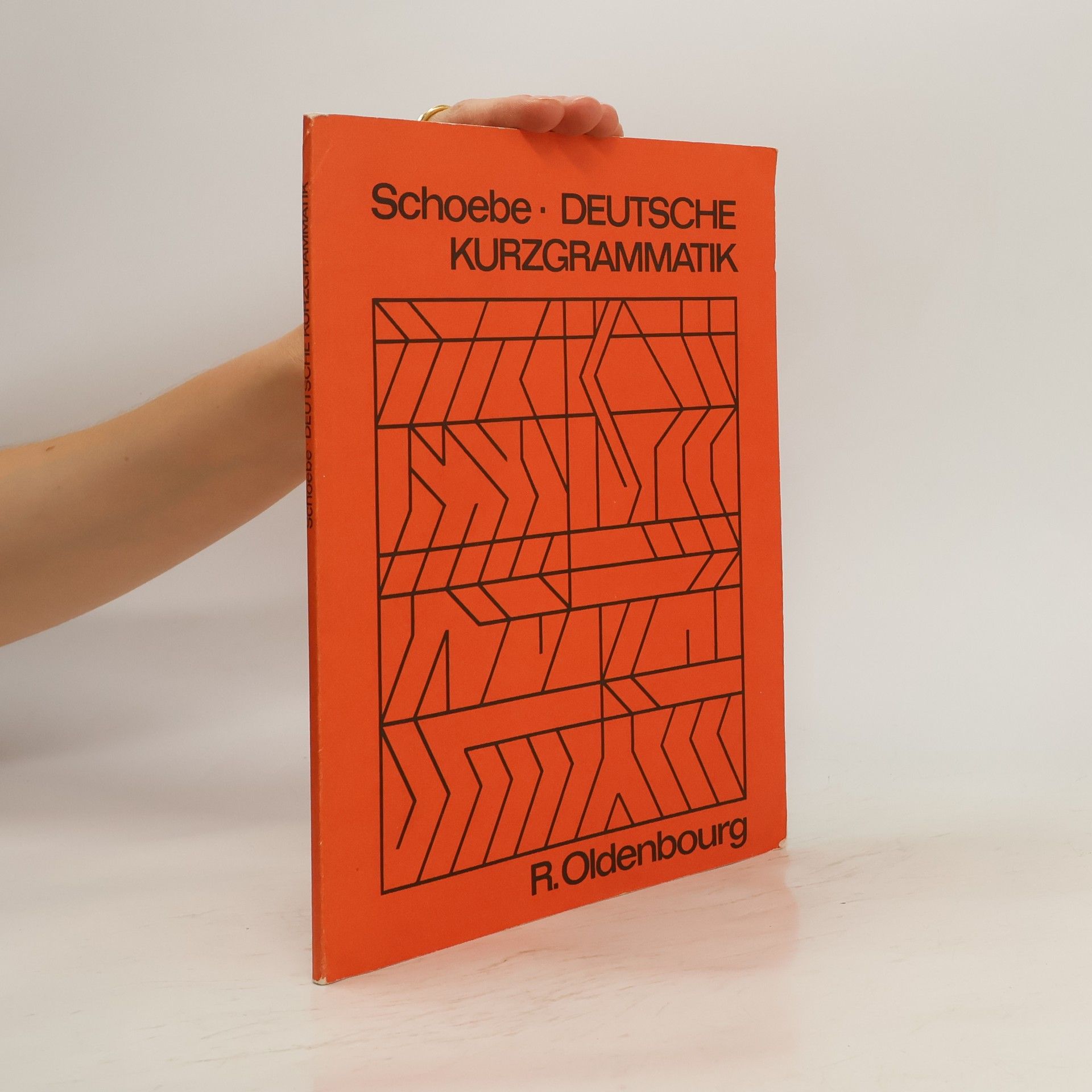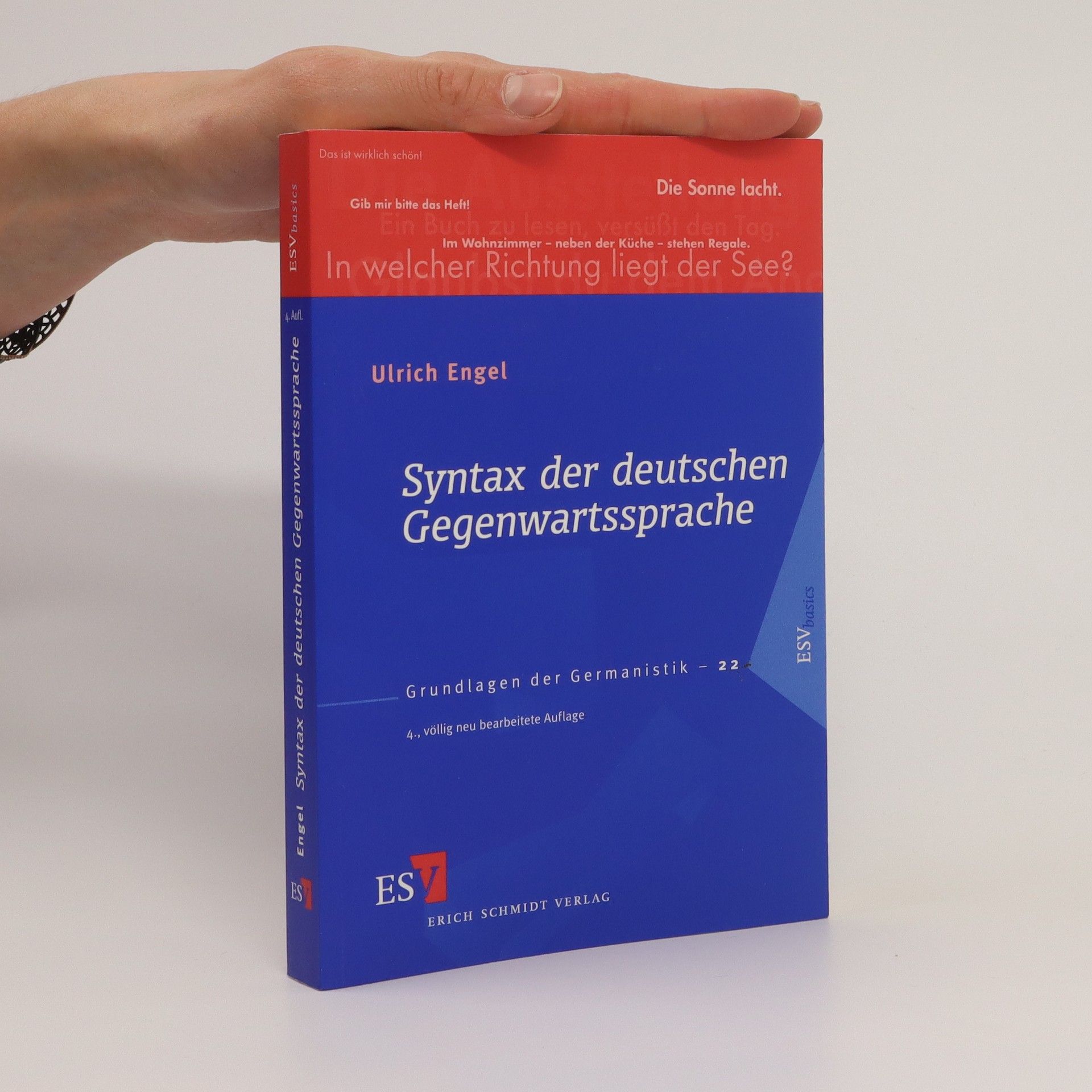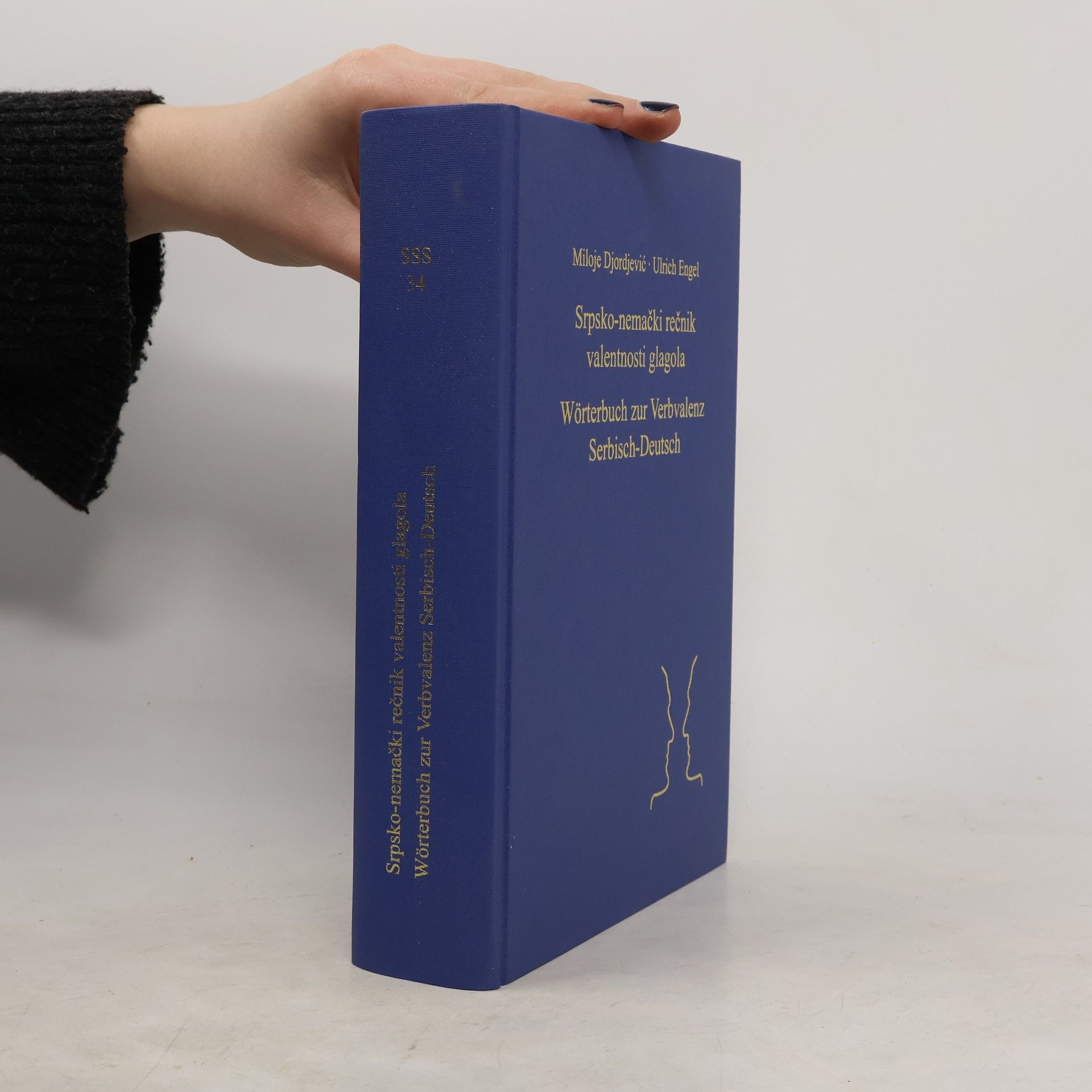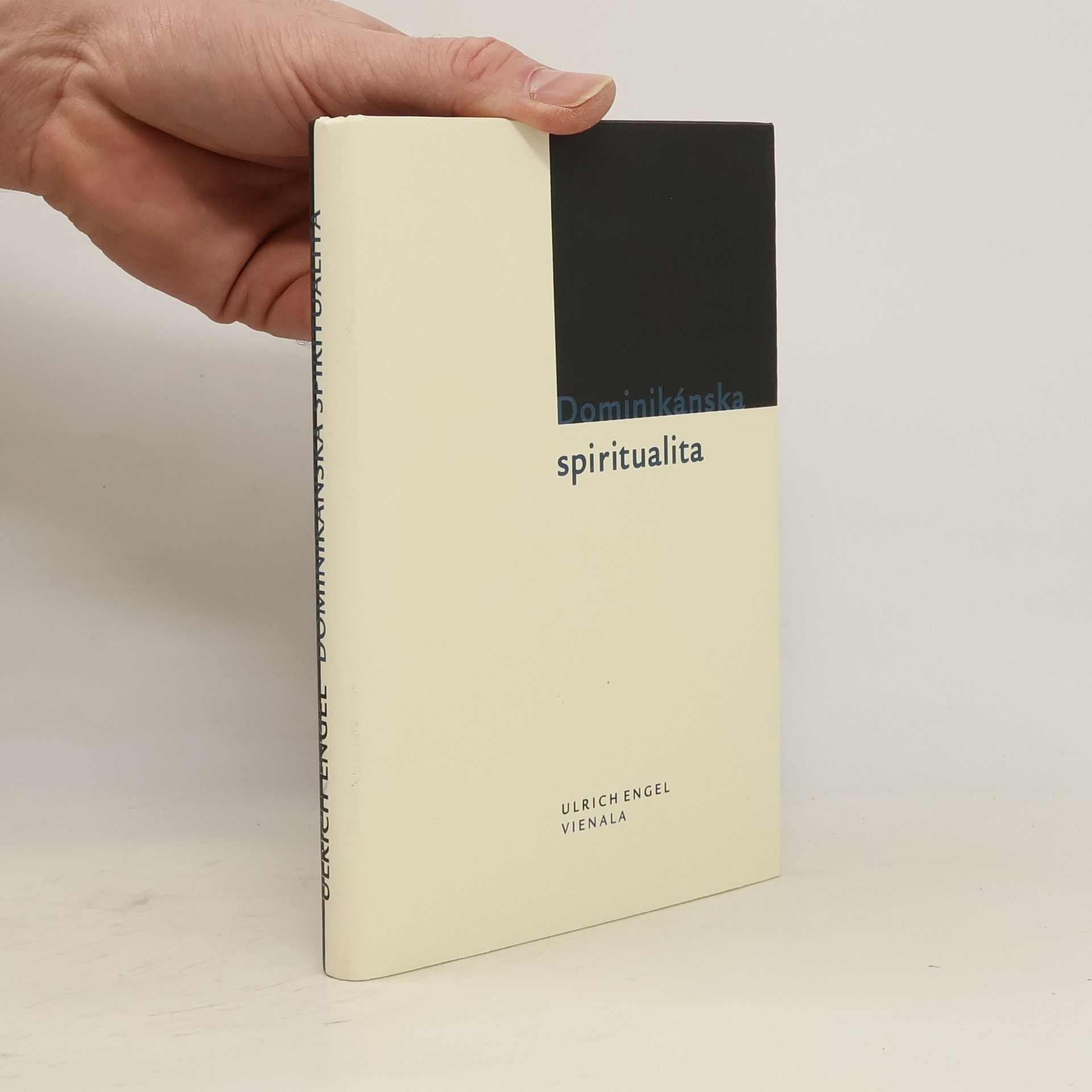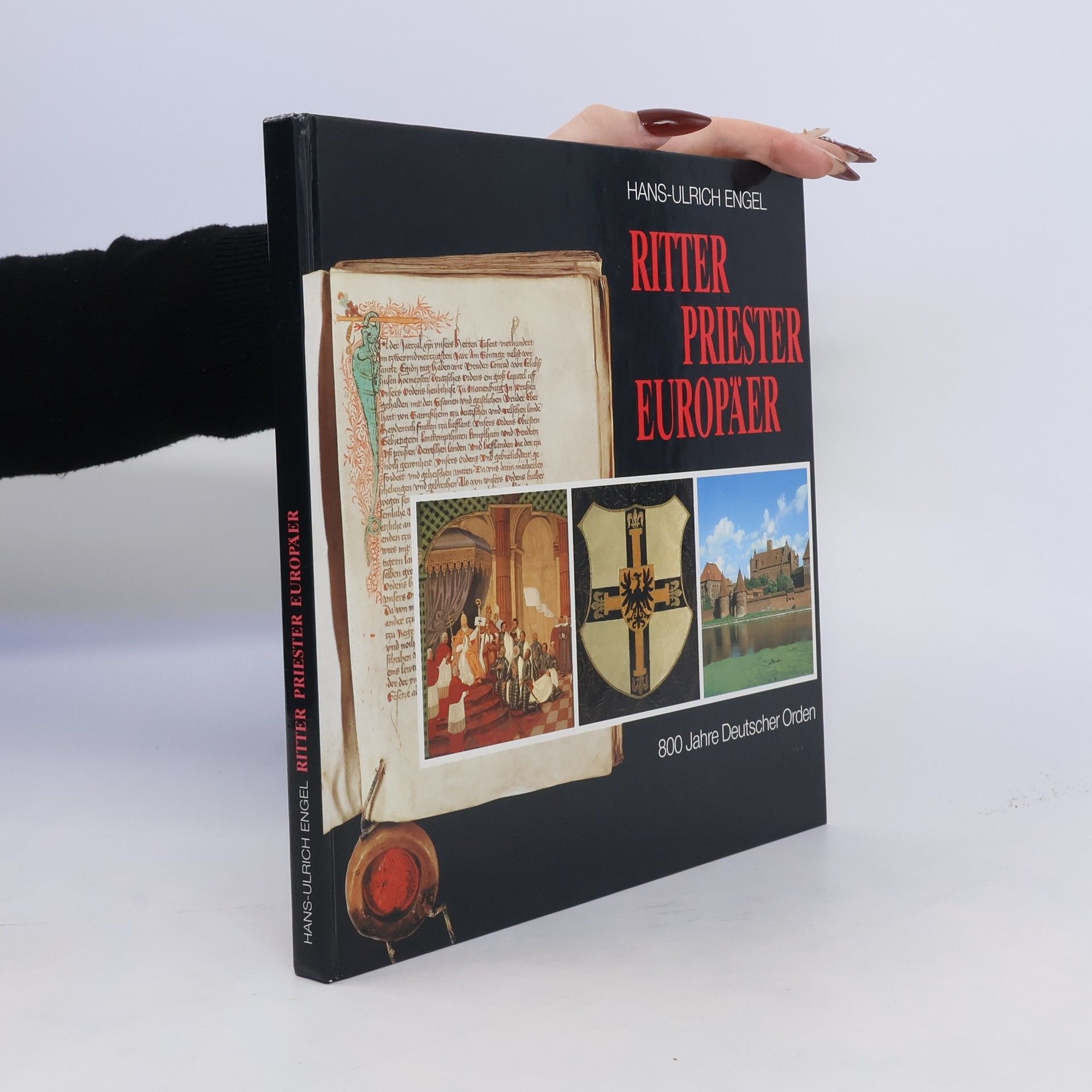Sagners Slavistische Sammlung - 34: Srpsko-nemački rečnik valentnosti glagola
Wörterbuch zur Verbvalenz Serbisch-Deutsch
- 780 Seiten
- 28 Lesestunden
Das vorliegende Wörterbuch wendet sich vor allem an Lehrkräfte und Dozenten der serbischen bzw. der deutschen Sprache sowie an Lerner, die über einige Vorkenntnisse in Serbisch bzw. Deutsch verfügen und ein Nachschlagewerk beim Fremdsprachenlernen brauchen. Es enthält zahlreiche Informationen zur Satzstruktur und Kombinatorik der serbischen und deutschen Verben und kann auch von Übersetzern sowie von Lehrbuchautoren als praktisches Hilfsmittel bei der Erstellung von Lehrwerken für den Serbisch- bzw. den Deutschunterricht an Schulen und Universitäten verwendet werden. Es ist kein normatives, sondern in erster Linie ein deskriptives und zur Sprachproduktion geeignetes Werk, in dem die Valenz der häufigsten (ca. 800) Verben der serbischen Standardsprache beschrieben und mit den deutschen Entsprechungen verglichen wurde. Seiner Konzeption nach stellt das Wörterbuch sicherlich ein Novum in der traditionellen Serbokroatistik dar. Beschreibungen, Erklärungen und alle zur Illustration aufgeführten Beispiele wurden zwar ekavisch verfasst, das Wörterbuch kann jedoch auch von Sprechern bzw. Deutschlernenden im ganzen ehemaligen serbokroatischen Sprachraum benutzt werden.