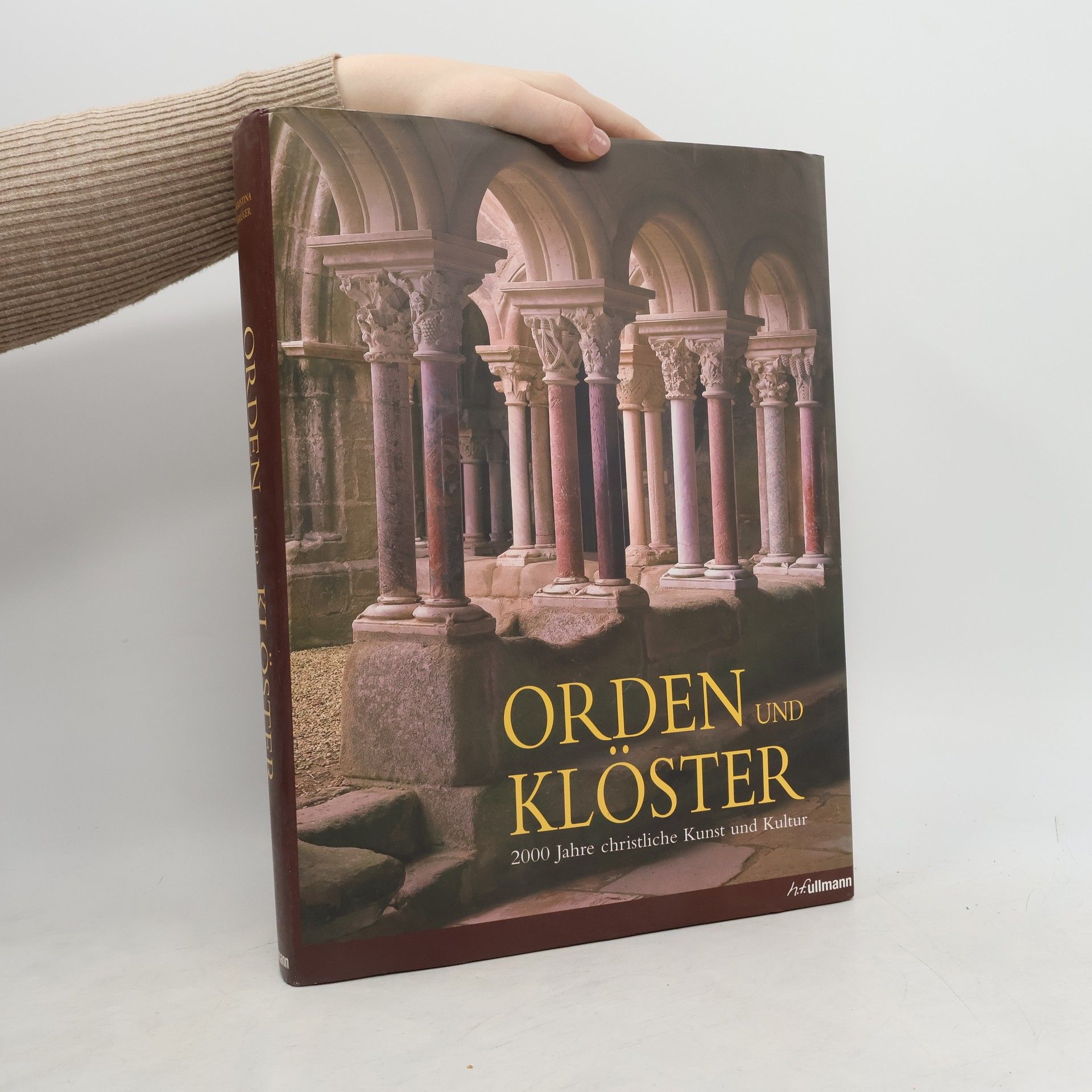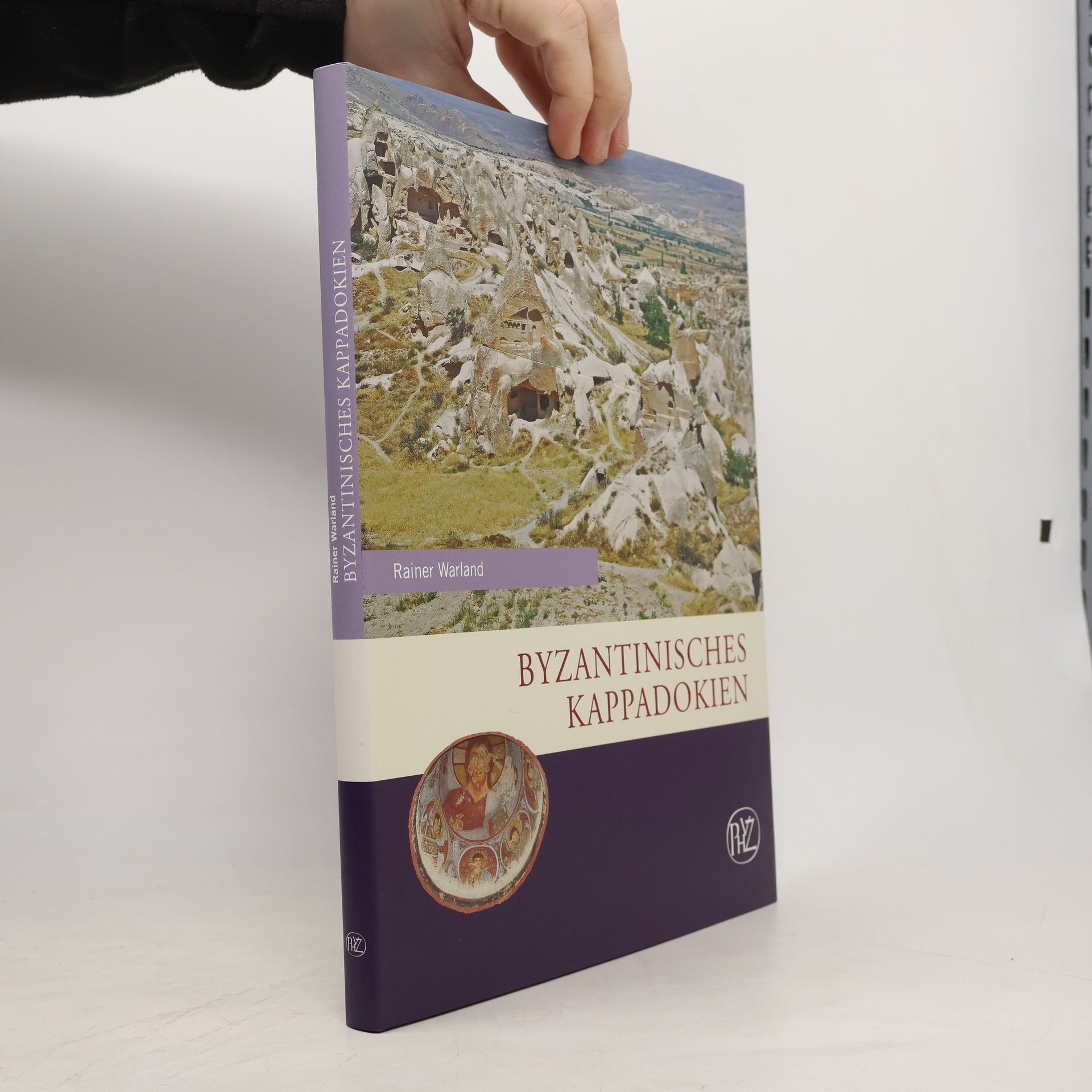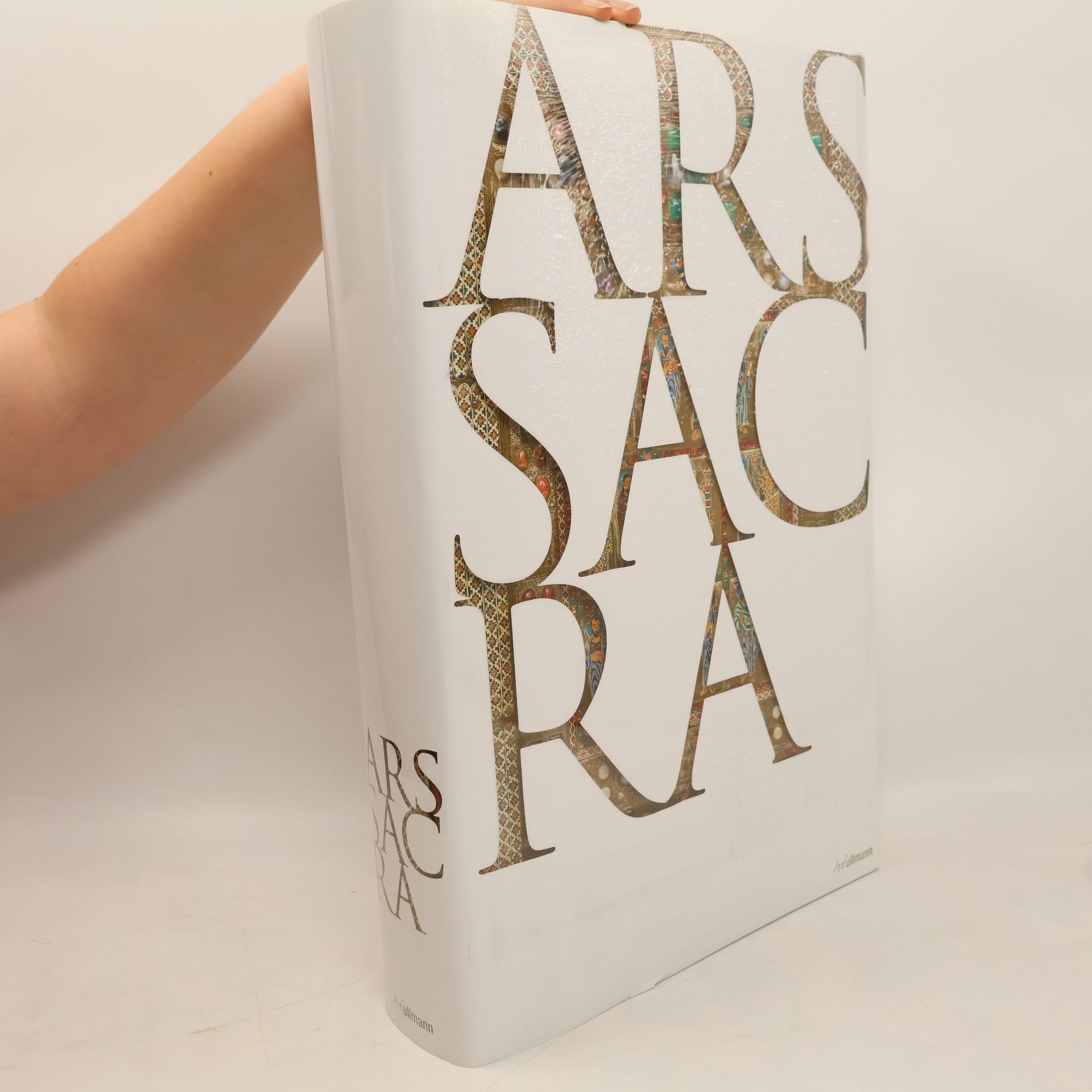Allegorese in Byzanz
Die Weisheit Salomons und die Anfänge der biblisch-allegorischen Bildkunst in Konstantinopel
- 224 Seiten
- 8 Lesestunden
Die Transformation der biblischen Bildkunst im 6. Jahrhundert in Konstantinopel wird hier als allegorische Neugestaltung Gottes betrachtet. Der einstige mythologische Diskurs hat an Bedeutung verloren, während die Allegorese und die naturalistischen sowie veristischen Darstellungsformen auf biblische Erzählungen angewendet werden. Die griechische Allegorese, die tiefere kosmische Wahrheiten und verborgene Weisheiten thematisierte, wird nun als Ausdruck von Gottes Vorsehung und liturgischer Handlung interpretiert. Bekannte Werke dieser Zeit, wie die Elfenbeinkathedra und der Purpurcodex, werden neu analysiert.