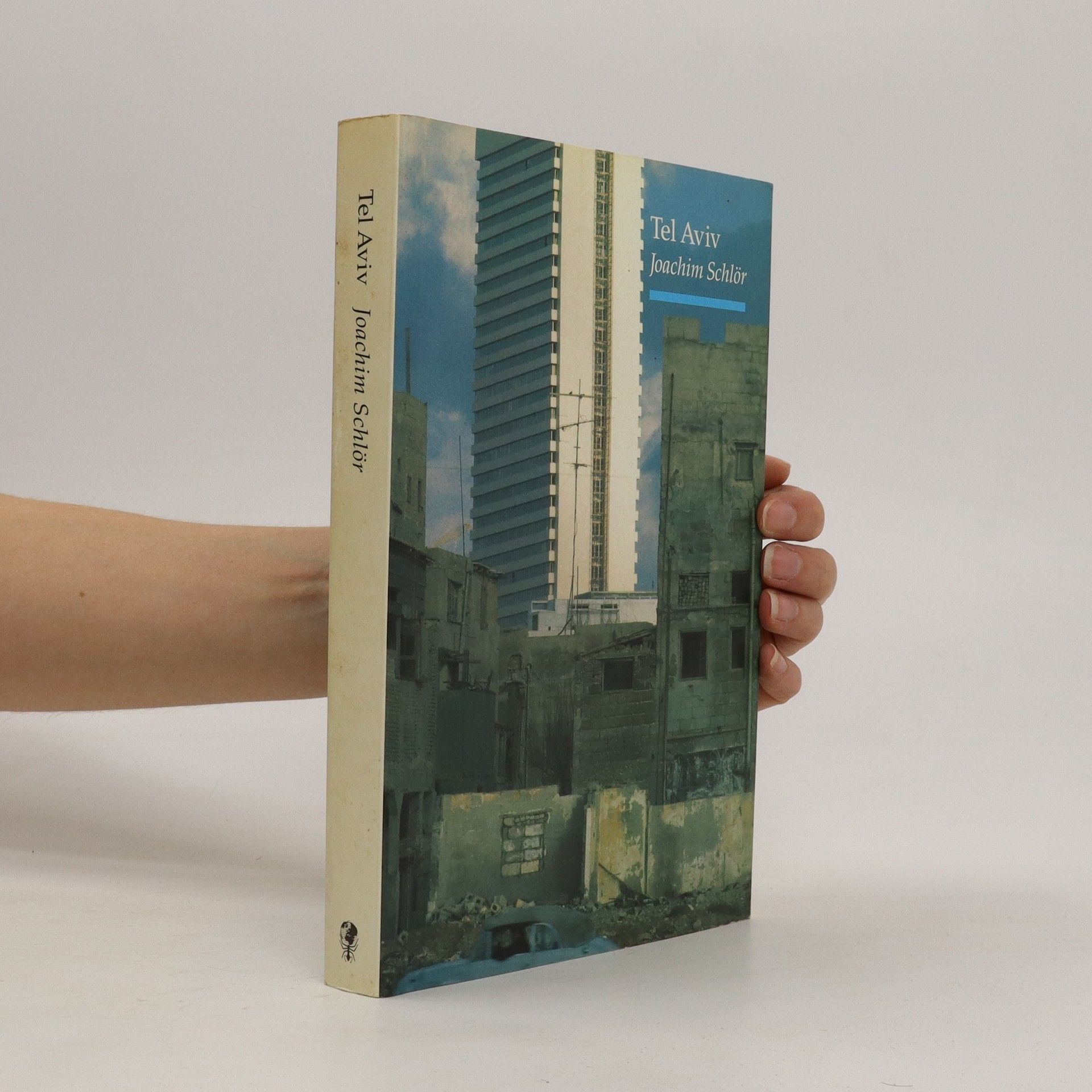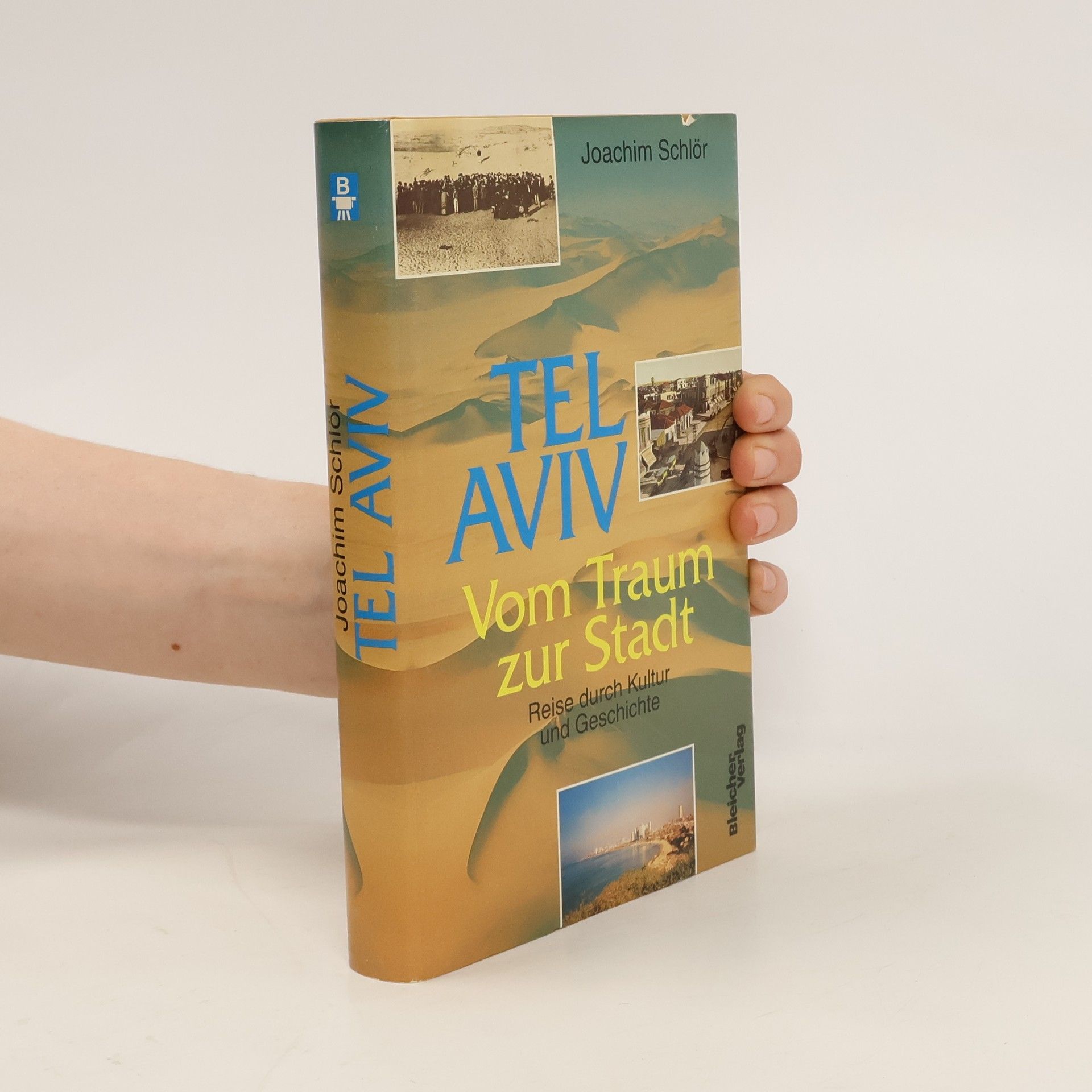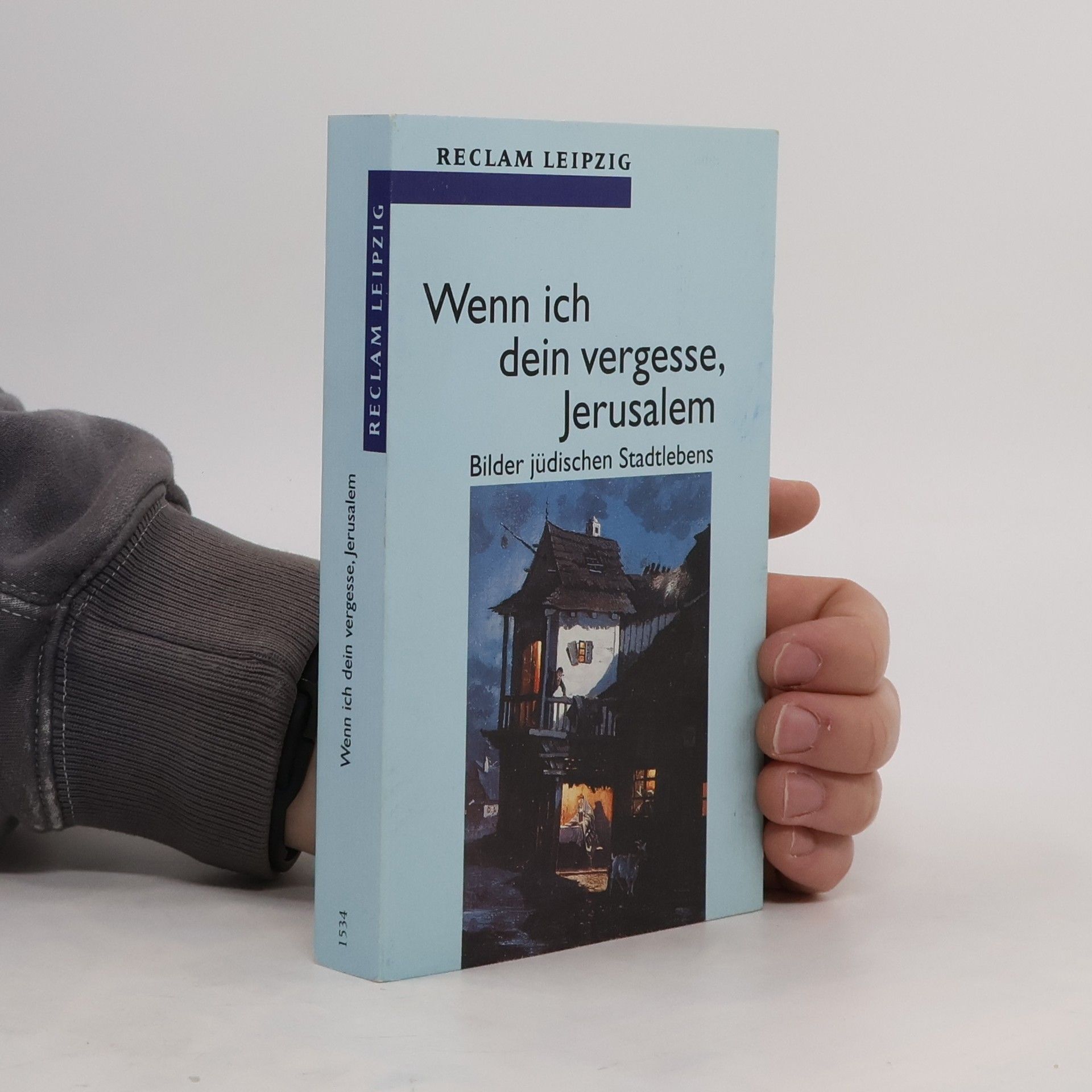Die Buchreihe, die 1992 ins Leben gerufen wurde, bietet ein interdisziplinäres Forum zur Erforschung deutsch-jüdischer Literatur und Kultur. Sie umfasst wissenschaftliche Monographien, Aufsatzsammlungen und kommentierte Quelleneditionen, die Werke jüdischer Autoren in deutscher Sprache sowie die von Antisemitismus geprägten Darstellungen nichtjüdischer Autoren beleuchten. Durch die Analyse dieser Aspekte wird die komplexe Beziehungsgeschichte zwischen Juden und der deutschen Literatur umfassend behandelt.
Joachim Schlör Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)




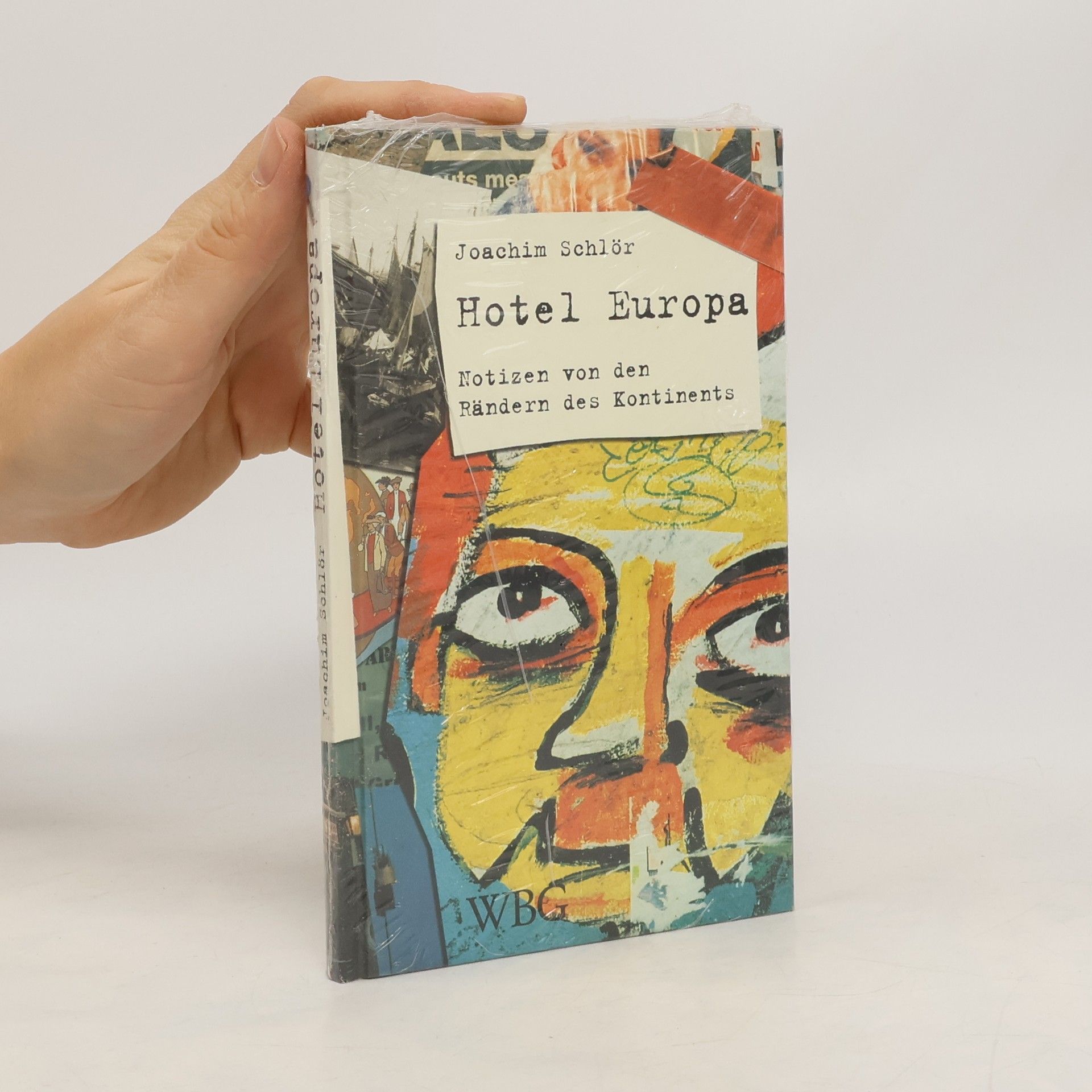
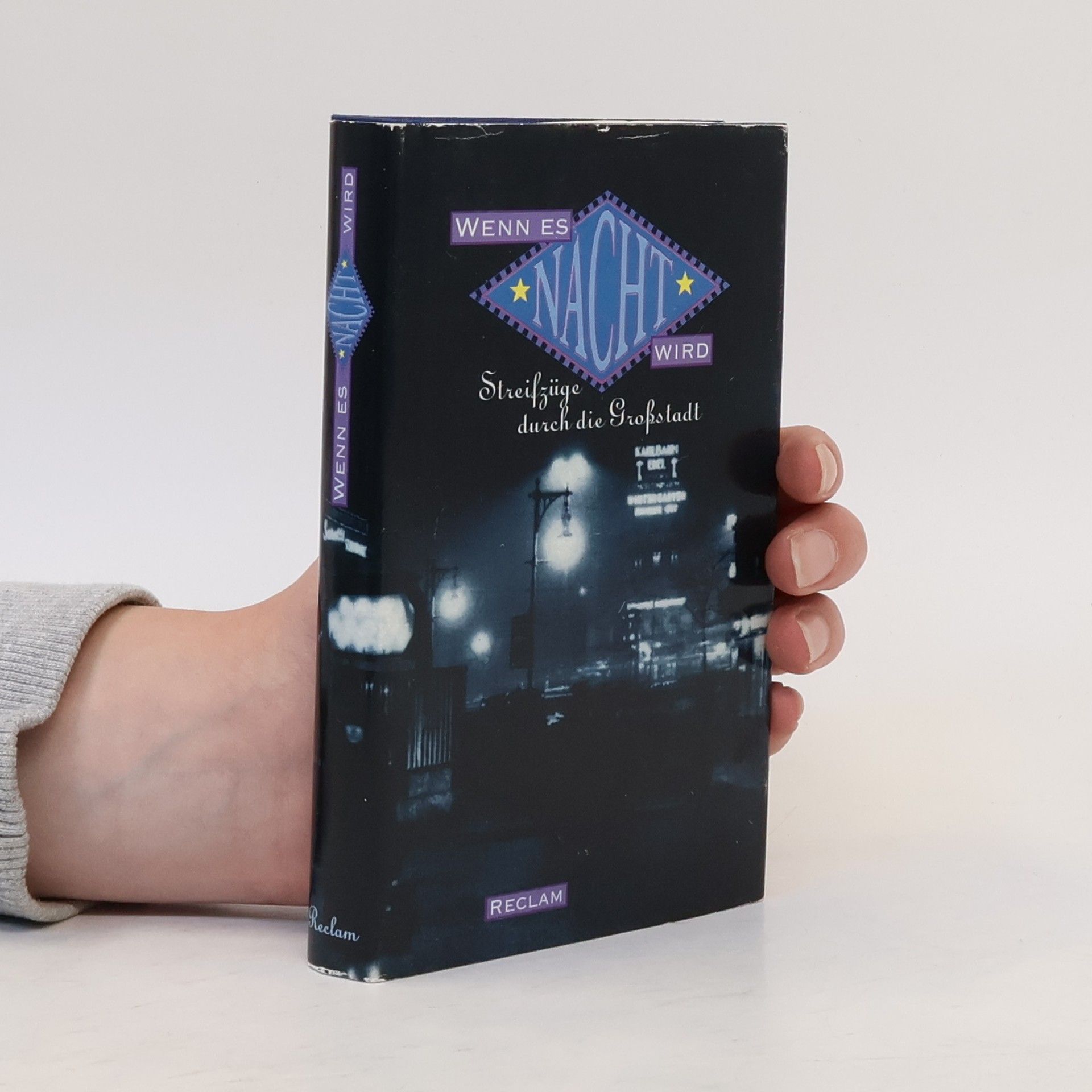
Sammy Gronemann: Kritische Gesamtausgabe / Briefwechsel
- 400 Seiten
- 14 Lesestunden
Die Buchreihe, seit 1992 etabliert, bietet ein interdisziplinäres Forum zur Erforschung deutsch-jüdischer Literatur und Kultur. Sie umfasst wissenschaftliche Monographien, Aufsatzsammlungen und kommentierte Quelleneditionen, die Werke jüdischer Autoren in deutscher Sprache sowie die von Antisemitismus geprägten Perspektiven nichtjüdischer Autoren berücksichtigen. Dadurch wird die komplexe Beziehungsgeschichte zwischen diesen beiden Kulturen beleuchtet und ein umfassendes Verständnis der jüdischen Aspekte in der deutschen Literatur ermöglicht.
Jüdische Migration und Mobilität
Kulturwissenschaftliche Perspektiven
Im Herzen immer ein Berliner
Jüdische Emigranten im Dialog mit ihrer Heimatstadt
Theodor W. Adorno vermutete 1952 in einem Brief an Gershom Scholem, dass Walter Benjamins Berliner Kindheit um 1900 in Deutschland nicht genügend rezipiert werde, "wegen des Traumatischen, das hierzulande sich geltend macht, sobald der Name Berlin fällt". Joachim Schlör geht der Frage nach, was es mit dem "Traumatischen" auf sich hat und was sich noch "geltend macht, sobald der Name Berlin fällt". Im Mittelpunkt stehen ehemalige Berlinerinnen und Berliner, die sich in Briefen und Berichten, in Erinnerungen und aktuellen Bekundungen mit dieser Stadt auseinandersetzen. Den Kern bildet eine Korrespondenz, die zwischen 1991 und 1995 zwischen den Autoren des Gedenkbuchs für die ermordeten Juden Berlins und über die ganze Erde verteilten Berliner Emigrantinnen und Emigranten sowie deren Nachkommen geführt wurde. Es geht dabei um die Berlin-Gefühle derer, die (oft als Kinder, mit oder ohne ihre Eltern) die Stadt nach 1933 verlassen mussten und die aus unterschiedlichen Gründen wieder mit ihr in Verbindung gekommen sind.All diese Briefe enthalten Emotionen: Zorn, Enttäuschung, Trauer, aber auch echte Zuneigung und großes Interesse an ihrer früheren Heimatstadt. Die Texte sind eingerahmt von Anmerkungen zur Geschichte der berlinisch-jüdischen Beziehung, zum Bruch 1933 und zum Weiterleben des spezifisch "Berlinischen" im Exil oder in der jeweiligen neuen Heimat.
Kritische Gesamtausgabe, Hawdoloh und Zapfenstreich
Erinnerungen an die ostjüdische Etappe 19161918
- 268 Seiten
- 10 Lesestunden
Die Erlebnisse des Autors an der Ostfront des Ersten Weltkrieges werden in diesem Werk eindrucksvoll verarbeitet. Gronemann schildert seine Zeit in der Presseabteilung und beleuchtet seine Freundschaft mit Arnold Zweig. Das Buch bietet faszinierende Einblicke in Begegnungen mit Schriftstellern sowie in einen einzigartigen Verein ehemaliger Intellektueller. Zudem wird die Bedeutung der jüdischen Kulturarbeit in der Weimarer Republik hervorgehoben, einschließlich der Gründung des ersten modernen Jüdischen Theatervereins in Berlin. Die Perspektive auf die osteuropäisch jüdische Welt ist dabei besonders bemerkenswert.
Hotel Europa
Notizen von den Rändern des Kontinents
Tel Aviv
- 352 Seiten
- 13 Lesestunden
In Tel Aviv – From Dream to City Joachim Schlör brings the reader closer to this "most talked about city." The author interviewed numerous inhabitants and gathered information from books, travel accounts, newspaper articles and memoirs. He looks at the city from its origins right up to the Tel Aviv as a centre of immigration that contains reminders of each immigrant's mother country; as a catalyst between East and West; and – not least – as a place of transformation for Jews who fled the Nazi terror.
Israel : der Staatsgründer erinnert sich
- 251 Seiten
- 9 Lesestunden
Der legendäre erste Ministerpräsident Israels erzählt in seinen Memoiren aus erster Hand über die dramatische Ereignisse der 30er und 40er Jahre: Britische Besatzung, illegale Einwanderung der in Europa verfolgten Juden, Staatsgründung 1948 und unmittelbar darauf der Unabhängigkeitskrieg gegen die arabischen Nachbarn.
Tel Aviv, 1909 als bescheidene Gartenvorstadt von Jaffa gegründet, ist als Tor von Israel zum Symbol für die Vielfalt der Kulturen, Sprachen und Lebensstile des Gelobten Landes geworden. Zugleich ist Tel Aviv die erste hebräische Stadt der Moderne, ein Laboratorium für den jüdischen Staat, und damit der zentrale Ort für die neue kulturelle Identität Israels. Mit Hilfe von Gesprächen mit ihren Einwohnern - aber auch Büchern, Reiseberichten, Zeitungsartikeln und Memoiren - stellt der Autor die Stadt von ihren Anfängen bis in die Gegenwart vor.