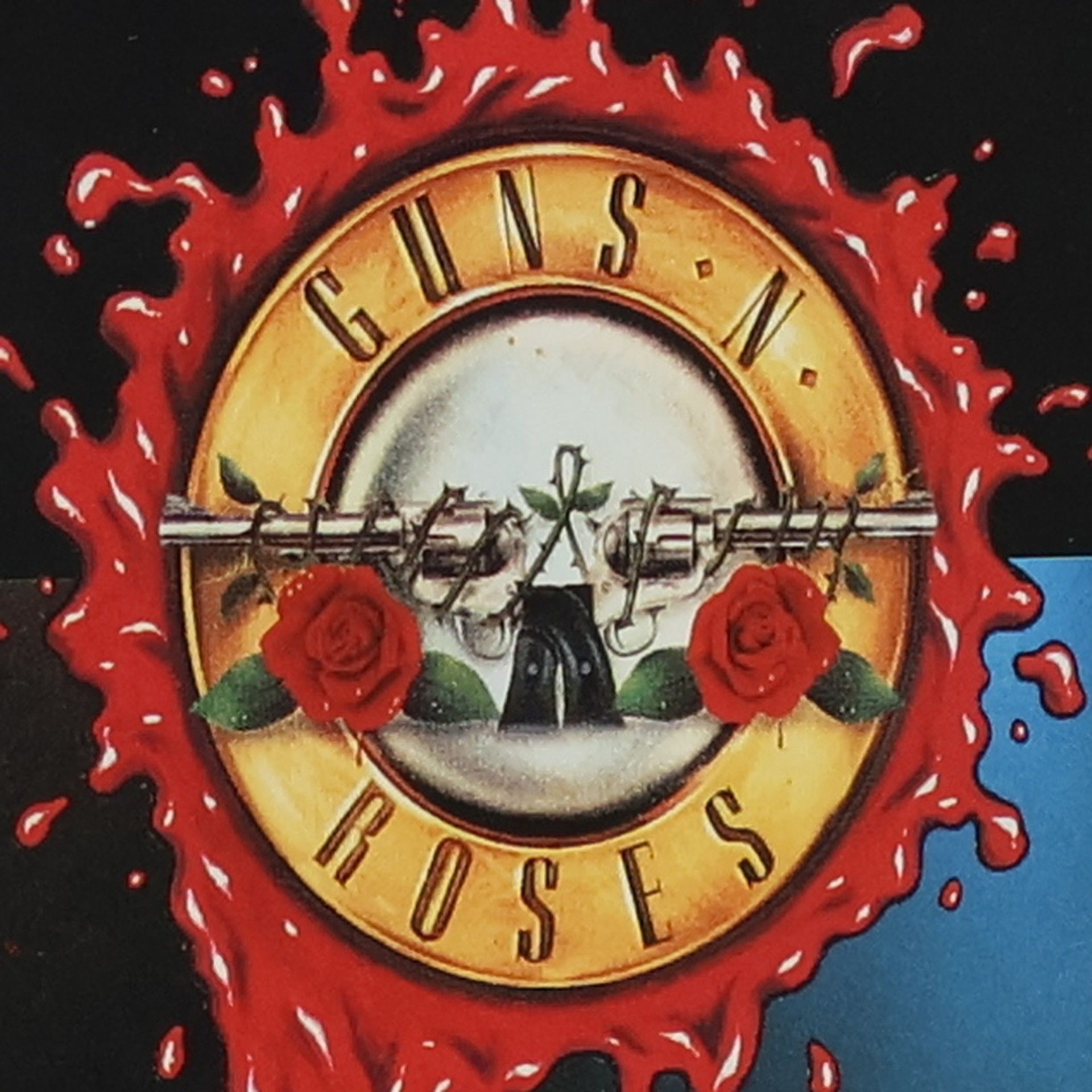Guns N' Roses. The photographic history
- 192 Seiten
- 7 Lesestunden
The full story of Guns n' Roses as told by the members of the band themselves. It includes many previously unpublished photographs of Axl, Slash, Duff and Gilby on stage and behind the scenes, and forms a pictorial history of the band from its creation in 1985 to its present success.