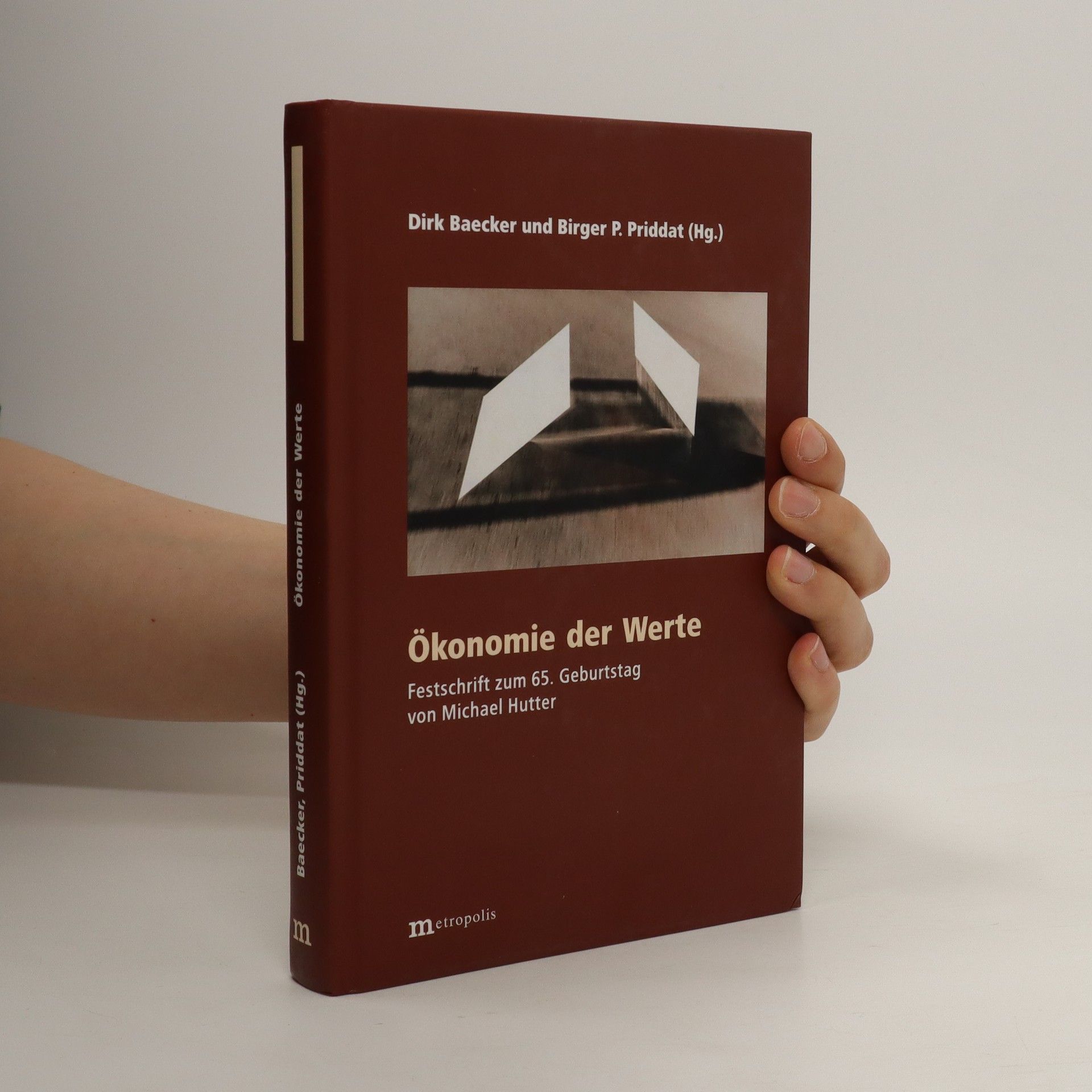Im Fokus stehen die dynamischen Institutionen, die Neugestaltung von Märkten durch Transaktionen und die oft vernachlässigte Dimension der Gaben in der Ökonomie. Der Autor präsentiert einen eigenen Ansatz des ökonomischen Denkens, der die Wechselwirkungen zwischen Ökonomie und Philosophie der letzten zwei Jahrzehnte beleuchtet. Diese Forschung eröffnet neue Perspektiven auf die Funktionsweise von Märkten und betont die Bedeutung von nicht-marktlichen Aspekten in der wirtschaftlichen Analyse.
Birger Priddat Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)






Die Ökonomie wird zunehmend als komplexes Gefüge verstanden, das nicht nur von rationalen Prinzipien geprägt ist. Die Vielzahl an Bruchstellen, Überschätzungen und unbeachteten Einflüssen zeigt, dass die Beziehung zwischen Ökonomie und Kultur vielschichtiger ist, als es die traditionelle Ökonomik vermuten lässt. In 13 Essays wird diesen Verstrickungen nachgegangen, die das Ökonomische als polyvalent und relational erweisen. Die Themen umfassen die kulturellen Verflechtungen der Ökonomie, die Auswirkungen von Marktdiversifikation auf die Gesellschaft, sowie die Transformation von Käufern zu Konsumenten in verschiedenen Handelsformen. Alltagsentscheidungen und deren ästhetische Dimensionen werden ebenso thematisiert wie die Frage der Solidarität in der heutigen Zeit. Weitere Essays behandeln die Beziehung zwischen Notwendigkeit, Anthropozän und Klimawandel, sowie die Prüfung von Nachhaltigkeitsnormen. Marktliche Interpretationen von Religion und die Herausforderungen megastädtischer Strukturen werden ebenfalls beleuchtet. Zudem wird die Diskrepanz zwischen Freiheit, Markt und Politik thematisiert und die Grundlagen der Ökonomisierung hinterfragt. Schließlich wird die semiökonomische Ökonomie als komparatistische Kultur untersucht, wobei Indikatoren und Rankings in den Fokus rücken, um Wettbewerbsformen jenseits des Effizienzideals zu analysieren.
Digitale Welten
- 200 Seiten
- 7 Lesestunden
Freiheit aushalten
Ein Rückblick (mit Ausblick) auf die ersten 25 Jahre der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der Universität Witten/Herdecke
- 170 Seiten
- 6 Lesestunden
Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der Universität Witten/Herdecke feierte 2009 ihr 25-jähriges Bestehen und ist die zweite Gründung nach der medizinischen Fakultät von 1982. Als erste private Universität Deutschlands hat sie bedeutende Impulse für andere Hochschulen gegeben und verfolgt ein eigensinniges Bildungskonzept im Humboldtschen Geiste. Zu den Gründern zählen Konrad Schily und Alfred Herrhausen, der in einer Rede „gebildete Unternehmer“ forderte – ein zentraler Antrieb für die Fakultät. In dieser Festschrift reflektiert die Fakultät ihre Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Anstelle einer klassischen Festschrift wird sie in Form einer Bricolage präsentiert, die das vielfältige Bild der Fakultät zeigt. Der Text ist spektralanalytisch angelegt und spiegelt den Widerspruchsgeist wider, den die Fakultät lehrt. Die Inhalte umfassen Grußworte von Alumni, Betrachtungen zur Bildungsexzellenz, wissenschaftliche Karrieren, Einblicke in die Institute und Lehrstühle, Unternehmergespräche sowie Erinnerungen aus der Frühgeschichte der Fakultät. Didaktische Leitlinien und Vergleiche der Lehre über vier Semester runden das Bild ab. Möge das Lesen Freude bereiten.
Die ökonomische Theorie hat sich seit den Interventionen von Coase und North von einer reinen Koordinationslandschaft zu einer vorstrukturierten Perspektive entwickelt. Die Regeln, die Märkte koordinieren, sind nicht nur rechtlicher Natur, sondern umfassen ein breites Spektrum formaler und informaler Strukturen, die die Ökonomie stärker prägen als Recht und Wirtschaftspolitik. Der Abschied von Laisser-Faire-Normen und Regelungsphantasien zeigt, dass Institutionen das Verhalten ihrer Mitglieder nicht direkt, sondern indirekt durch Governance regulieren. Dies hat weitreichende Konsequenzen für die ökonomische Theorie: Die moderne institutionelle Ökonomie nähert sich wieder soziologischen Fragestellungen und ist in der Lage, komplexe Situationen zu analysieren, die durch traditionelle Markt- und Effizienzbetrachtungen nicht erfasst werden. Institutionelles Handeln wird zum Kern ökonomischen Handelns. Priddat erörtert die Auswirkungen einer institutionenökonomischen Perspektive auf verschiedene Themen wie Kultur, Regeln, Governance, Korporatismus und Systemtheorie. Der Autor skizziert einen breiten Horizont, der die Herausforderungen und Entwicklungen innerhalb der Ökonomie sichtbar macht. Diese Erweiterung wird nicht überall akzeptiert, doch die institutionelle Ökonomie setzt sich zunehmend durch.
Mode für Millionen. Steilmann - ein Netzwerk von Menschen und Ideen
- 216 Seiten
- 8 Lesestunden
Moralischer Konsum
- 236 Seiten
- 9 Lesestunden