正版授权 卖家 : Boolee 加微信[soweinc]每天分享好书,邀你加入国际微信群学习交流.微信好友低至5优惠 .书名:文学学导论简介:作者:(德)贝内迪克·耶辛Benedikt Jeing,拉尔夫·克南Ralph K?hnen出版社:北京大学出版社出版时间:2015年12月装订方式:平装分类:文学|文学理论新世纪国外文论教材精品系列
Ralph Köhnen Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
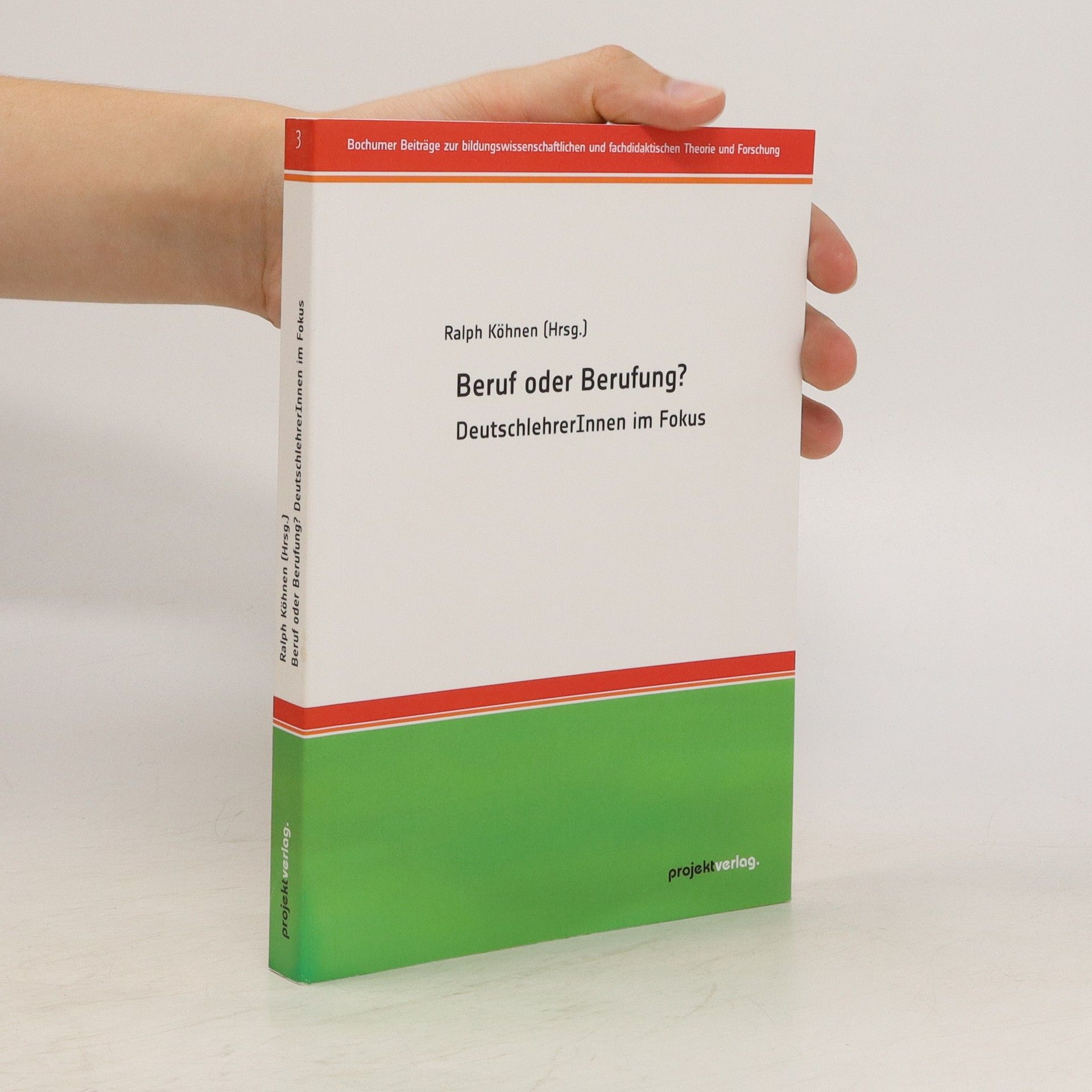
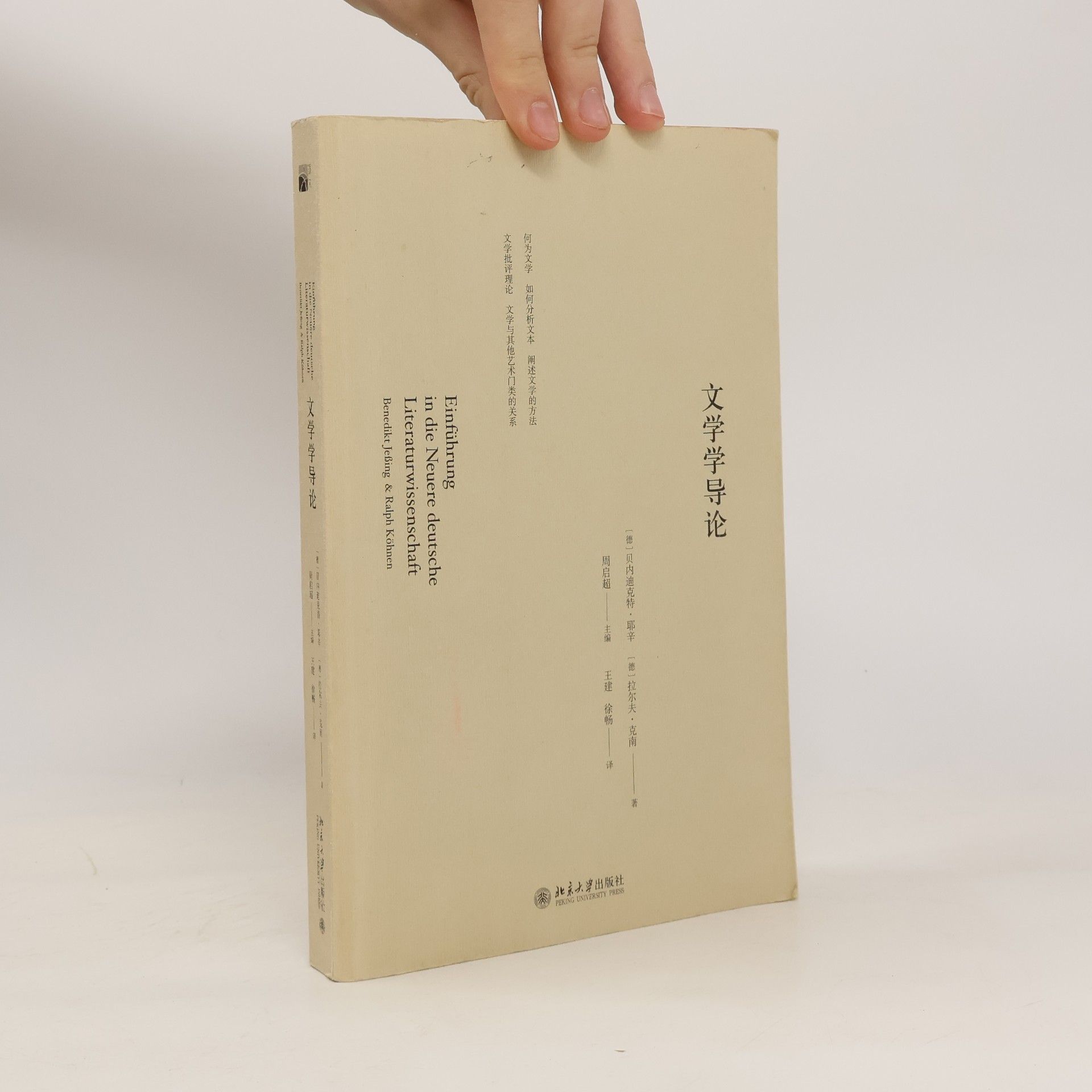
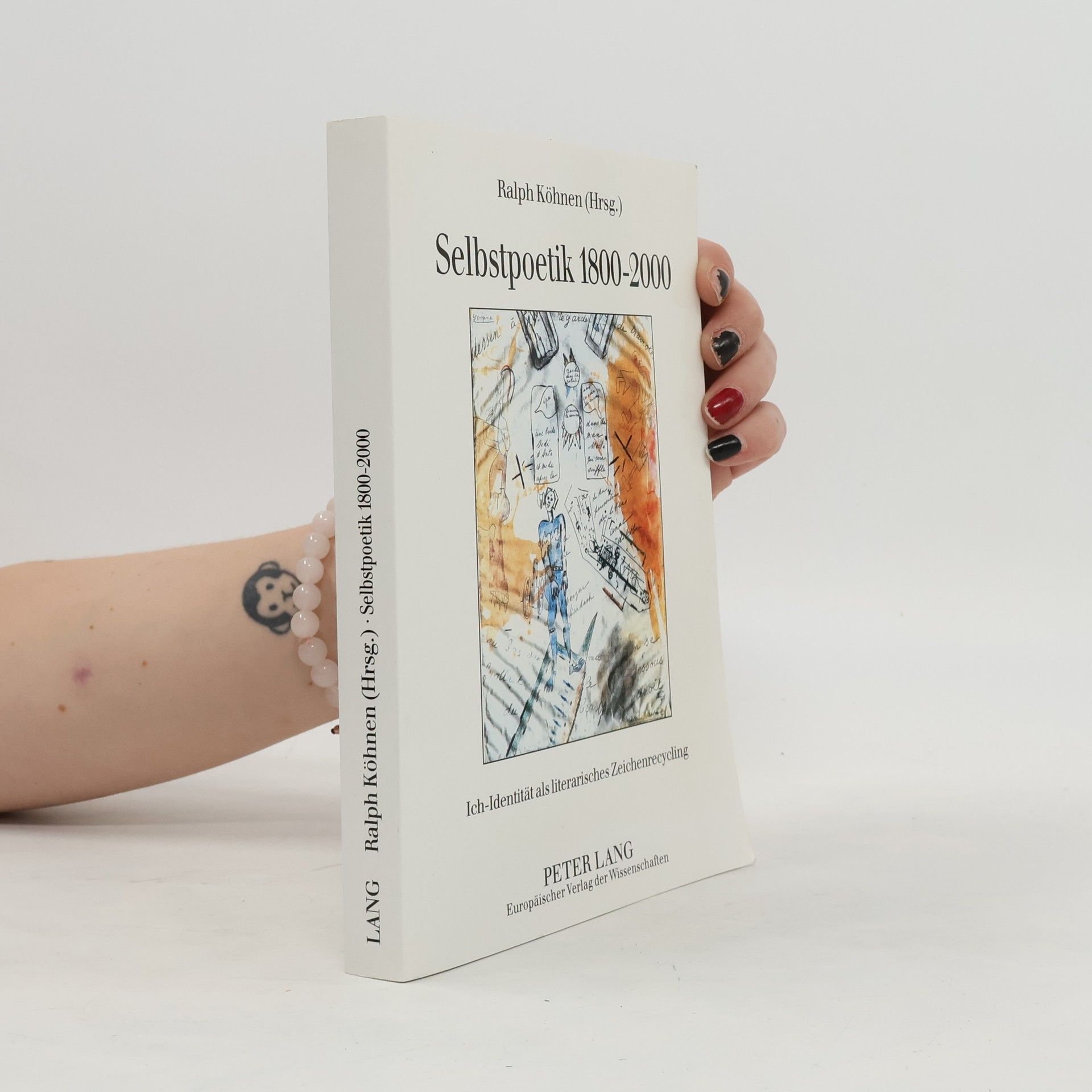

Der Lehrberuf ist in den letzten Jahren unter allseitigen Druck geraten. Und wie man nicht erst seit den Veröffentlichungen des NRW-Schulministeriums im Februar 2011 weiß, häufen sich die Fälle eines frühzeitigen Ausscheidens bzw. die Anträge auf Frühpensionierung wegen Dienstunfähigkeiten oder psychosomatischer Erkrankungen. Teilweise sind diese durch äußere Umstände induziert. Allerdings ergäbe es ein falsches Bild, wenn man die Ursachen einzig in den Strukturen suchen würde. Zum Teil sind es auch die subjektiven Dispositionen der LehrerInnen, die einen guten oder schlechten Berufsverlauf bedingen. Hier setzt die vorliegende Studie an, die im Winter 2011/12 an der Ruhr-Universität Bochum mit 109 beteiligten Studienbeginnern des M. Ed.-Faches Deutsch durchgeführt wurde. Gefragt wurde nach Berufseinstellungen, Motivationen, Leistungsaspekten, Freizeitinteressen, Mediengebrauch und -kenntnissen sowie insgesamt nach den Selbstkonzepten der LehramtskandidatInnen. Dieser empirisch-statistische Angang und die Auswertung mit SPSS wurde durch qualitativ-narrative Interviews gestützt, was langfristig durch Tagebuchaufzeichnungen, Selbsterzählungstexte und Aufzeichnungen aller Art, die den Schulalltag betreffen, zu ergänzen ist.
Einführung in die Neuere Deutsche Literaturwissenschaft
- 424 Seiten
- 15 Lesestunden
Standardwerk - jetzt noch übersichtlicher gestaltet. Dafür sorgen vor allem das zweifarbige Innen-Layout, Kapiteleinleitungen, Info-Kästen und hervorgehobene Schlüsselbegriffe. Auch inhaltlich überzeugt das Lehrbuch. Von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart stellen die Autoren alle wichtigen Epochen vor und führen ein in die Analyse der verschiedenen Gattungen. Als wertvolle Ergänzung erweist sich der Ausblick auf die Berufsfelder für Literaturwissenschaftler. In der Neuauflage erstmals mit Übungen.
Die Idee des «invent yourself», der Ich-Konstruktion mit künstlerischen Mitteln hat bei aller Aktualität auch eine lange Tradition, die bis in die griechische Antike zurückweist. Im 18. Jahrhundert bahnt sich eine Entwicklung an, in der das Ich als ein ästhetisch geformtes begriffen wird: Anthropologie und Ästhetik geben zunächst dem privilegierten Autor die Möglichkeit zum Selbstentwurf, mit der Romantik wird dann das Angebot an alle anderen ausgeweitet. Knapp 20 Beispiele von Herder über Nietzsche bis zu Autoren der Gegenwart sollen zeigen, wie sich solche Technologien des Selbst in Literatur, bildender Kunst und Philosophie entwickelt haben, wenn dabei das Ich auf kulturelle Stereotypen oder Ikonografien greift und diese variiert, also ein Zeichenrecycling in der Literatur betreibt.