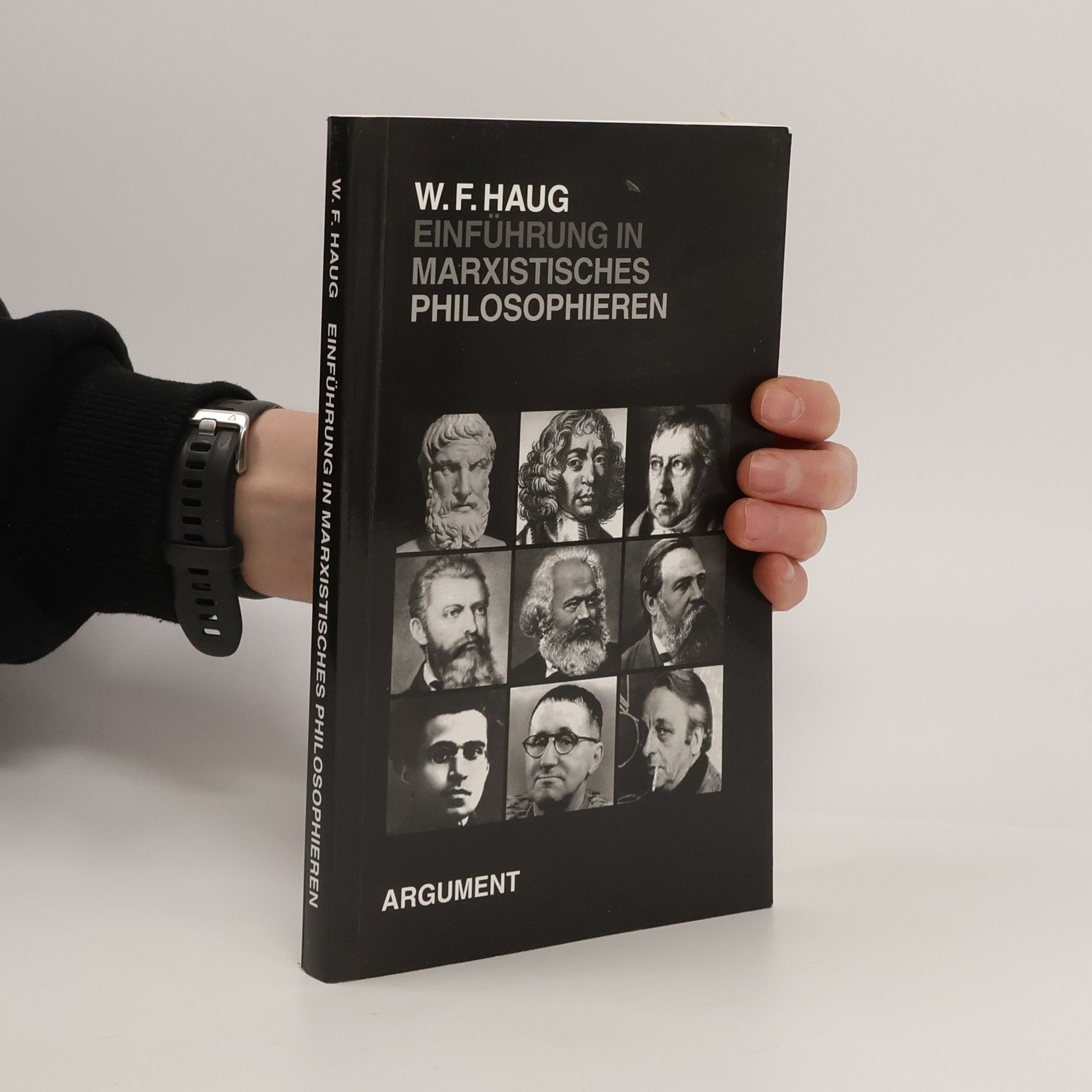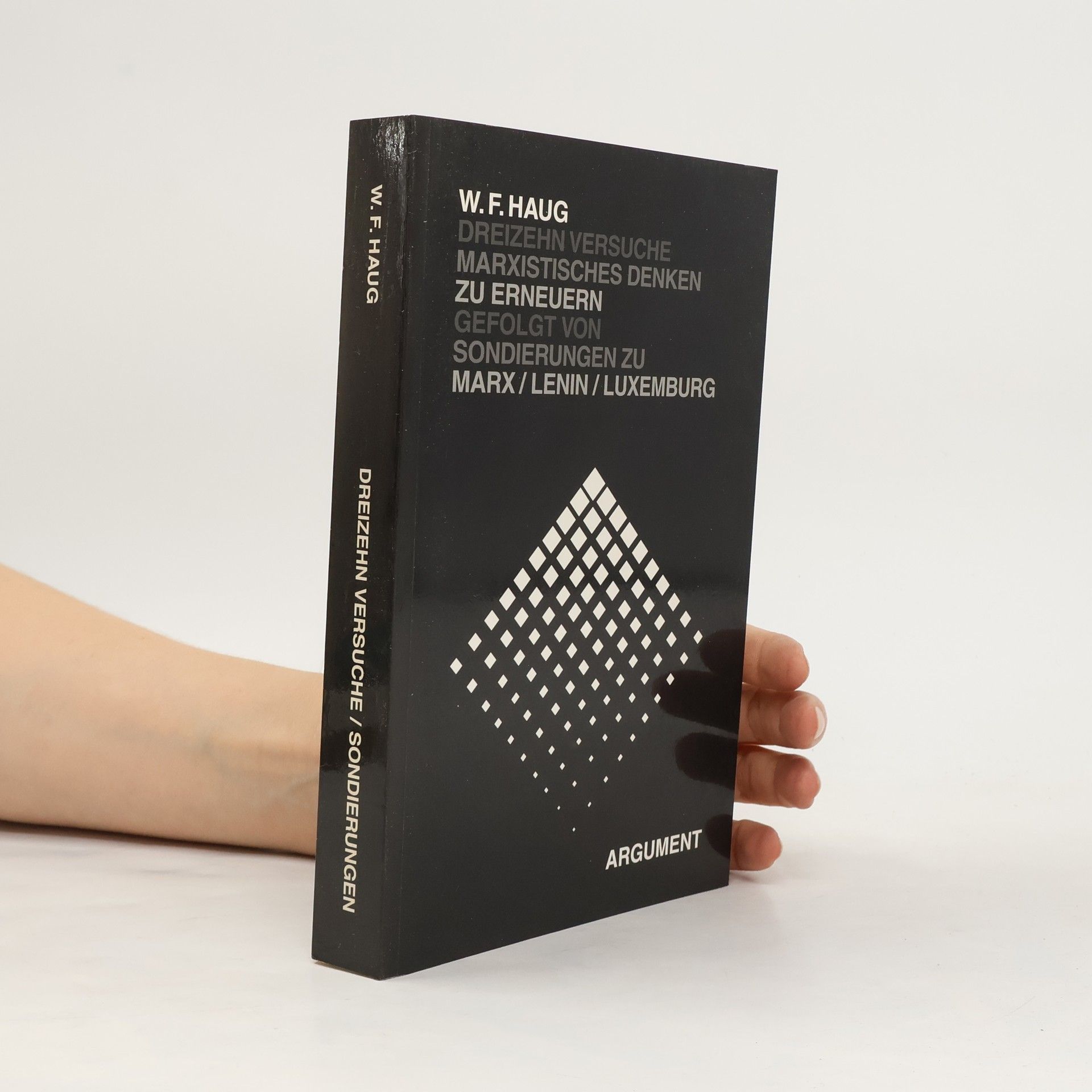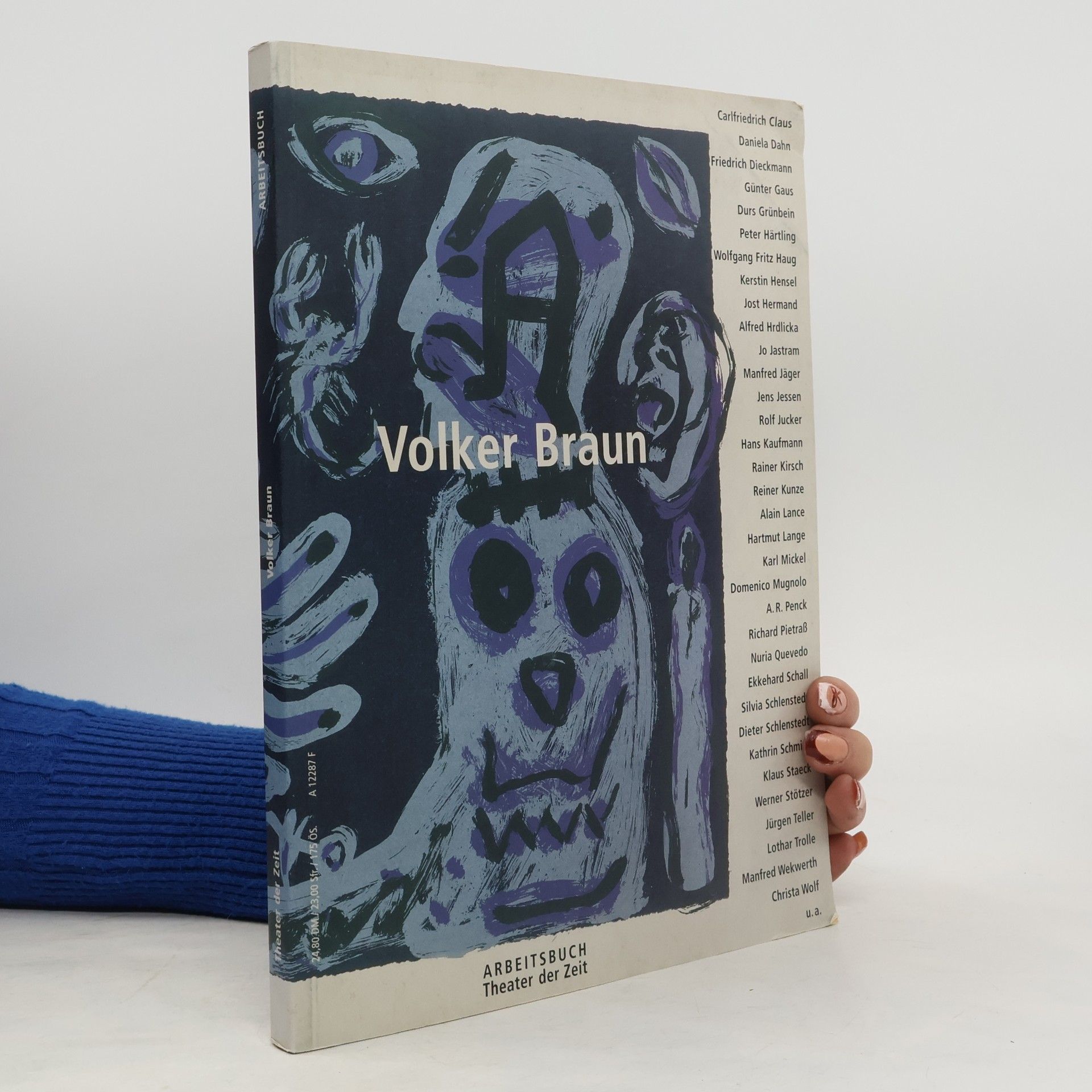Im HKWM widmen sich mehr als 800 Wissenschaftler*innen dem historisch-materialistischen Projekt von Marx und Engels; der aktuelle Band bearbeitet die Stichwörter Mitleid bis Nazismus.Aus dem Vorwort zu Band 9/II:Wer das HKWM nicht nur als Nachschlagewerk nutzt, sondern auch oder sogar primär als »Vorschlagwerk«, in dem man auf Erkundung gehen kann, wird die Erfahrung machen, dass Vergangenheitserkenntnis der Gegenwart auf eine Weise zu begegnen vermag, die ihr bei aller Differenz ein Licht aufsteckt. Es sind dies die Momente, in denen Vergangenes – mit Walter Benjamin gesprochen – »mit der Gegenwart zu einer Konstellation zusammentritt« (GS I.3, 1242). Darauf zu achten, dass oft bisher wenig beachtete Stellen der klassischen Texte des Marxismus Licht auf die aktualen Krisenkonstellationen werfen können, muss die Kriterien der redaktionellen und editorischen Arbeit mit den Autorinnen und Autoren und ihren Texten schärfen und dabei helfen, Archivalisches zugunsten des praktisch-theoretischen Spannungsbogens zurückzudrängen. Gewinnen wird dadurch der von Wolfgang Küttler im Vorwort zu Band 9/I beschriebene Charakter einer »historisch-kritisch fundierten Erzählung aus vielen Erzählungen« (I) der wie ein Mosaik vom Alphabet zu einem Buch zusammengesetzten Stichwortartikel.
Wolfgang Fritz Haug Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

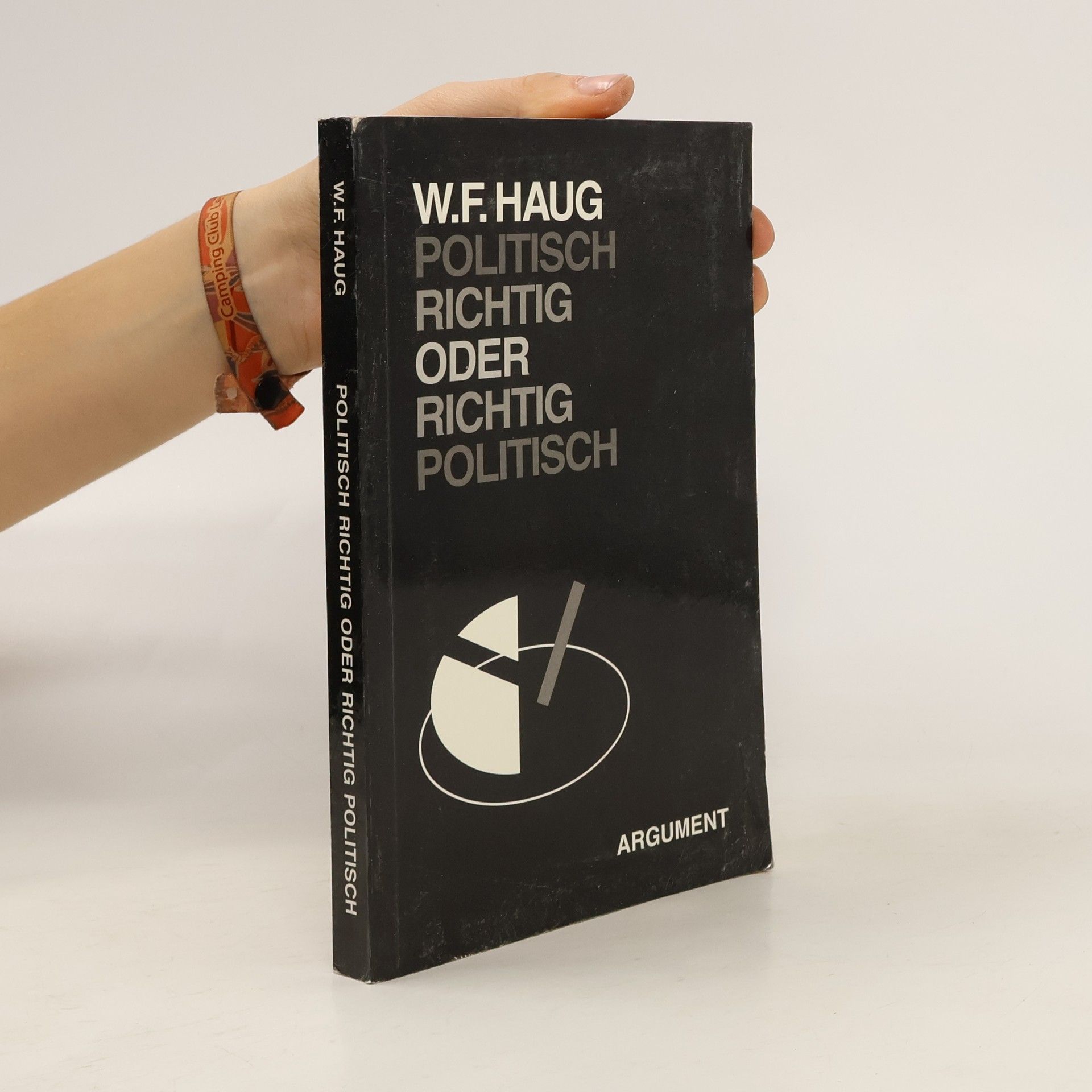
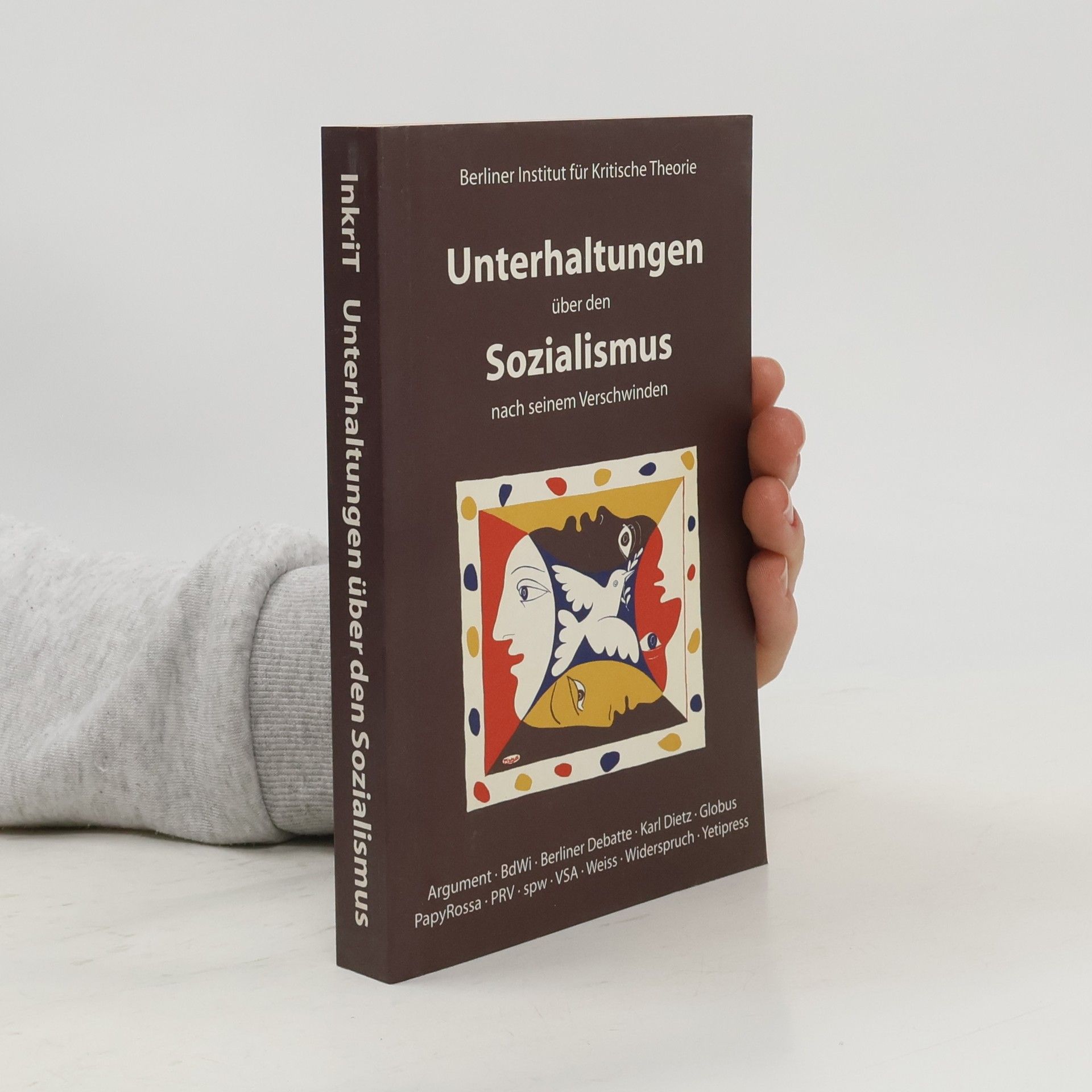

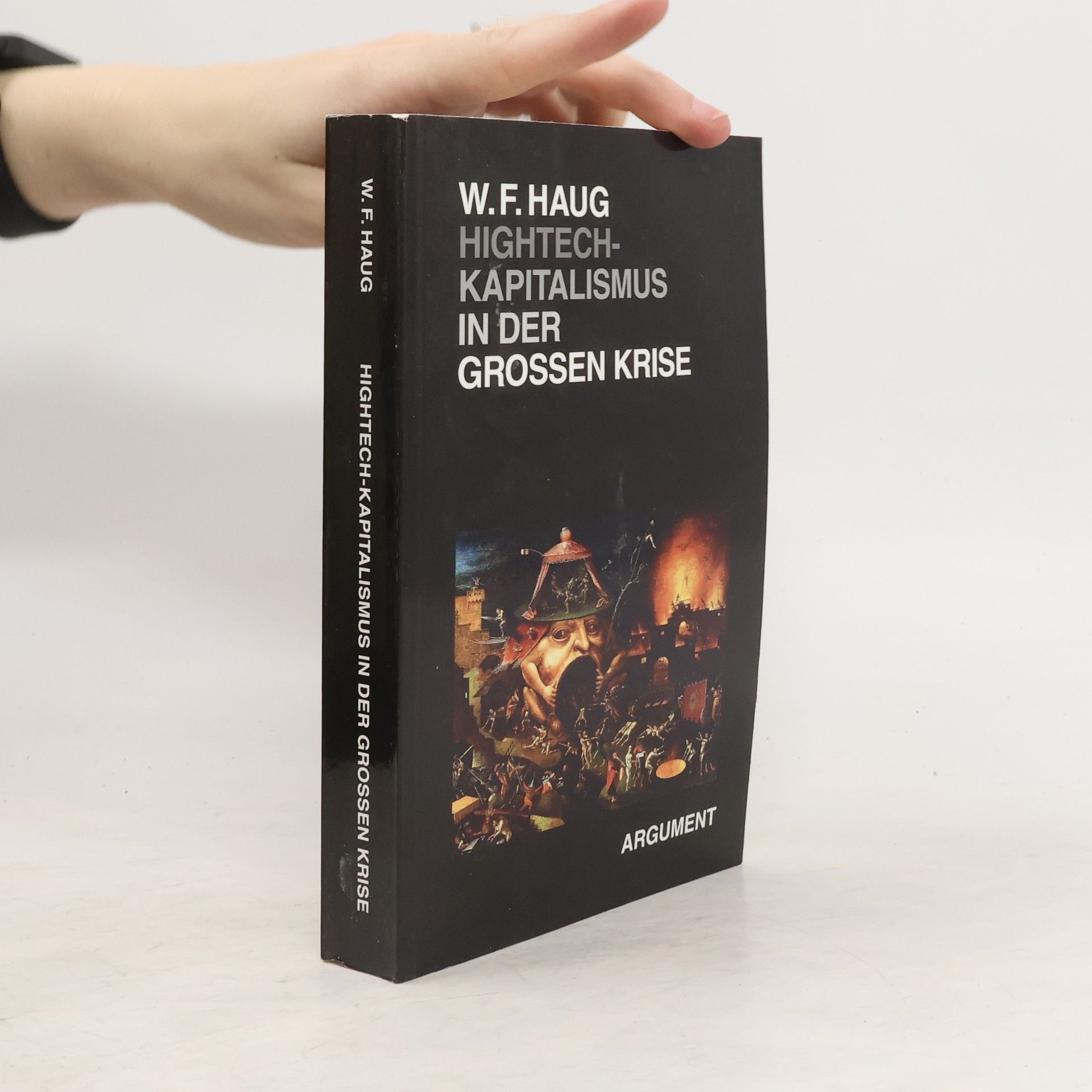
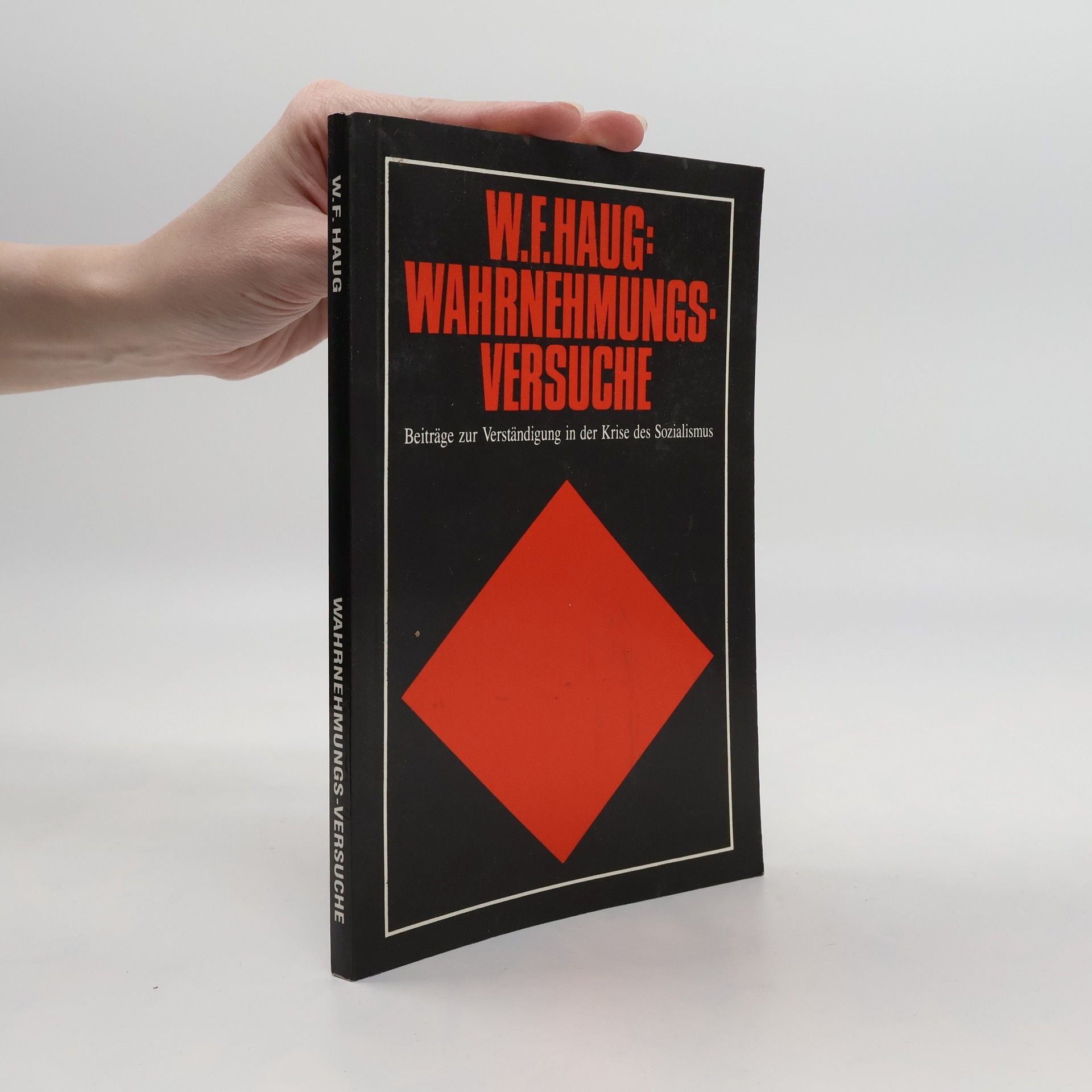
Faschisierung des bürgerlichen Subjekts
Die Ideologie der gesunden Normalität und die Ausrottungspolitiken im deutschen Faschismus. Materialanalysen
Der Band untersucht die aktuelle Krise des transnationalen Hightech-Kapitalismus und vergleicht sie mit der Krise des Fordismus, die zur Entstehung des Nazismus und des Weltkriegs führte. Er analysiert Triebkräfte und Strukturen der computerbasierten Produktionsweise und deren Auswirkungen auf die Staatenwelt und baut auf W.F. Haugs Studien von 2003 auf.
'Beschäftigen wird uns ebesowohl, was es heißt, in der Philosophie Marxist zu sein, als auch die noch viel kniffligere Frage, was es heißt, im Marxismus Philosoph zu sein.' Mit dieser Vorlesung hat Haug sich nach 35-jähriger Lehrtätigkeit im Winter 2000 auf 2001 von Berlin und seiner Freien Universität verabschiedet. 'Wie man bei einem Buch das Vorwort zuletzt schreibt, holt die Abschiedsvorlesung die Vorschule nach. Sie tut dies, indem sie die Voraussetzungen kritischen Philosophierens im Anschluss an Marx reflektiert, dessen Denkentwicklung sie einer eingehenden Relektüre unterzieht.'
Dreizehn Versuche marxistisches Denken zu erneuern
- 317 Seiten
- 12 Lesestunden
Trotz des staatssozialistischen Scheiterns im 20. Jahrhundert wäre es eine Torheit, Marx als toten Hund zu behandeln. Doch vermag das marxistische Projekt solidarischer und ökologisch nachhaltiger Vergesellschaftung nicht zu leben, ohne dass wir seinen bisherigen geschichtlichen Lebenslauf und seine ›philosophische Grammatik‹ historisch-kritisch unter die Lupe nehmen und seine Umsetzung durch die leninsche Revolution neu bewerten. Um Beiträge zu dieser Arbeit geht es in diesem Buch. 'Was zunächst als Vielzahl separater Versuche zu einzelnen Fragestellungen erscheint, erweist sich als einzigartige Einführung in historisch-kritisches Arbeiten heute. ' (Frigga Haug) 'Eine sorgfältige Lektüre der hier vorgelegten gedankenreichen ›Erneuerungsversuche‹ ist aufs Innigste zu wünschen.' (Hermann Klenner)
Gewalt Verhältnisse
- 296 Seiten
- 11 Lesestunden
Die Kämpfe auf der Ebene des Kulturellen nehmen an Bedeutung zu. Auch wo offensichtlich gegen die Lebensinteressen breiter Kreise von Bevölkerung Politik gemacht wird, wird um Zustimmung gerungen. Auf dem Feld des Politischen agieren unterschiedliche Akteure von rechts und links. In radikalen Umbrüchen gibt es von rechts Entlehnungen und Indienstnahmen, Versuche, linke Politik in Fallen zu fangen, in Widersprüche zu verstricken. Umgekehrt wird es für linke Politik schwierig, in schnellen Wendungen sich nicht zu verrennen. Die Aufsätze im vorliegenden Band sind Eingriffe in linke Politik. Sie arbeiten mit großer Schärfe an aktuellen Problematiken und machen Vorschläge für eine Politik in Widersprüchen.