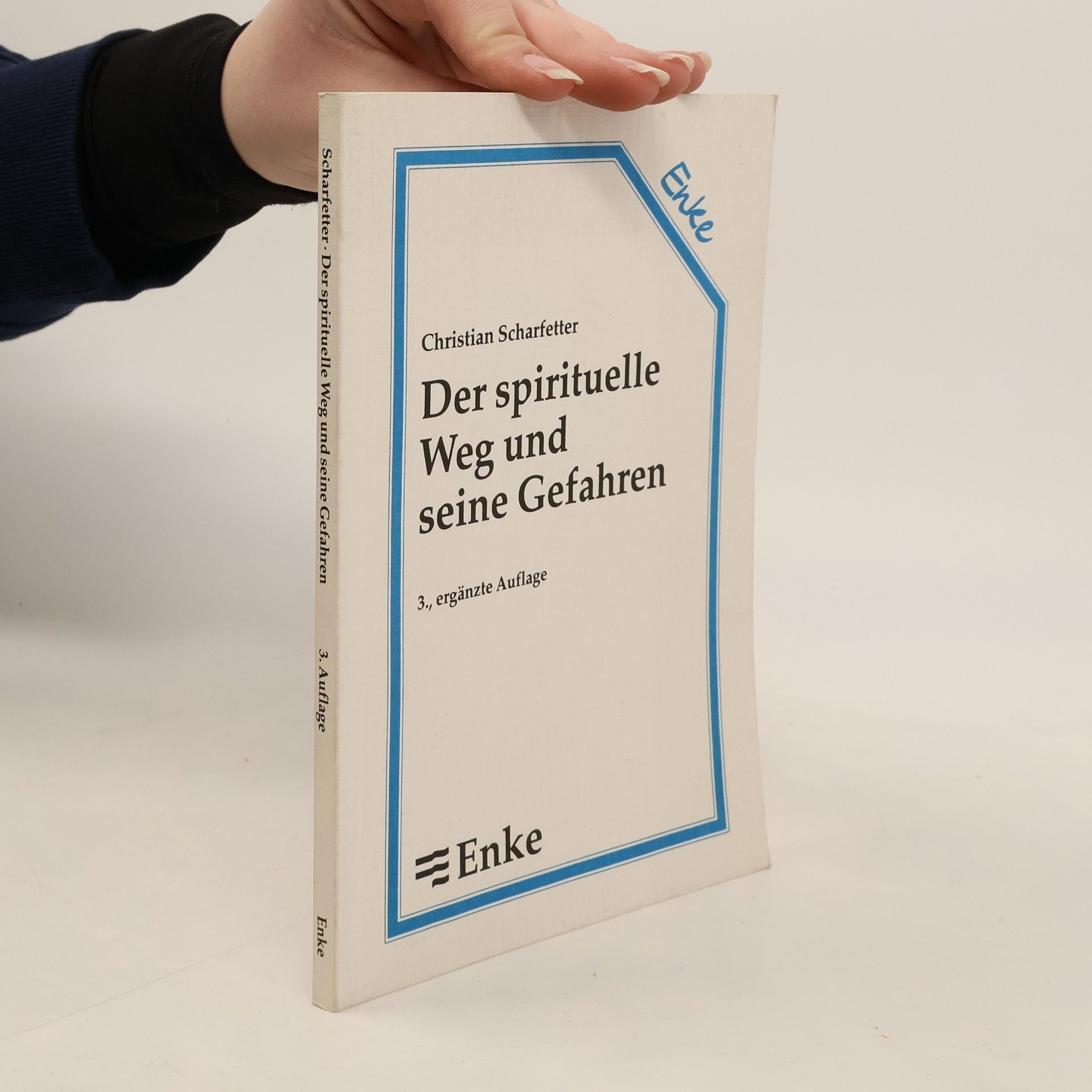Die Erfahrung der Existenz mit ihren Grenzsituationen ist der Ausgangspunkt für den Aufbruch der Bewusstseinsentfaltung zu personenüberschreitenden - und damit transpersonalen Horizonten. Spiritualität wird als grundsätzliche Lebensorientierung mit entsprechender Ethik universaler (auch ökologischer) Verantwortlichkeit aufgefasst. In dieser Bewusstseinsentfaltung wird eine weite Strecke geleistet: das Bild vom (spirituellen) Weg. Auf diesem Weg, versinnbildlicht im Bild einer großen Wanderung, kann das Ich sich aus der egozentrischen Position heraus entwickeln zum Bewusstsein, dass das einzelne Individuum ein verschwindend kleiner Partikel in einem unendlich individuumsüberschreitenden Kosmos (Absoluten, Übergreifenden, All-Einen) ist, dort aber aufgehoben. Auf diesem Weg lauern manche Gefahren für das Ich, das Selbst, Krisen von sehr unterschiedlichem Ausmaß bis zu psychopathologischen Manifestationen (Psychosen) können auftauchen - und erfordern eine sorgfältige Analyse als Vorbereitung für die Therapie.
Christian Scharfetter Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

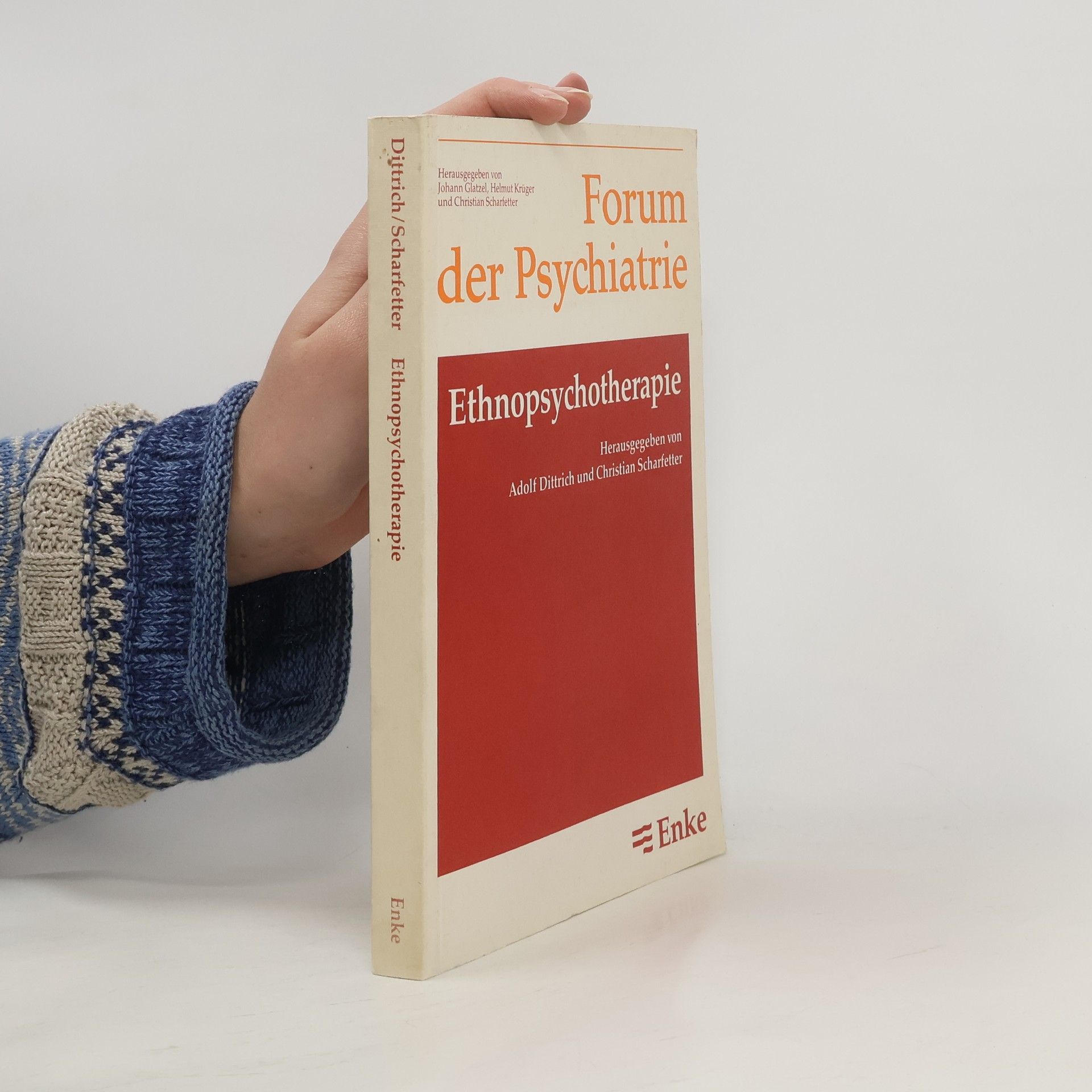




Was weiß der Psychiater vom Menschen?
- 153 Seiten
- 6 Lesestunden
Die Frage eines tiefgründigen Patienten:»Was weiß der Psychiater vom Menschen?« gab die Anregung zu diesem Rundblick in viele Grundthemen der Psychiatrie, die in den gängigen Lehrbüchern kaum berührt werden: Menschenbild, Psyche-Soma-Relation, Person, Biographie, Sinn, Logos und Mythos, Religion, Spiritualität, Mystik. Psychopathologie gibt Einblick in die „Werkstatt der Seele“, differenziert Kranksein, Krankheit, Normen. Symptome sind Wegweiser zur Therapie. Selbstdarstellungen der ersten Person vertiefen unsere Kenntnis davon, was psycho-physisches Kranksein als notvolles Erlebnis des Verlustes vom Bestand des Ich/Selbst und der Orientierung an der mitmenschlich gemeinsamen Wirklichkeit (ordinary or common sense reality) heißt.
Der spirituelle Weg und seine Gefahren - 3., ergänzte Auflage
- 126 Seiten
- 5 Lesestunden
Forum der Psychiatrie: Ethnopsychotherapie
- 277 Seiten
- 10 Lesestunden
German
Schizophrene Menschen
- 178 Seiten
- 7 Lesestunden
Allgemeine Psychopathologie
- 332 Seiten
- 12 Lesestunden
Psychische Störungen eindeutig und übersichtlich zu beschreiben, sie in einen Orientierungsrahmen einordnen zu können und Ansätze für ihr Verstehen zu gewinnen, ist ein wichtiges Anliegen für alle, die mit psychiatrisch-psychotherapeutischen Patienten in Berührung kommen. Dieses Buch vermittelt eine elementare, praxisbezogene Psychopathologie. Es führt eine Ordnung des Beschreibbaren ein, lehrt die erforderliche Sorgfalt des Beschreibens und der Begriffsverwendung und erlaubt Einblicke in die Hintergründe und Entstehung seelischer Störungen. Es zeichnet sich besonders aus durch: - Konzentration auf das Wesentliche, - überzeugende, einprägsame Systematik, - präzise, anschauliche Sprache bei Verzicht auf Fachterminologie, - intensiven Praxisbezug, vermittelt durch 100 Fallbeispiele