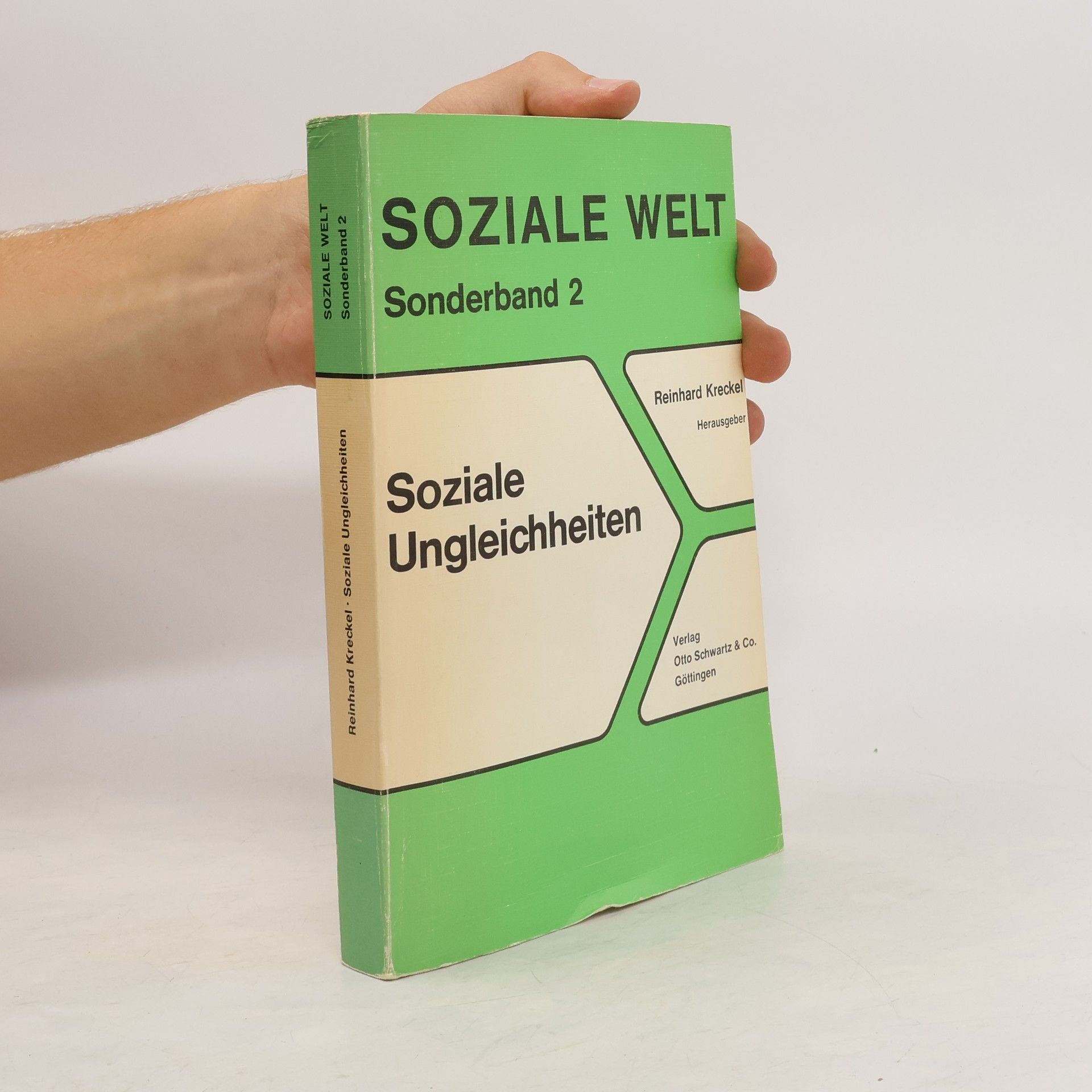Reinhard Kreckels Buch gehört zu den wichtigsten Werken soziologischer Gesellschaftstheorie der 90er Jahre in Deutschland. Kreckel entwickelt hier die begrifflichen und theoretischen Grundlagen für die Untersuchung der Ungleichheitsverhältnisse in der Welt. Sein Ansatz bezieht auch die von der herkömmlichen Klassen- und Schichtungstheorie stiefmütterlich behandelte geschlechtsspezifische Ungleichheit ein. Für diese erweiterte Neuauflage hat Reinhard Kreckel ein eigenes Kapitel zum Thema Globalisierung und soziale Ungleichheit verfasst, in dem er sein Zentrum-Peripherie-Modell weiterentwickelt. Ein weiteres neues Kapitel schildert anhand aktuellen Datenmaterials die Entwicklung der innerdeutschen Ungleichheiten seit der Vereinigung. Kreckel führt damit sein Projekt fort, einen zeitgemäßen theoretischen Bezugsrahmen zu entwickeln, innerhalb dessen soziale Ungleichheiten als Produkt gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse begriffen werden.
Reinhard Kreckel Bücher