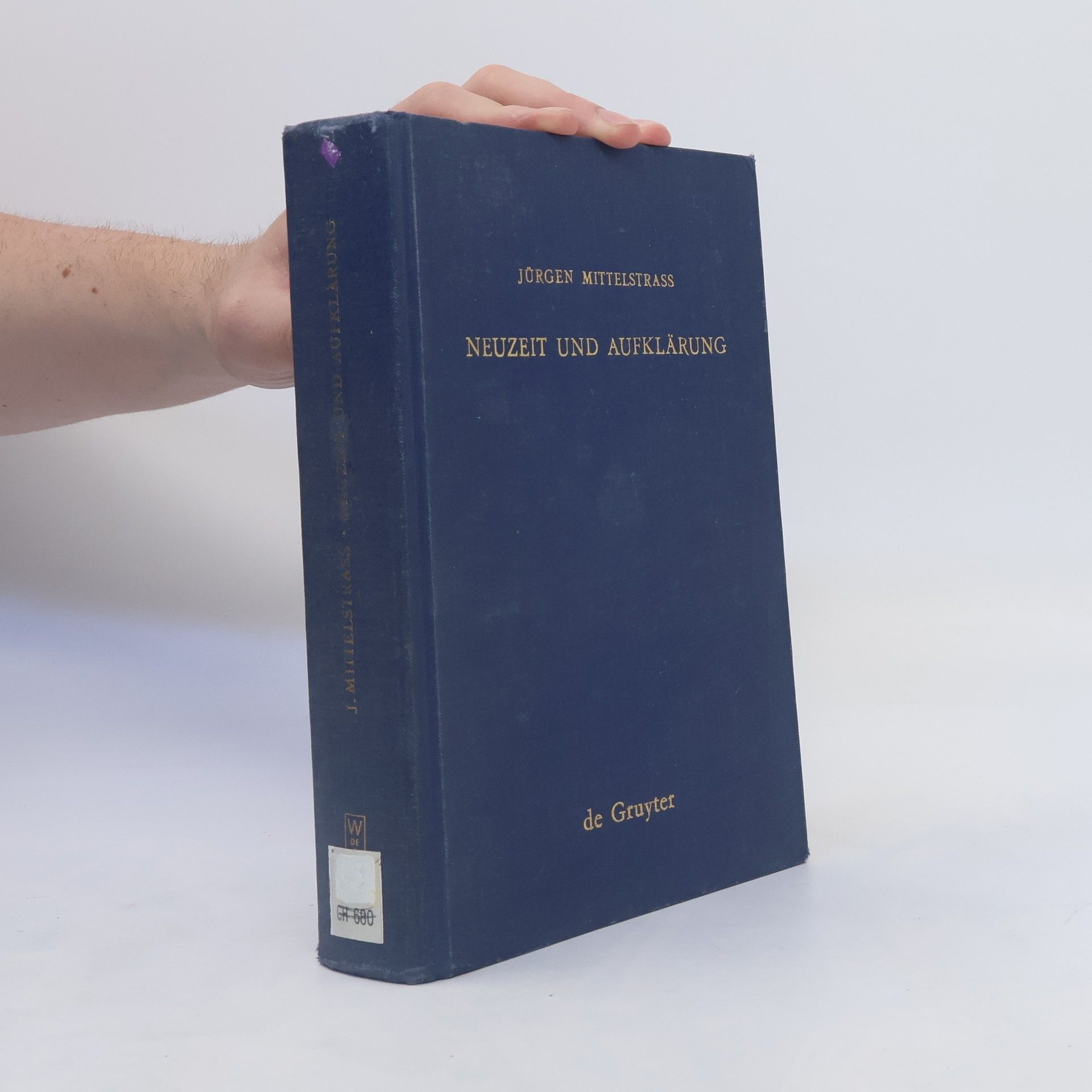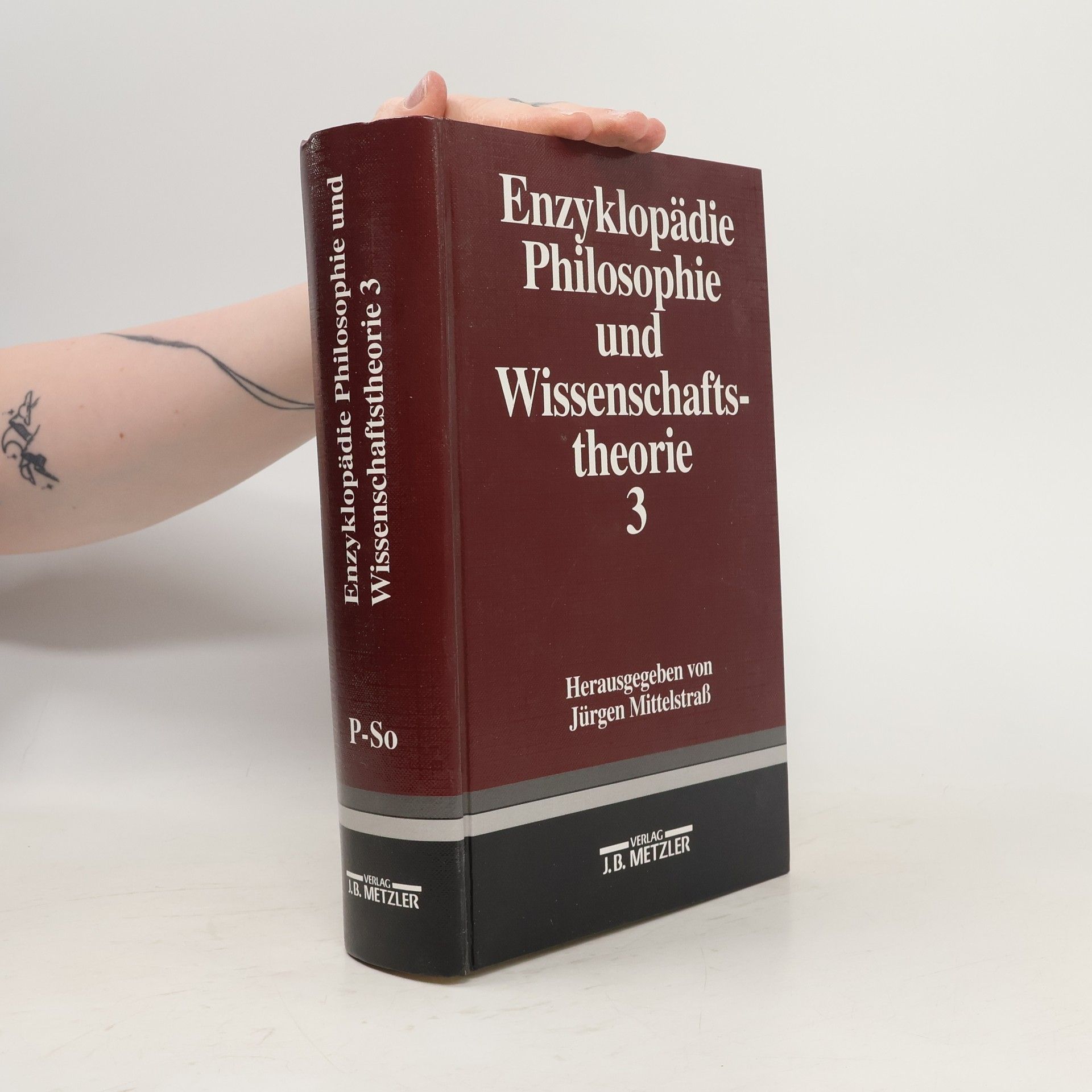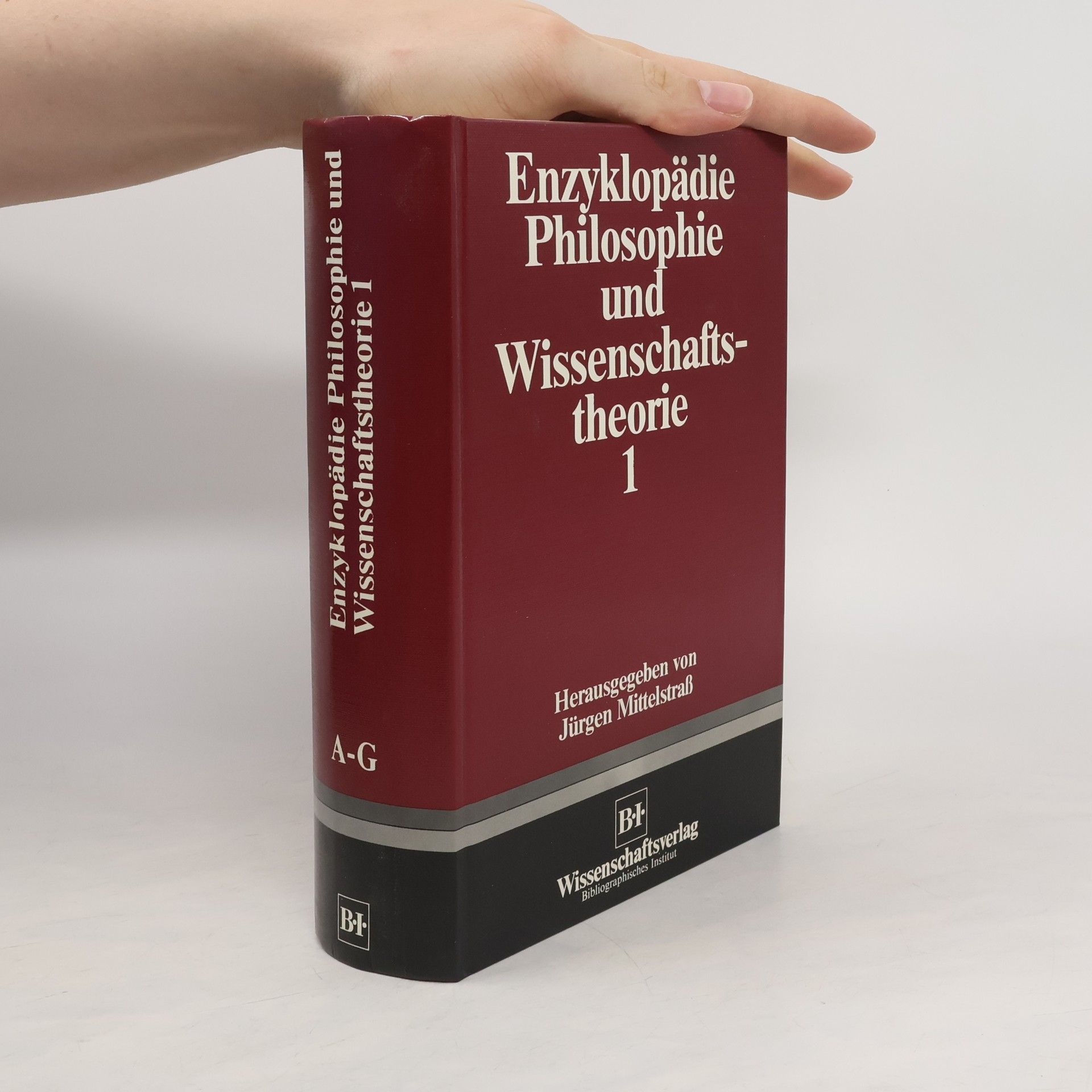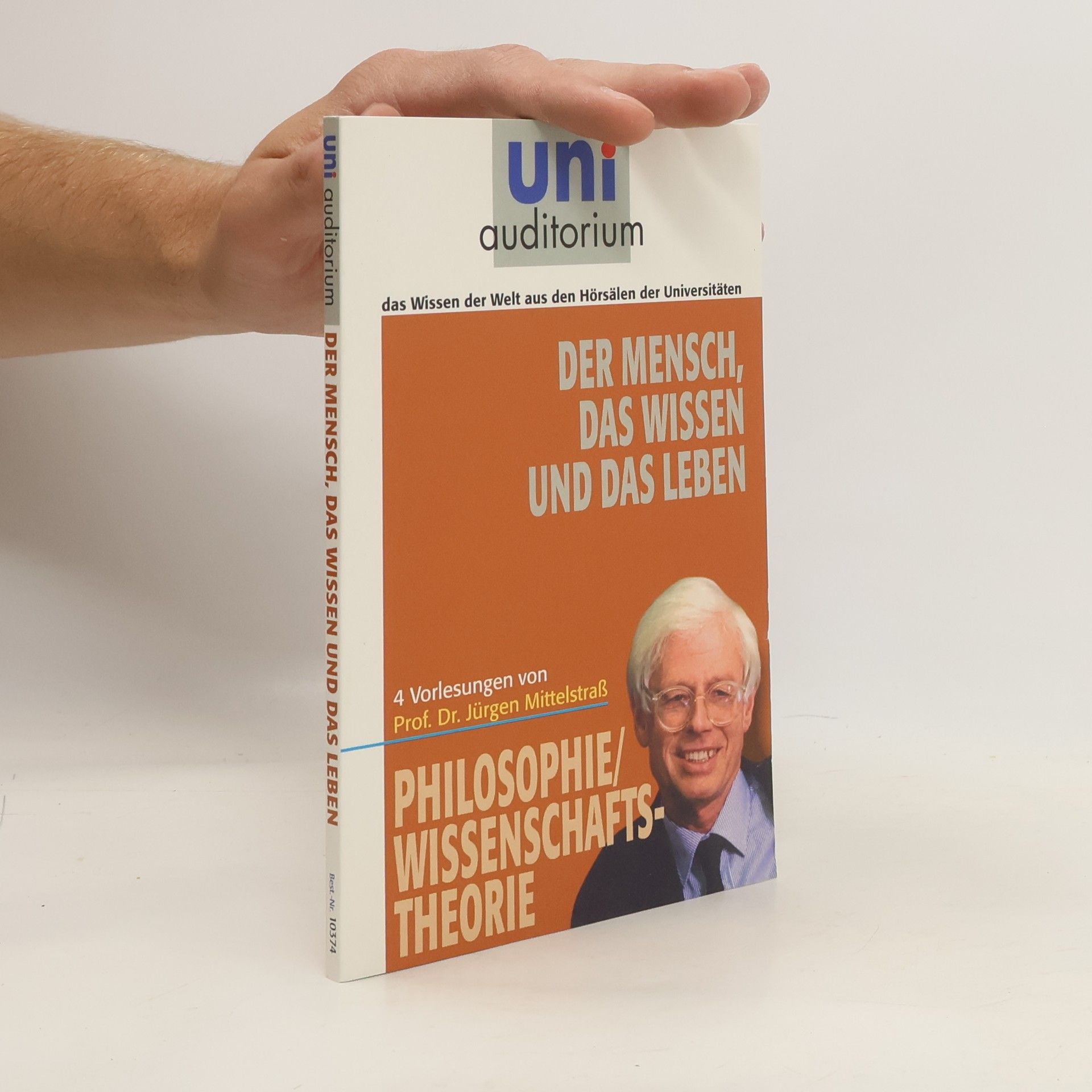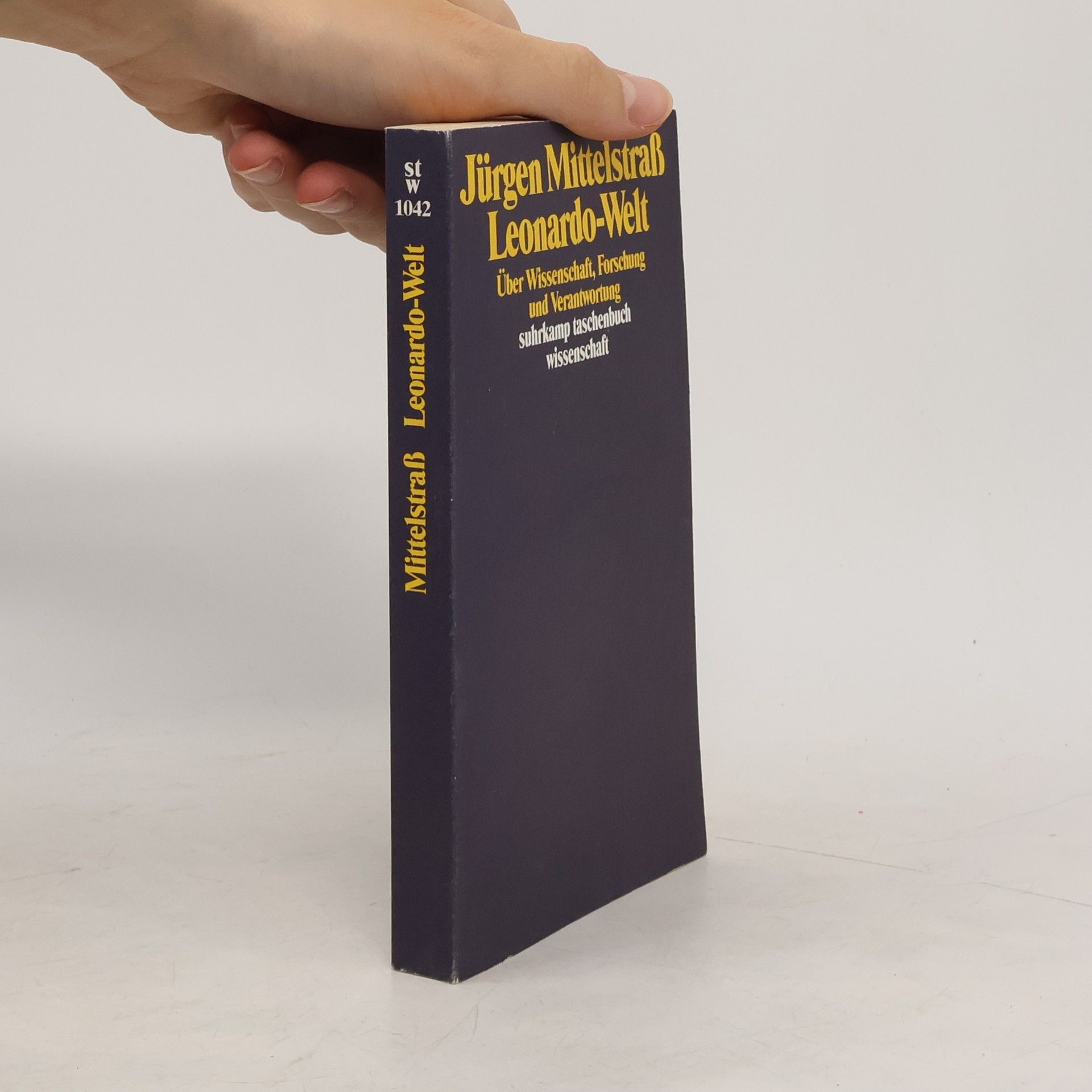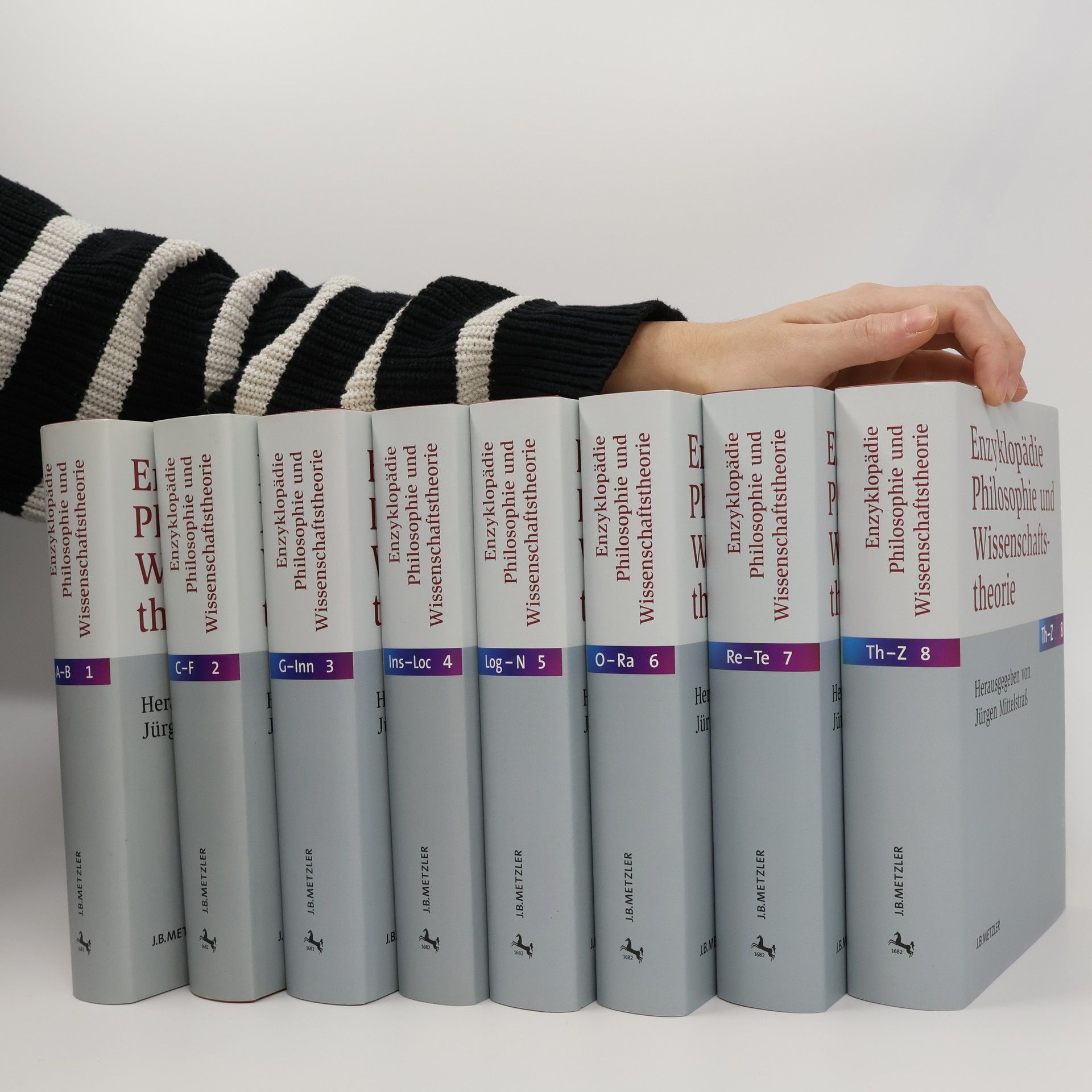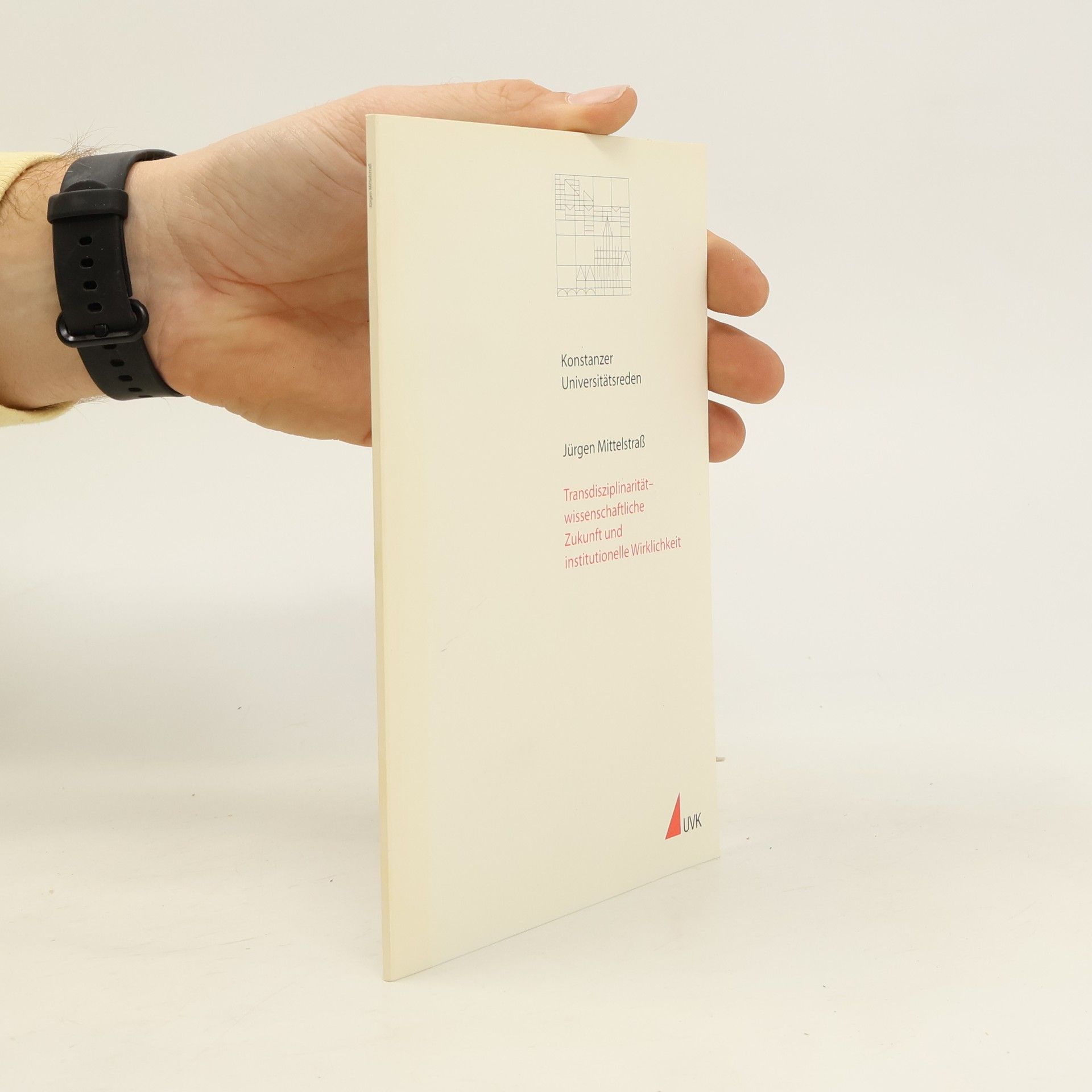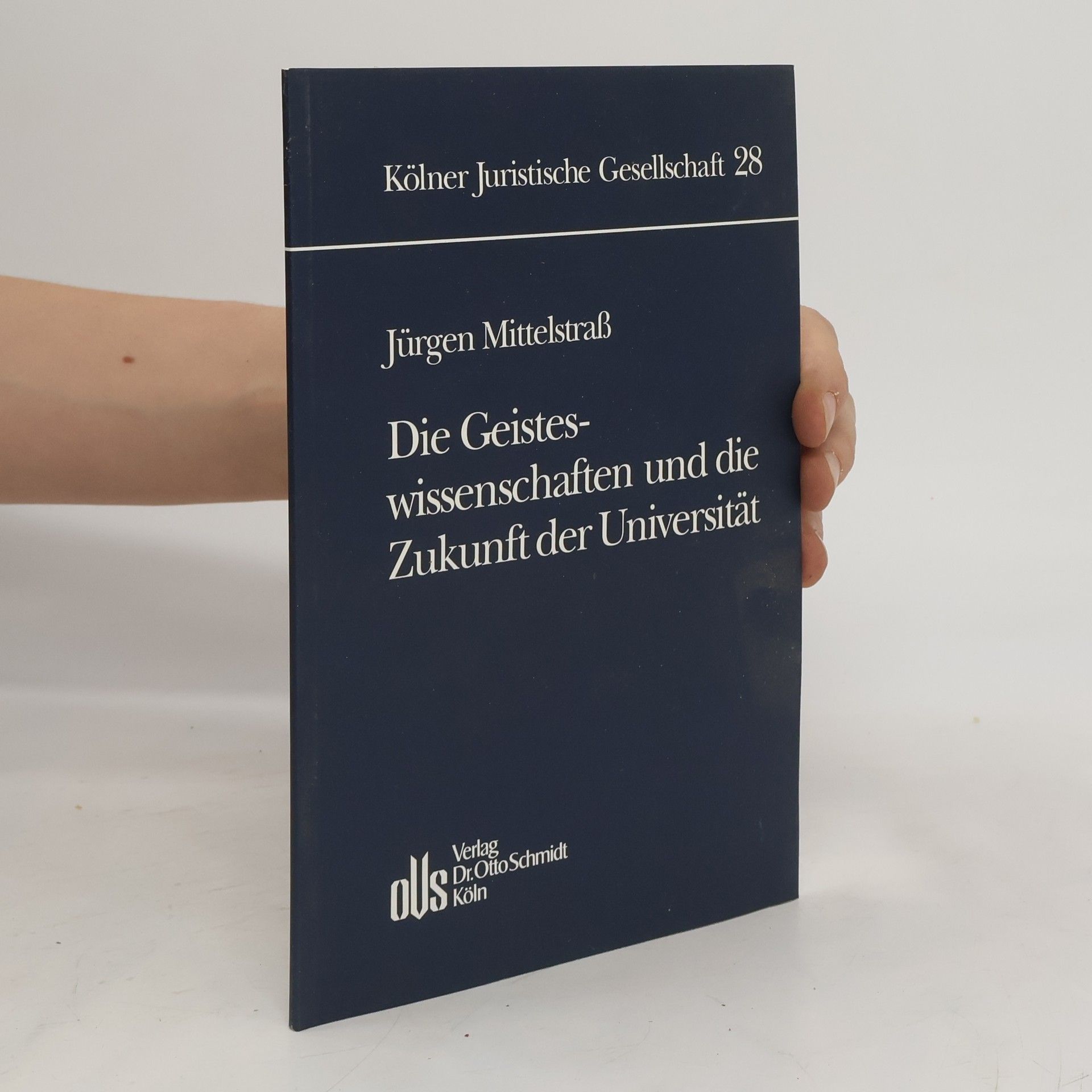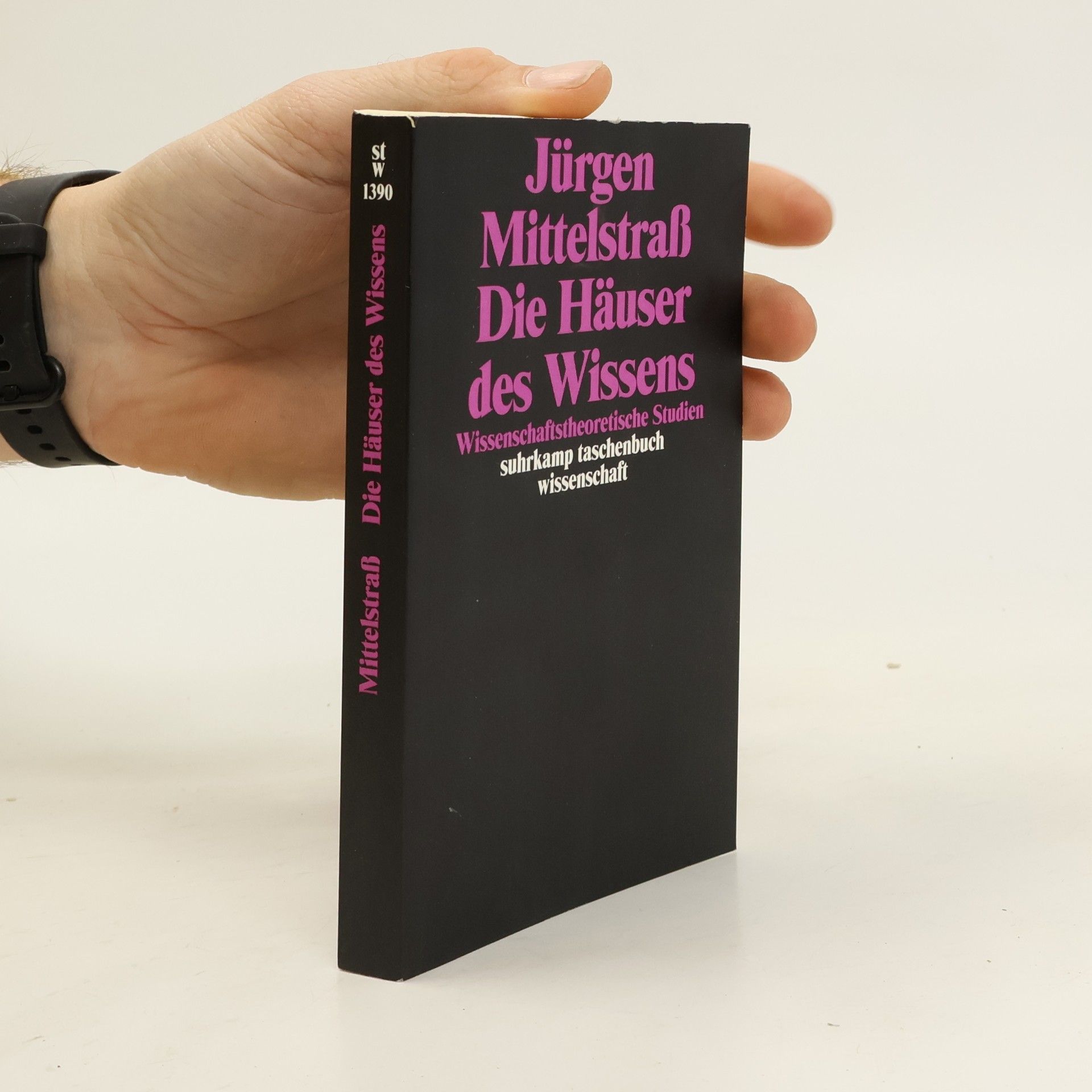Die Vorsokratiker
Eine Studie über den Anfang von Philosophie und Wissenschaft
- 150 Seiten
- 6 Lesestunden
Die Anfänge von Philosophie und Wissenschaft werden durch das vorsokratische Denken ergründet, das erstmals das Wissen in seiner begrifflichen und methodischen Form reflektiert. Jürgen Mittelstraß analysiert, wie der Übergang vom mythologischen zum rationalen Denken vollzogen wird, insbesondere durch die Beiträge von Heraklit und Parmenides. Die thalesische Geometrie spielt dabei eine zentrale Rolle, da sie die Grundlagen der Beweisidee legt und somit die Möglichkeit von Philosophie und Wissenschaft eröffnet. Mittelstraß verbindet diese Entwicklung mit einem Wandel der Denkformen und bietet tiefgehende philosophische Analysen.