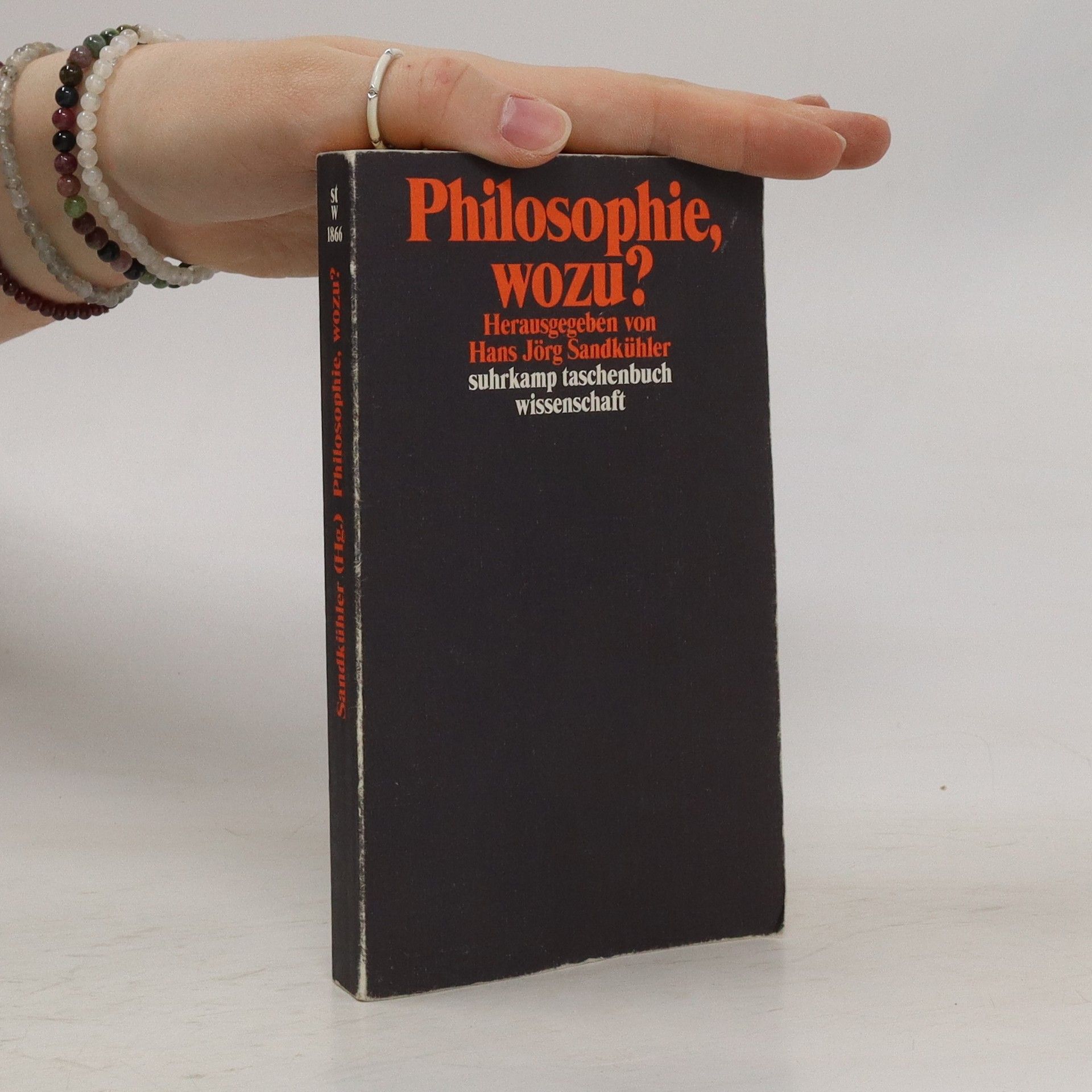Law, state, and democracy from a human rights perspective. The question has been often posed concerning the post-1945 human rights, which developed out of the experience of injustice, whether these rights are in need of an „ethical foundation“. Moral claims, which are directet against the violation of human rights, and which owing to moral intuition are held to be good and just, have further contributed to their emergence. Yet „the“ legitimate and universally valid moralty does not exist in a pluralistic society, beyond perhaps the general form of legal equality. Thus, the positively conceived human rights have come to have their meaning as a universally binding commitment grounded in the protection of human dignity. Their legal validity is grounded in what has been negotiated in the Covenants on Human Rights, as well as in the universal principle of ius cogens, which is considered „compelling law“ in all states. Moral claims are politically transformed in the sphere of neutrally-bound states into positive law, to the extent that they are generalizable. The „charging“ of constitutional law with specific ethical opinions or philosophical speculations along the lines of natural law must be avoided in constitutional democracy.
Hans Jörg Sandkühler Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)

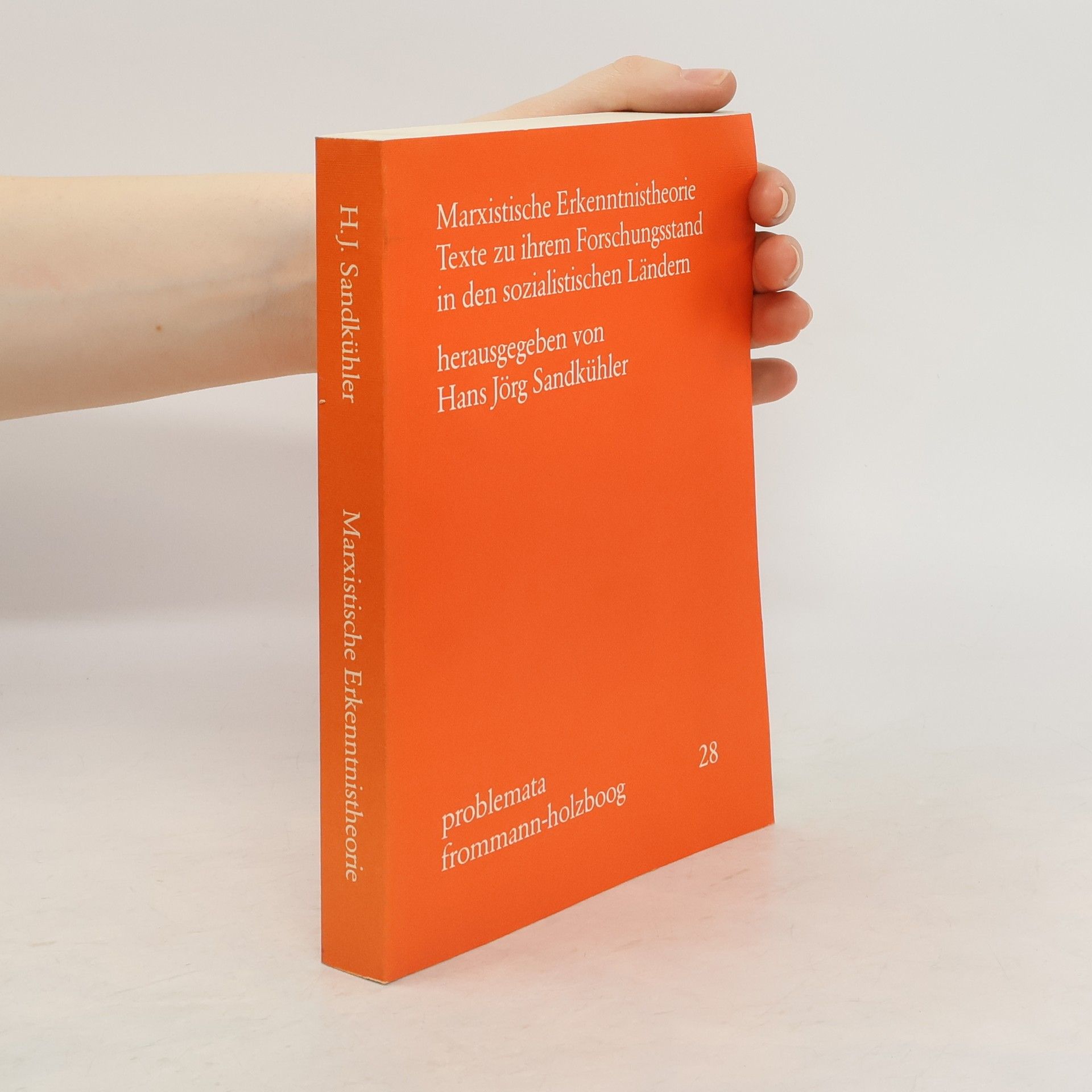
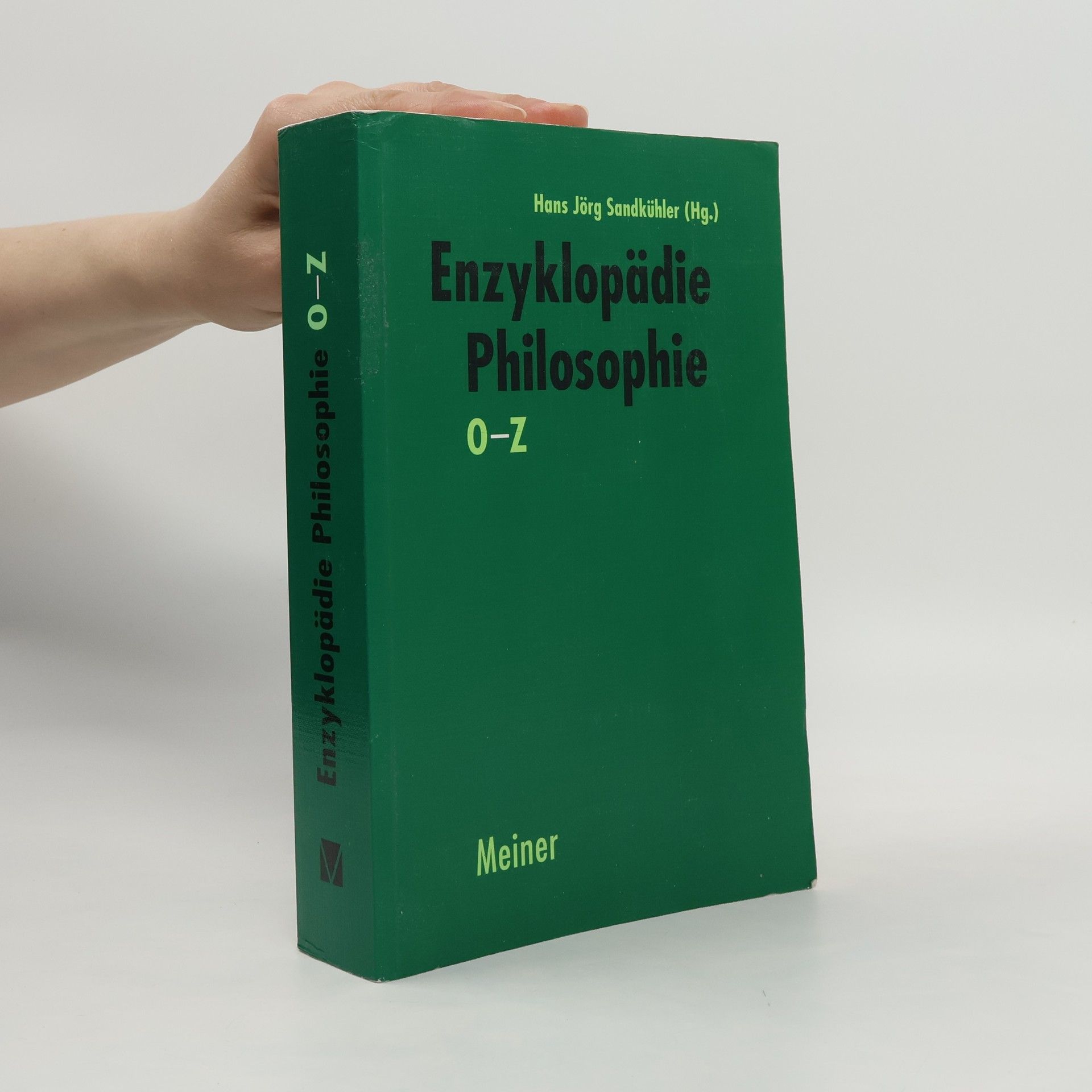
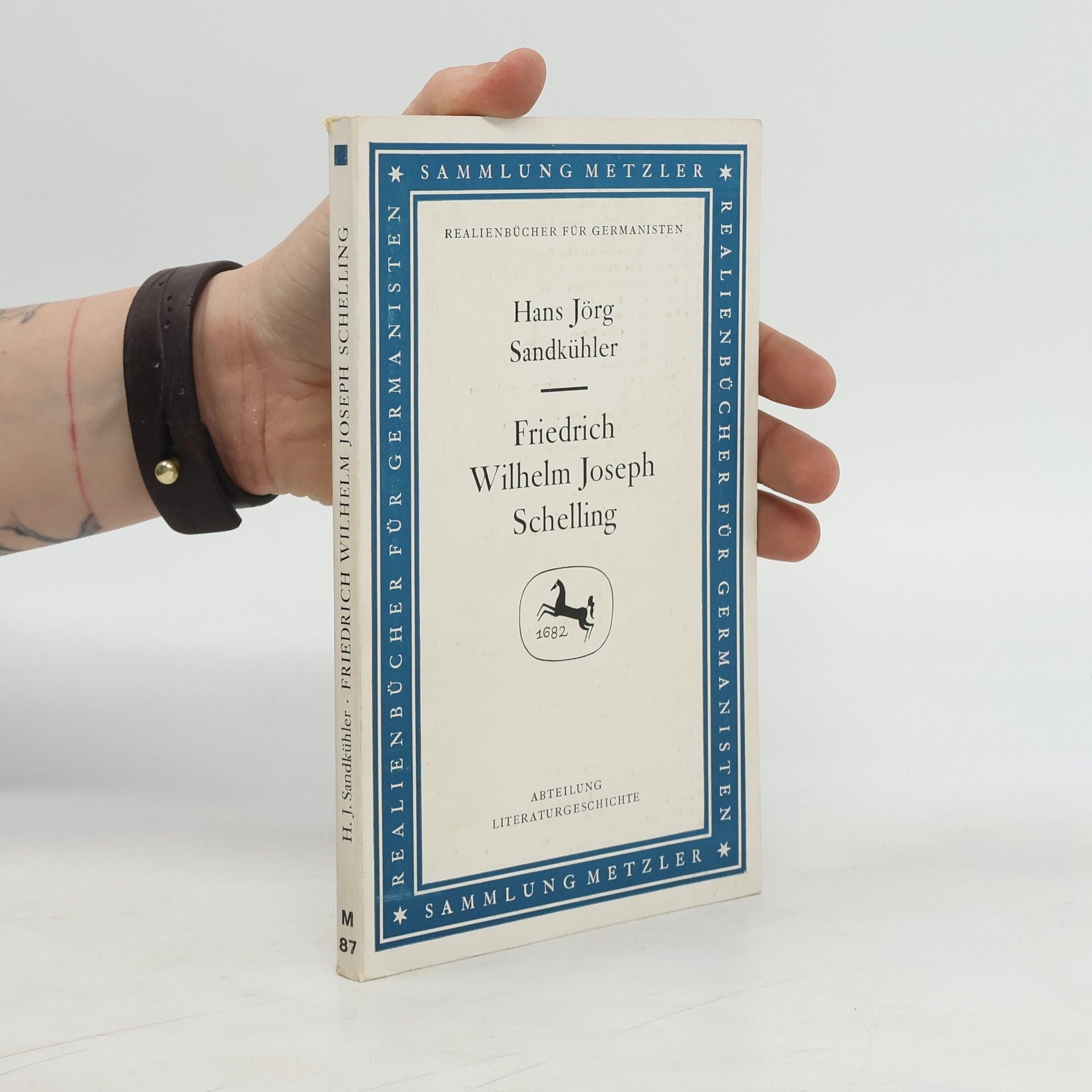
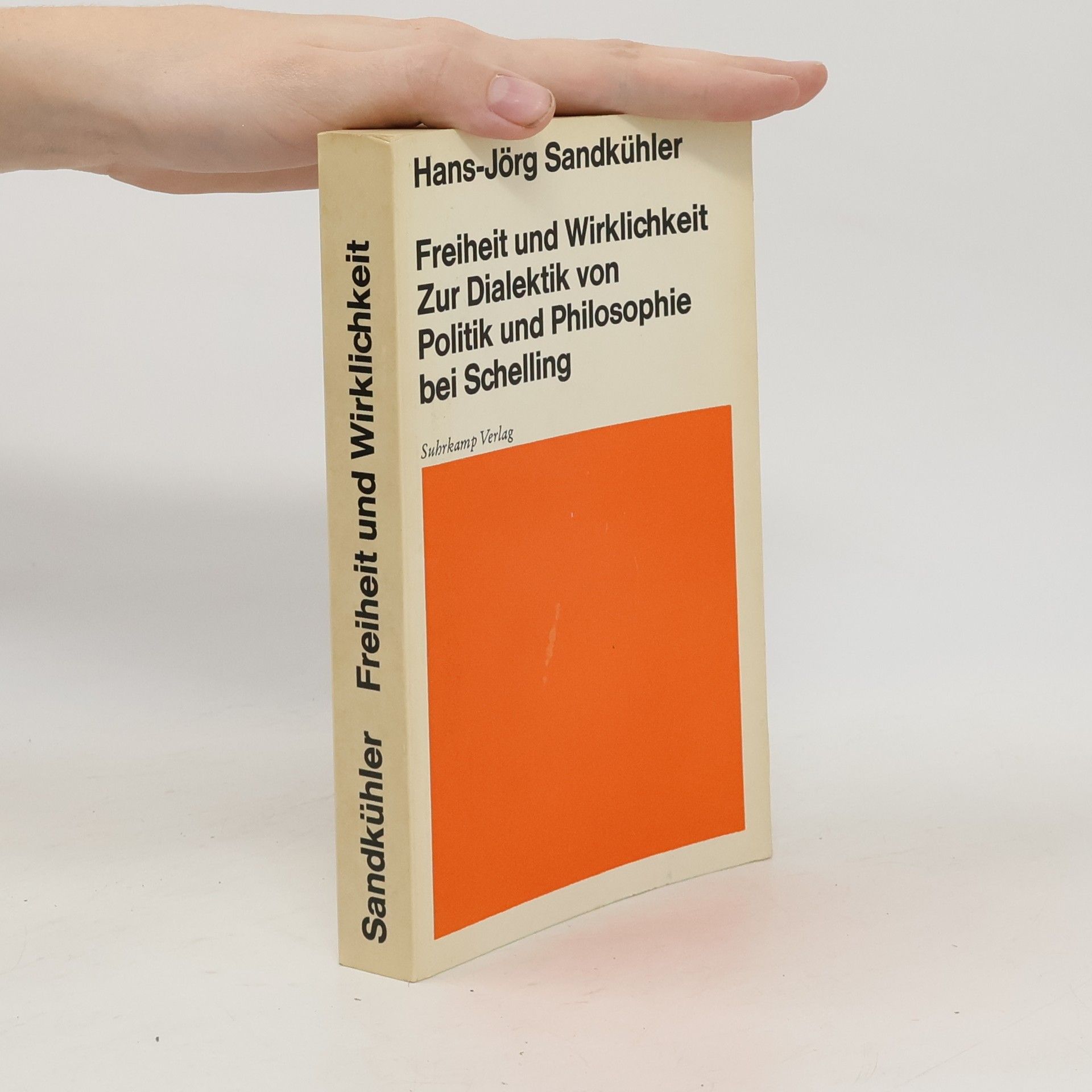
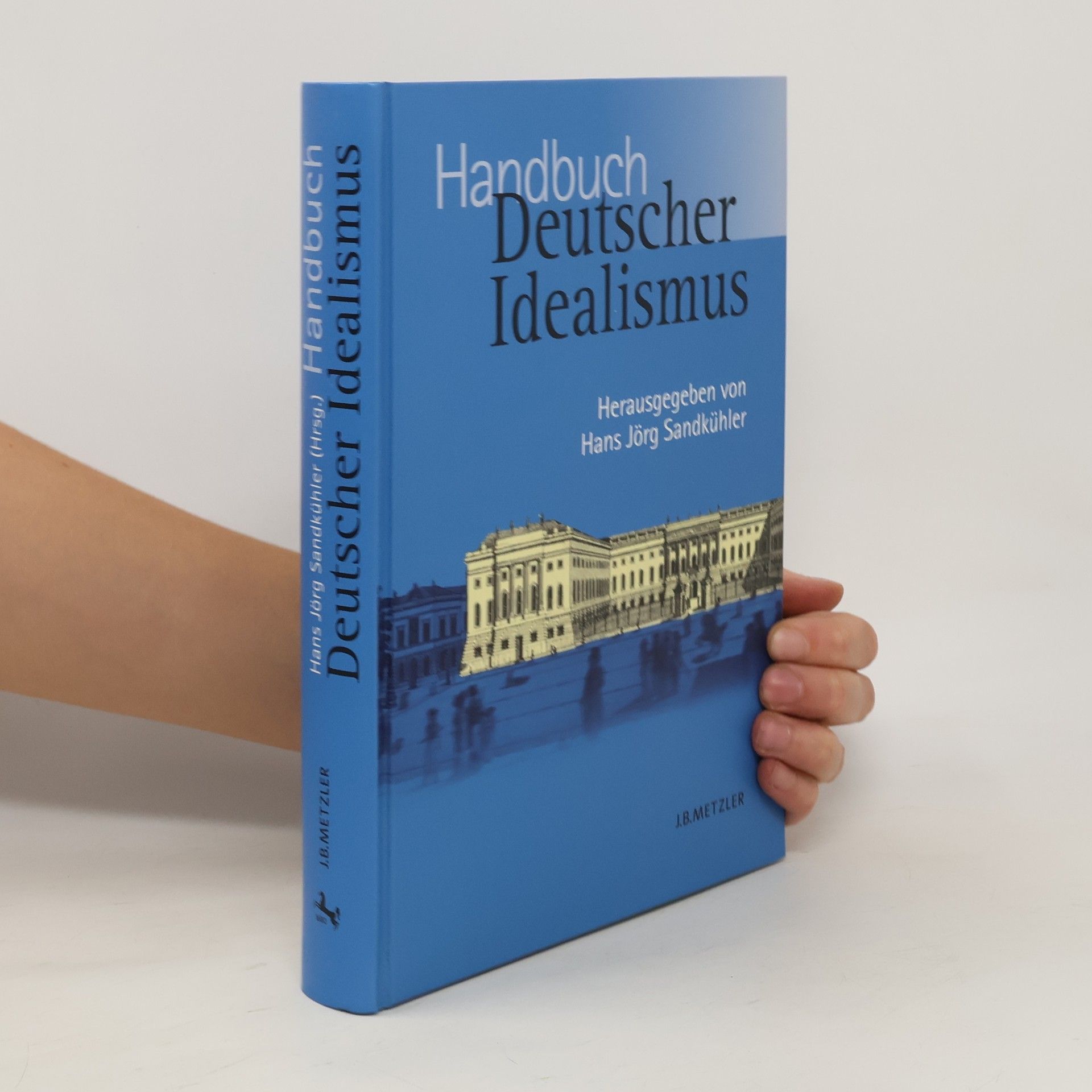
Menschenwürde und Menschenrechte
Über die Verletzbarkeit und den Schutz der Menschen
Nach dem Unrecht
Plädoyer für einen Rechtspositivismus
Nach 1945 stehen Gesellschaften, die Diktaturen überwunden haben, vor der Herausforderung, wie sie mit Verbrechen staatlichen Terrors umgehen. In der modernen Rechtskultur scheint es eine klare Antwort zu geben: nulla poena sine lege. Doch aus Gründen der Gerechtigkeit müssen Grenzen des Rückwirkungsverbots, insbesondere bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gezogen werden. Die wegweisende These, dass Gerechtigkeit angesichts 'gesetzlichen Unrechts' nach 'übergesetzlichen' Normen verlangt, geht auf G. Radbruch zurück. Er argumentierte, dass der Rechtspositivismus, durch die Trennung von Moral und Recht, die Justiz im 'Dritten Reich' wehrlos gemacht habe. Obwohl das 'Recht' im NS-Regime auf einem offen erklärten Antipositivismus basierte, wurde die Positivismuslegende zum Gründungsmythos der westdeutschen Republik. Der Weg schien nur zurück zum Naturrecht zu führen, oft gegen den als antisemitisch denunzierten Rechtspositivismus. Dieses Werk behandelt historische, politische und juristische Entwicklungen seit den Nürnberger Prozessen und die Geschichte des Rechtspositivismus. Es wird ein Rechtspositivismus gefordert, der Elemente der Reinen Rechtslehre Hans Kelsens sowie von Radbruchs Positivismuskritik integriert, jedoch auch Distanz zu beiden Theorien wahrt: Recht und Gesetz erfordern keinen blinden Gehorsam, und gerechte Normen gründen in den Menschenrechten, die die Menschenwürde konkretisieren.
Recht und Staat nach menschlichem Maß
Einführung in die Rechts- und Staatstheorie in menschenrechtlicher Perspektive
Menschenrechte in die Zukunft denken
- 181 Seiten
- 7 Lesestunden
Es gibt einen guten Grund, Menschenrechte in die Zukunft zu denken. So, wie sie nicht vom Himmel gefallen sind, sondern erkämpft werden mussten und sich unter sozialen, politischen, ökonomischen und kulturellen Bedingungen entwickelt haben, so sind sie nichts Fertiges, Abgeschlossenes, sondern eine permanente Aufgabe. Es gibt die verbreitete Klage, die Menschenrechte seien allgemein, vage, sie taugten in der Theorie, de facto aber nicht in der Praxis; dem sich verbreitenden Misstrauen gegenüber dem Recht entspricht, dass viele Menschen nicht wissen, welche Rechte sie haben. Das internationale Recht der Menschenrechte ist, wie das Recht überhaupt, ein dynamisches System in einer sich verändernden Welt. Neuartige Probleme und Fragen verlangen nach neuen Antworten. Sind die Menschenrechte universell, unter welchen Bedingungen sind sie universalisierbar? Bestimmen kulturelle Bruchlinien die Zukunft der Menschenrechte? Gibt es eine Drittwirkung von Menschenrechten, so dass der Adressat von Norm und Sanktion nicht nur der Staat, sondern auch Menschenrechte verletzende Individuen sind? In wie weit sind Menschenrechte heute zwingendes Recht in der Weltgesellschaft? Sind die Menschenrechte auf ein bestimmtes Menschenbild festgelegt? Wie wird das Recht auf humanitäre Intervention genau begründet? Worin bestehen die Herausforderungen für den internationalen Menschenrechtsschutz im 21. Jahrhundert?
Philosophie im Nationalsozialismus
- 344 Seiten
- 13 Lesestunden
Die Beiträge in diesem Buch zu Universität, Wissenschaft und Philosophie im Nationalsozialismus, zum Untergang des Neukantianismus im ›Dritten Reich‹ und zu Oskar Becker, Martin Heidegger, Erich Rothacker, Joachim Ritter und Karl Schlechta einerseits und andererseits zu Hannah Arendt und Karl Jaspers sowie zum Wiener Kreis – sie stehen für Alternativen, die es gegenüber dem Nationalsozialismus gegeben hat – zeigen, dass das wechselseitige Bestätigungsverhältnis der symbolischen Traditionen, gemeinsamen Praktiken und Einstellungen nicht schicksalhaft zu Uniformität geführt hat. Zu unterscheiden und sich zu unterscheiden, war nicht unmöglich.
Kritik der Repräsentation
Einführung in die Theorie der Überzeugungen, der Wissenskulturen und des Wissens
- 280 Seiten
- 10 Lesestunden
Kritik der Repräsentation ist eine Einführung in die Theorie der Überzeugungen und der Wissenskulturen, der Erkenntnis und des Wissens. Sie warnt davor, angesichts des neurowissenschaftlichen Naturalismus zu resignieren, und plädiert für eine »kopernikanische Wende der Objektivität«. Aufklärung über Repräsentation beruht auf der Klärung dessen, was Einstellungen, Meinungen und Überzeugungen sind und ob sie als wahr gerechtfertigt werden können. Daher steht die Rolle der freien richterlichen Überzeugung im Recht ebenso zur Debatte wie die Bedeutung von Überzeugungen in naturwissenschaftlichen Experimentalkulturen. Weil Ansprüche auf die eine Wahrheit Kennzeichen totalitärer Herrschaft und Politik sind, schließt das Buch mit der Frage nach dem Zusammenhang von Wissen, Urteilsfähigkeit, Recht und Demokratie.
Philosophie, wozu?
- 376 Seiten
- 14 Lesestunden