Indem er die von der Europäischen Union beschlossene „Lissabon-Strategie“ der „Modernisierung und Verbesserung des europäischen Sozialmodells“ beim Wort nimmt, beobachtet dieser neue Beitrag zur sozialwissenschaftlichen Berichterstattung die Wechselwirkungen zwischen Ökonomie, Lebensweisen und Institutionensystem im Umbruch der deutschen Gesellschaft.
Martin Baethge Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
1. Jänner 1939 – 1. Jänner 2018

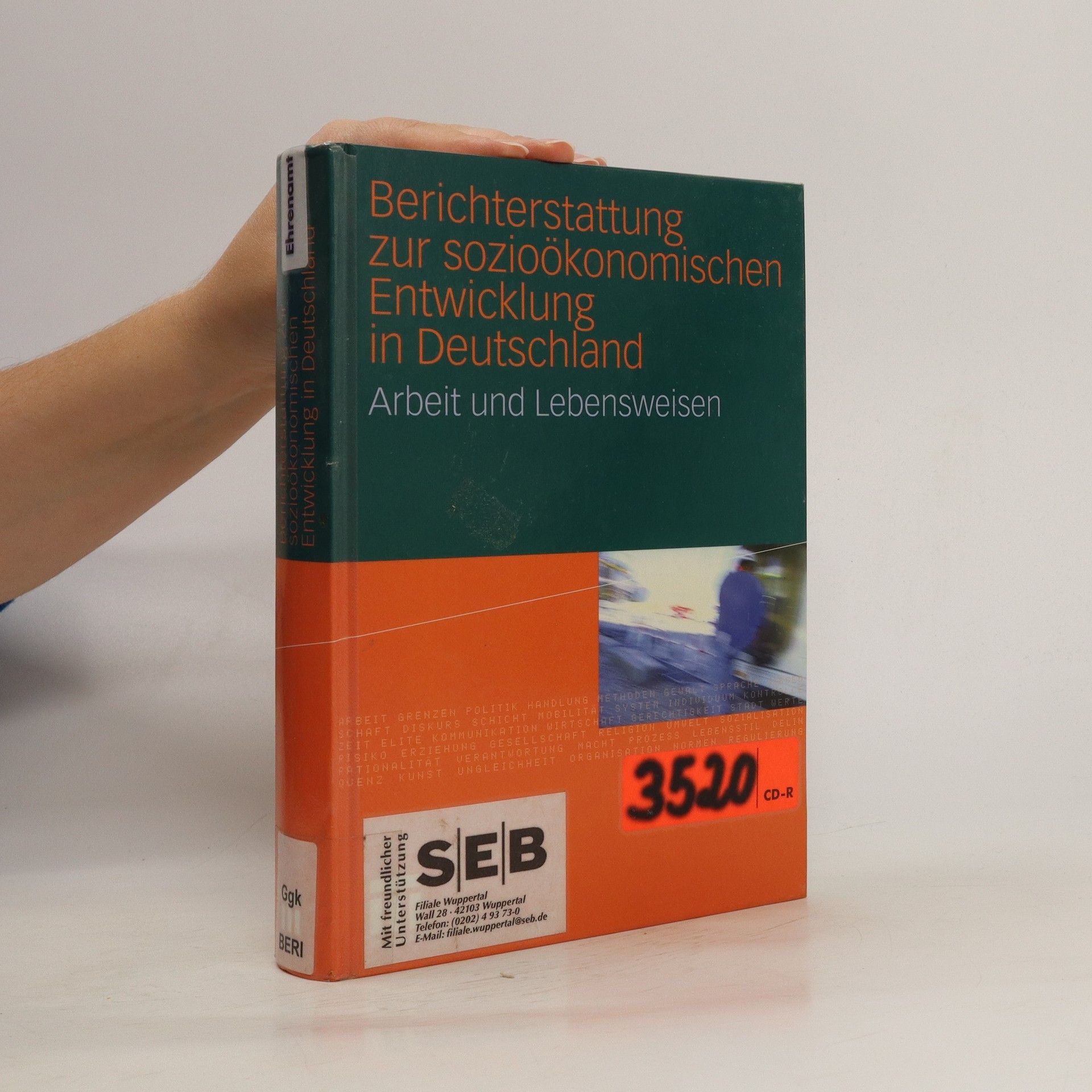
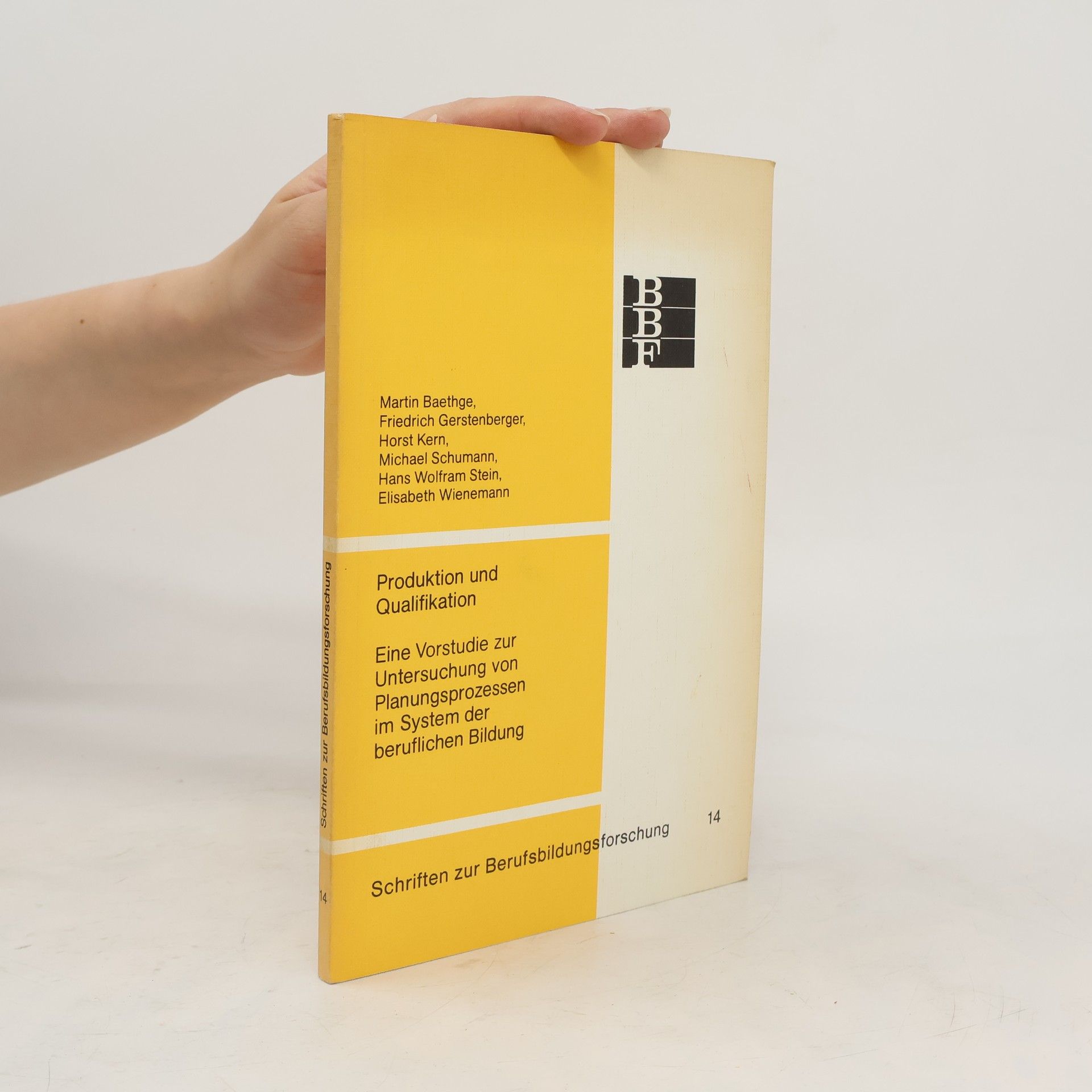
Organisation, Recht und Ökonomie des Bildungswesens
- 652 Seiten
- 23 Lesestunden