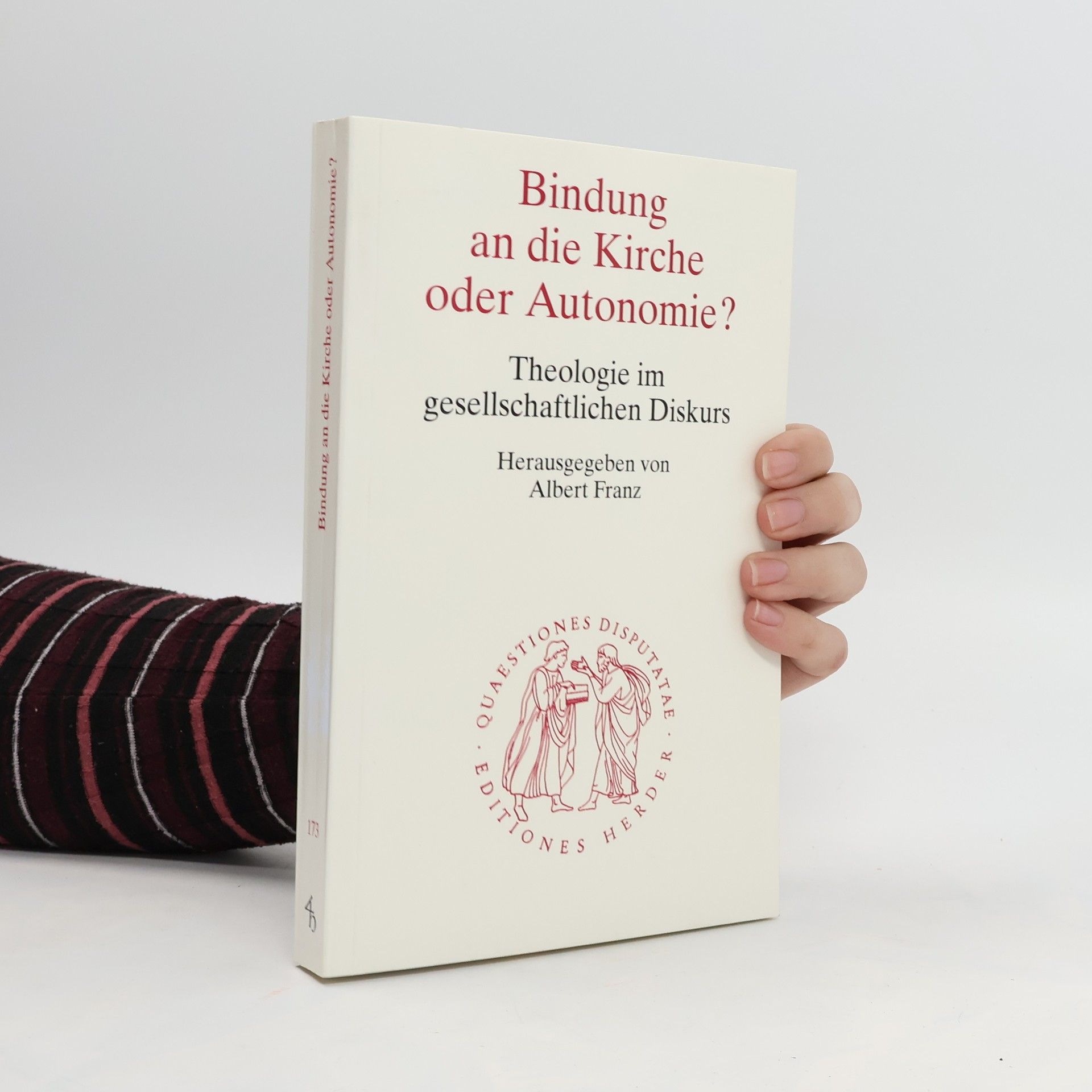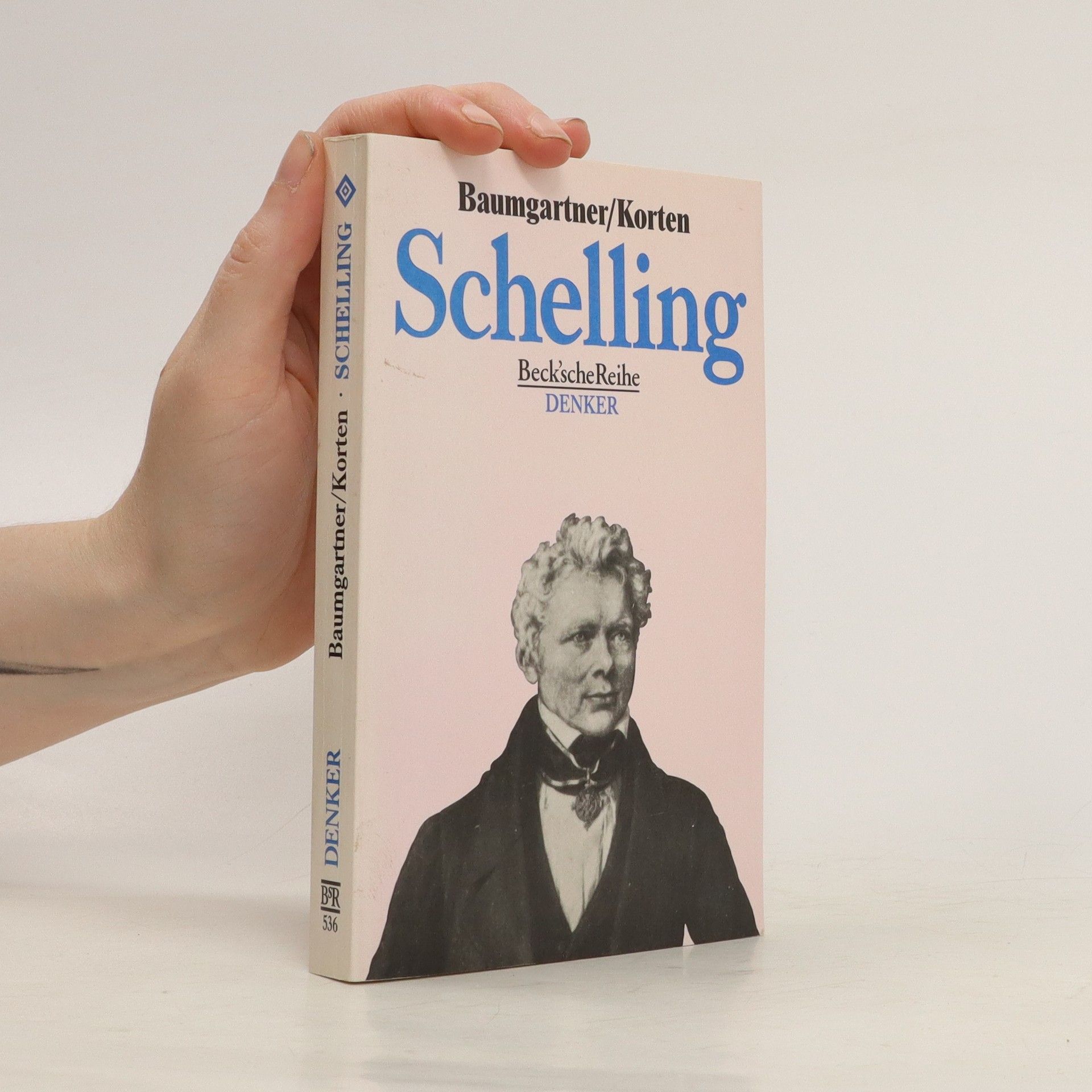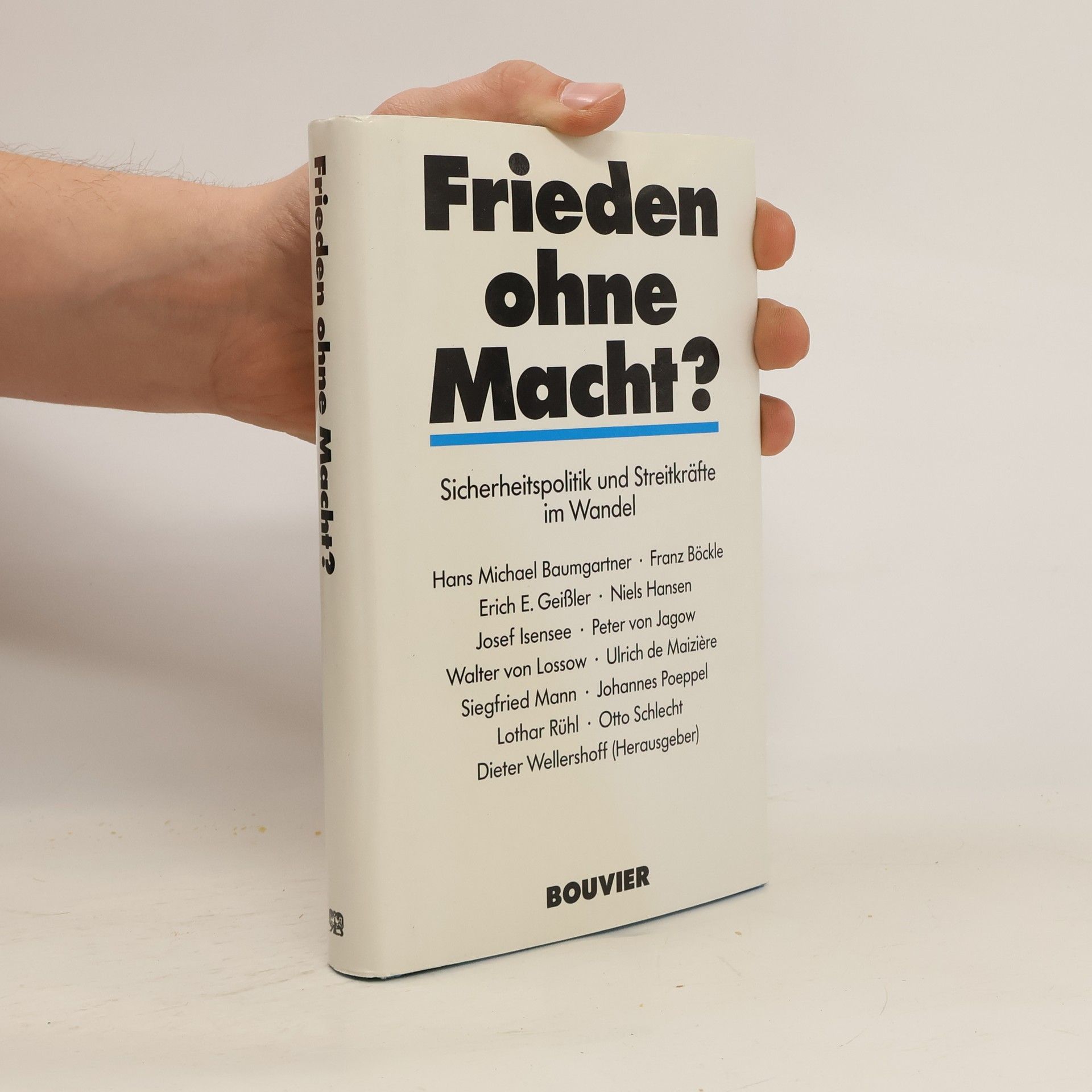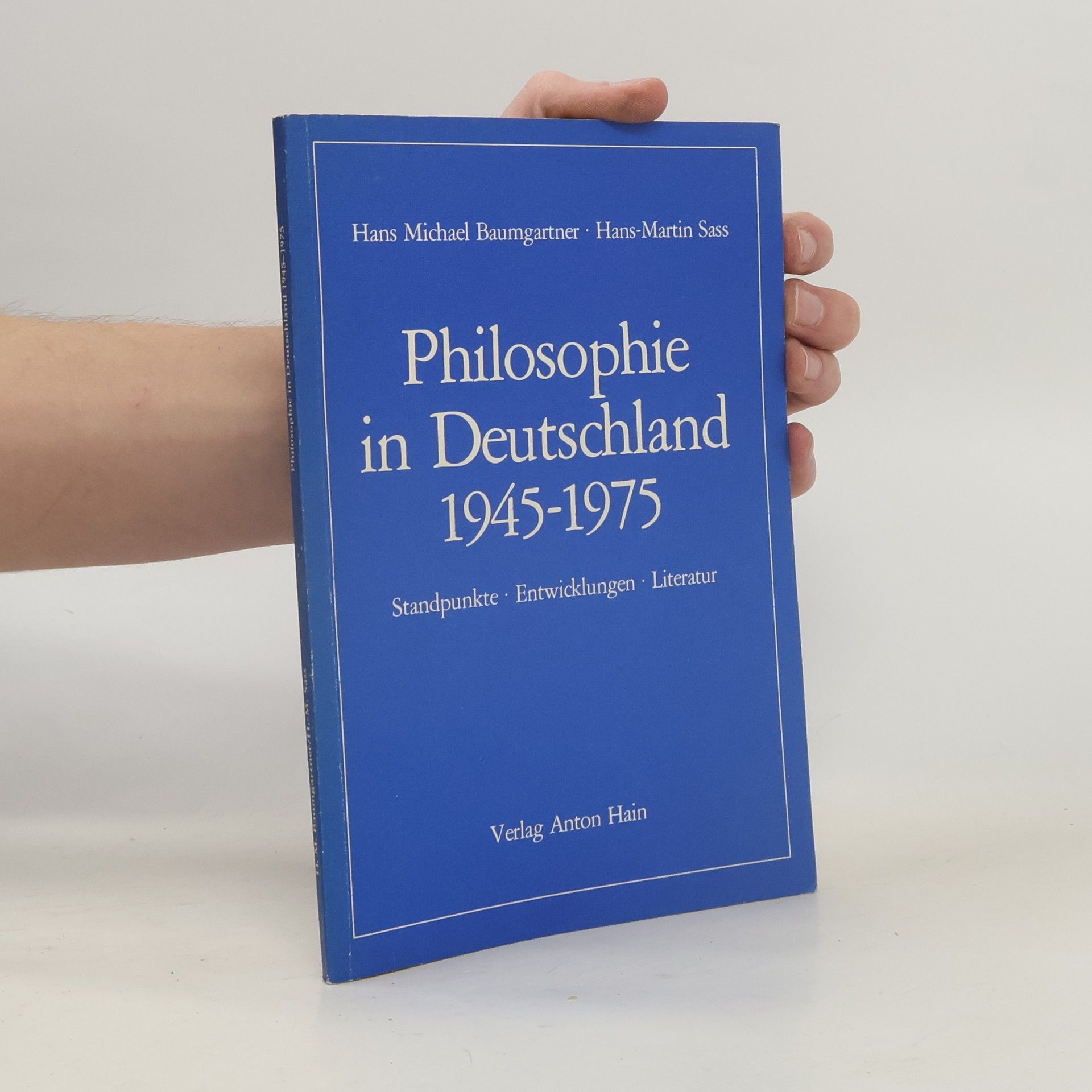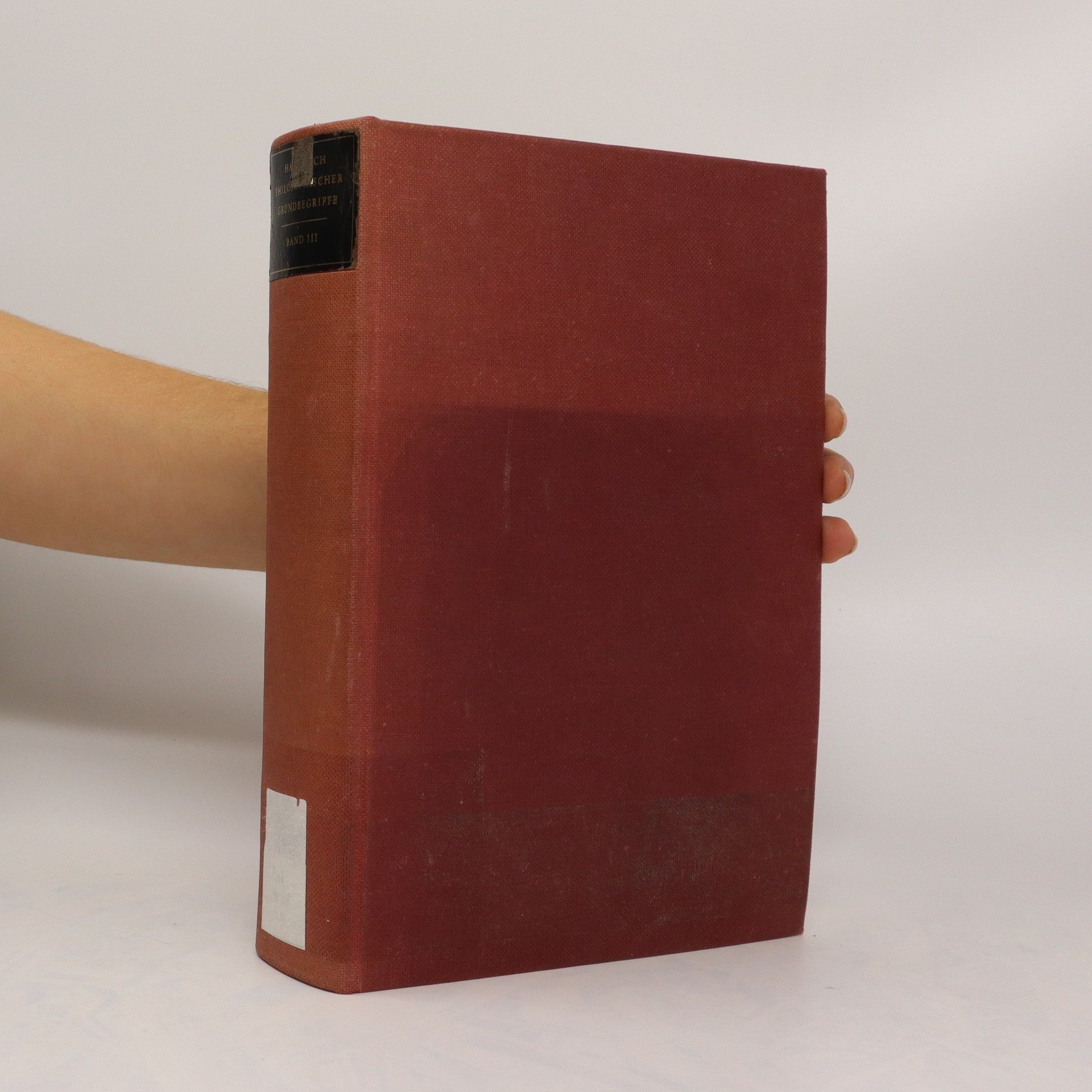Hans Michael Baumgartner Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
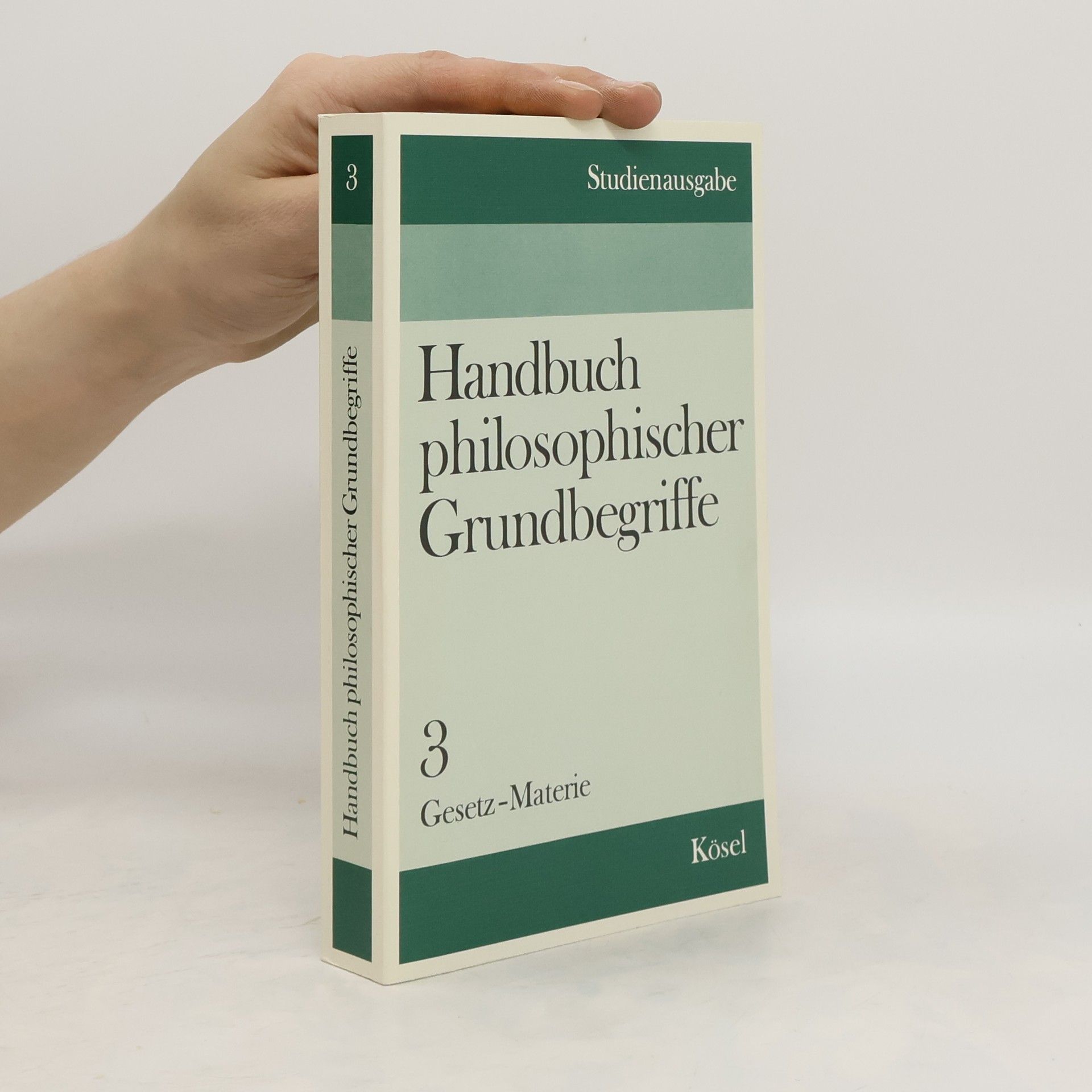
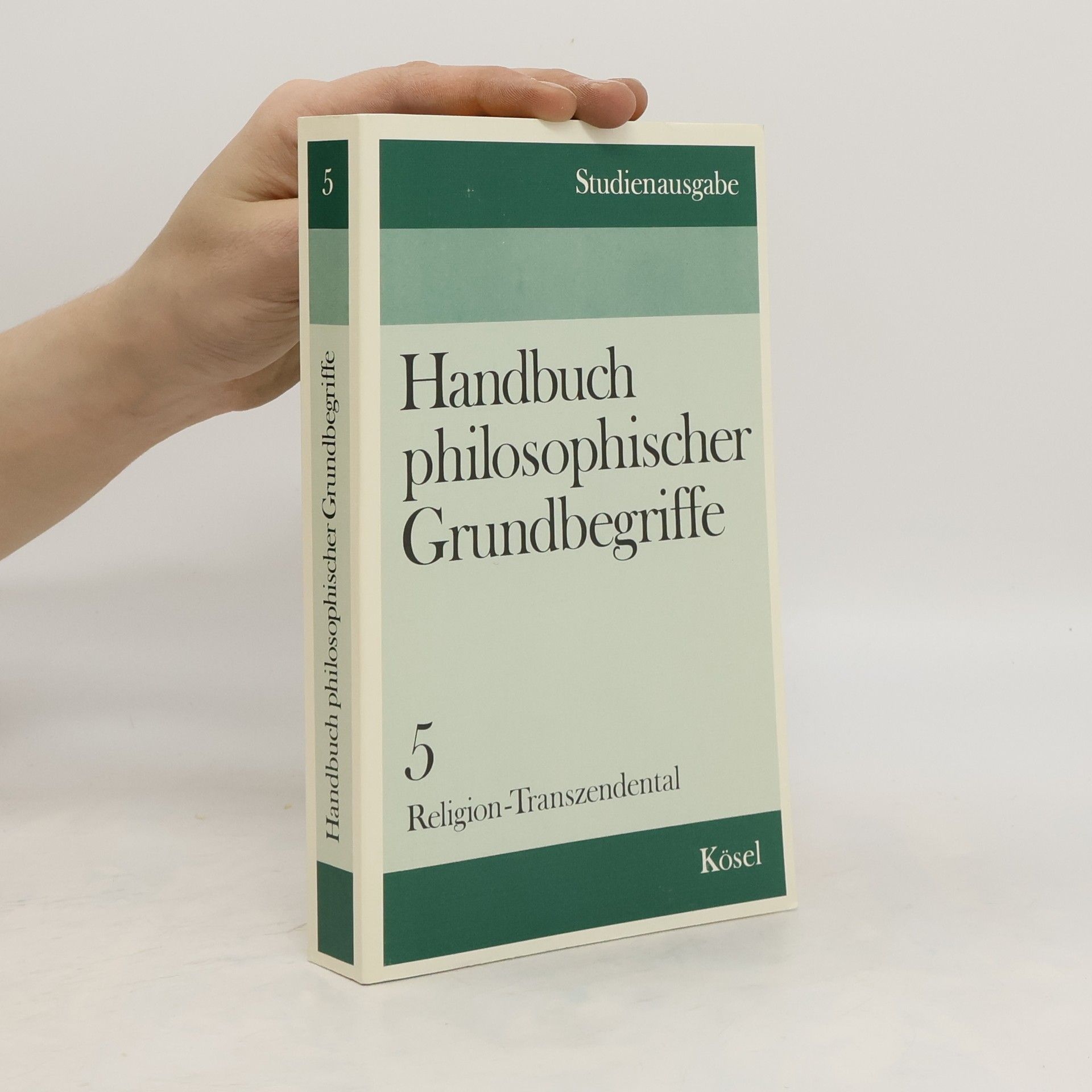
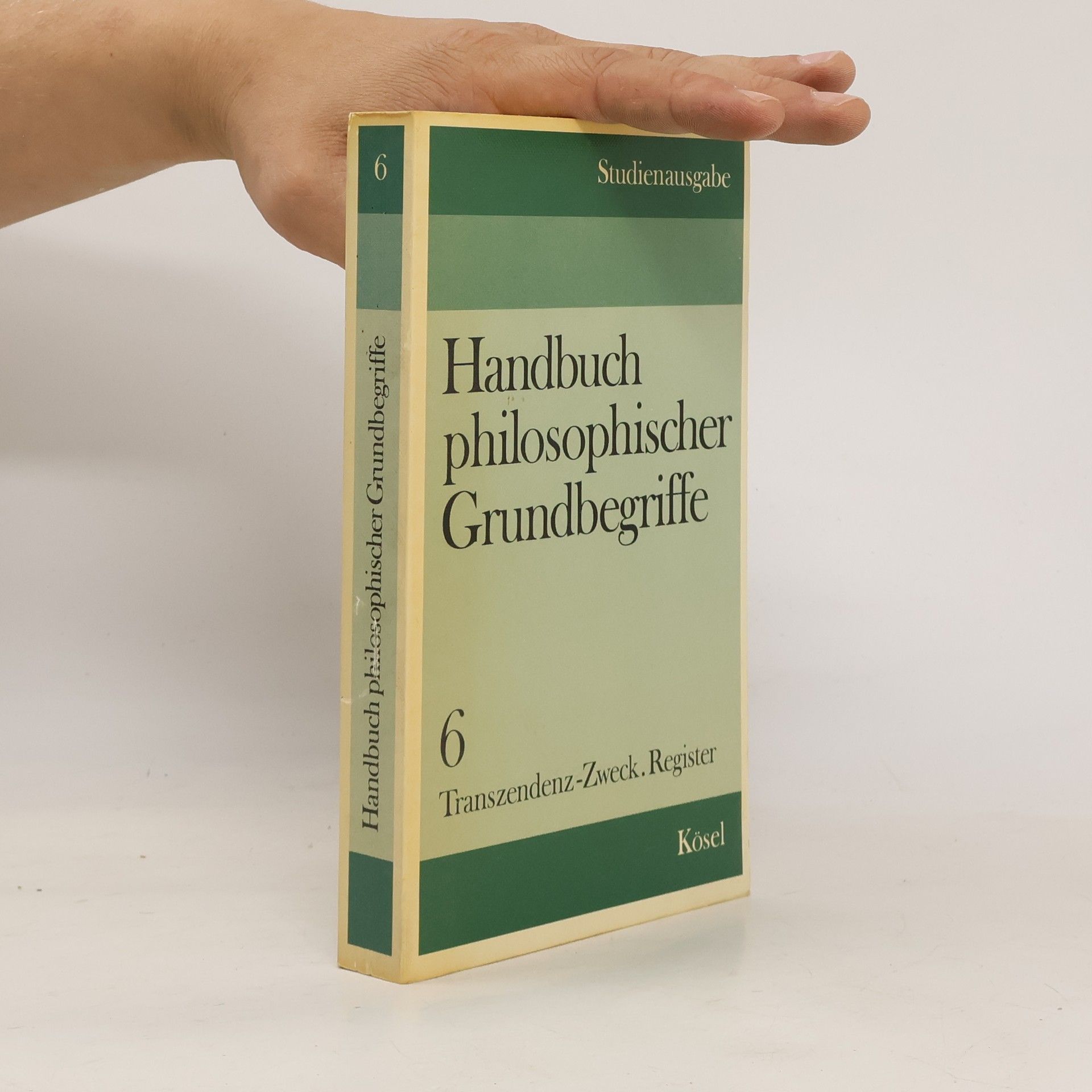
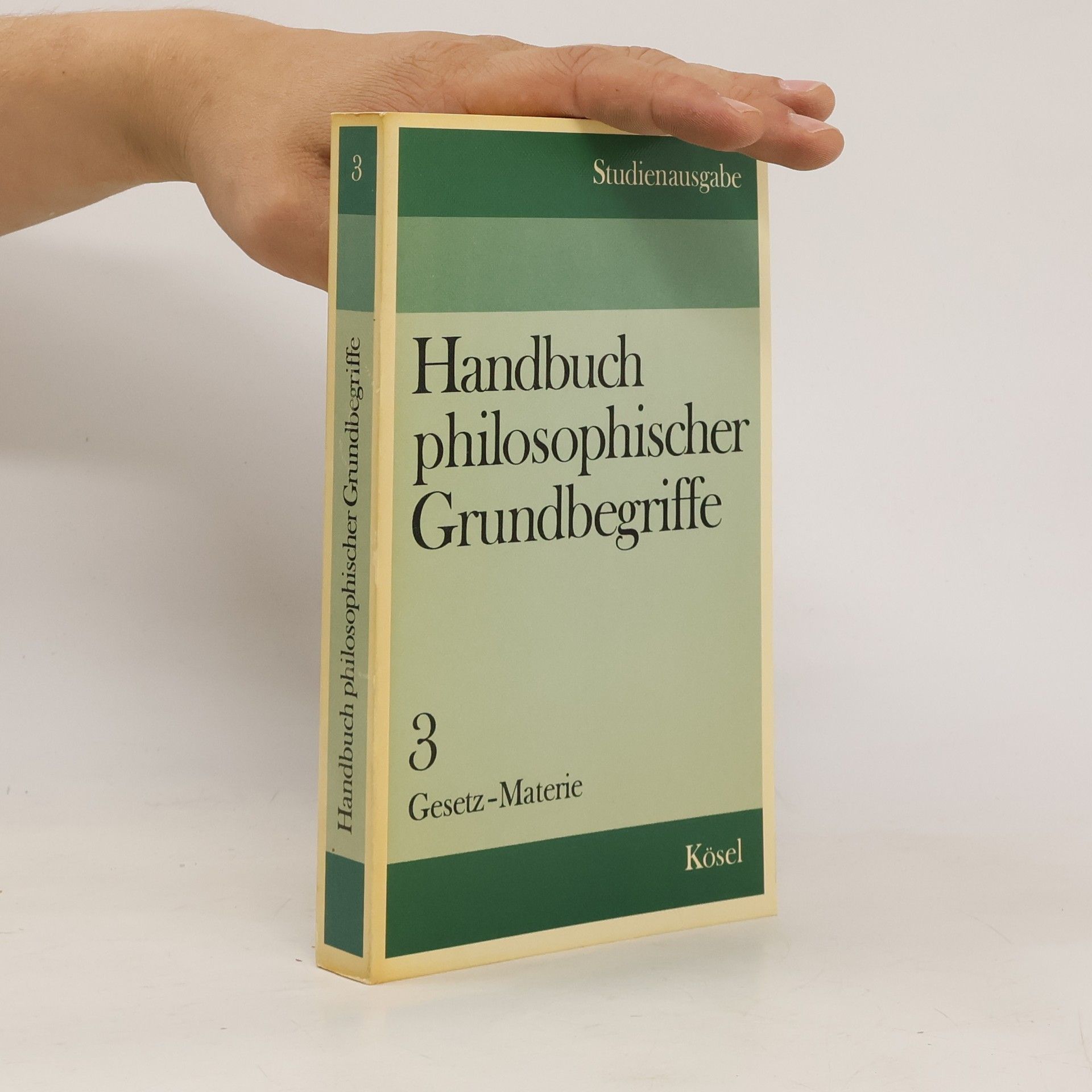
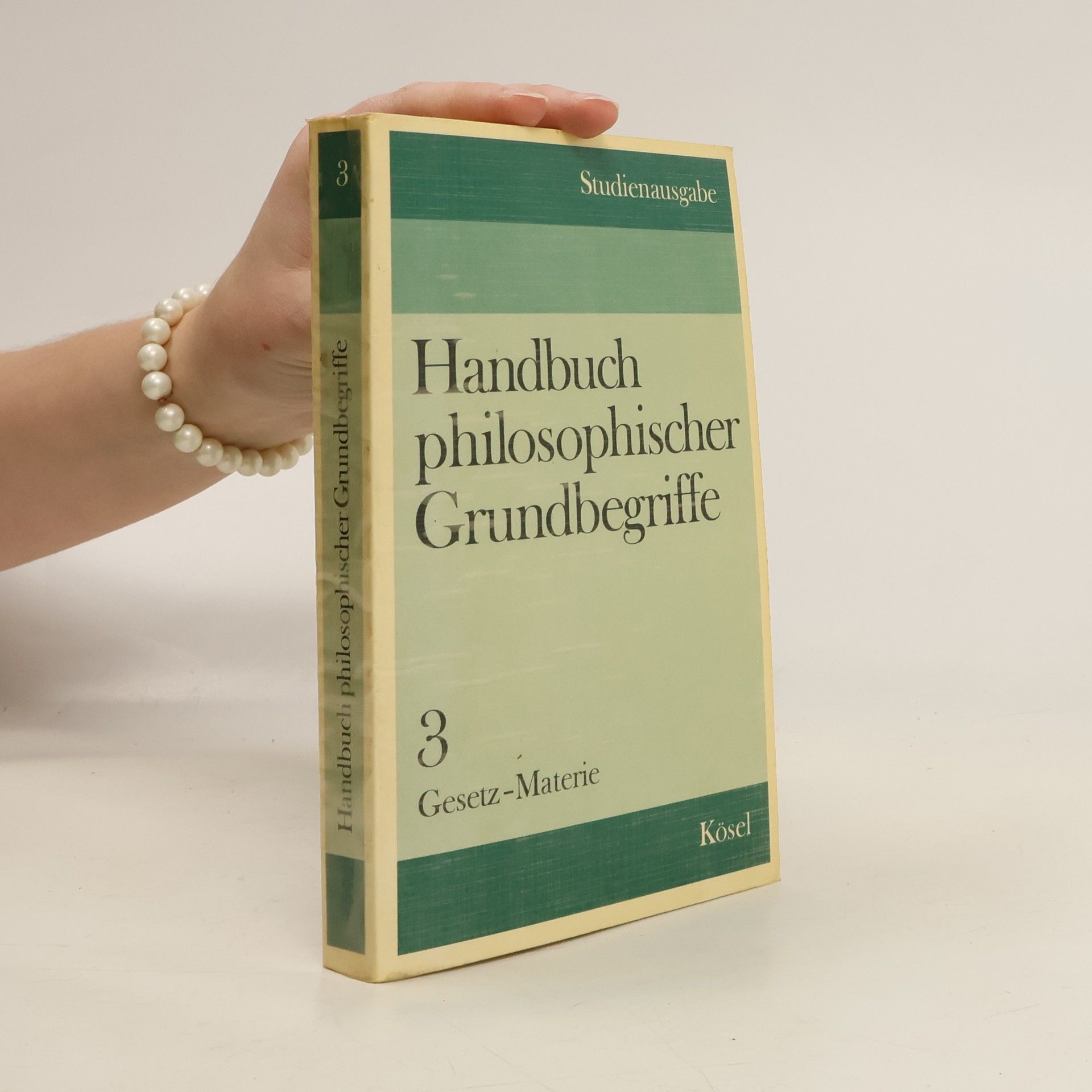
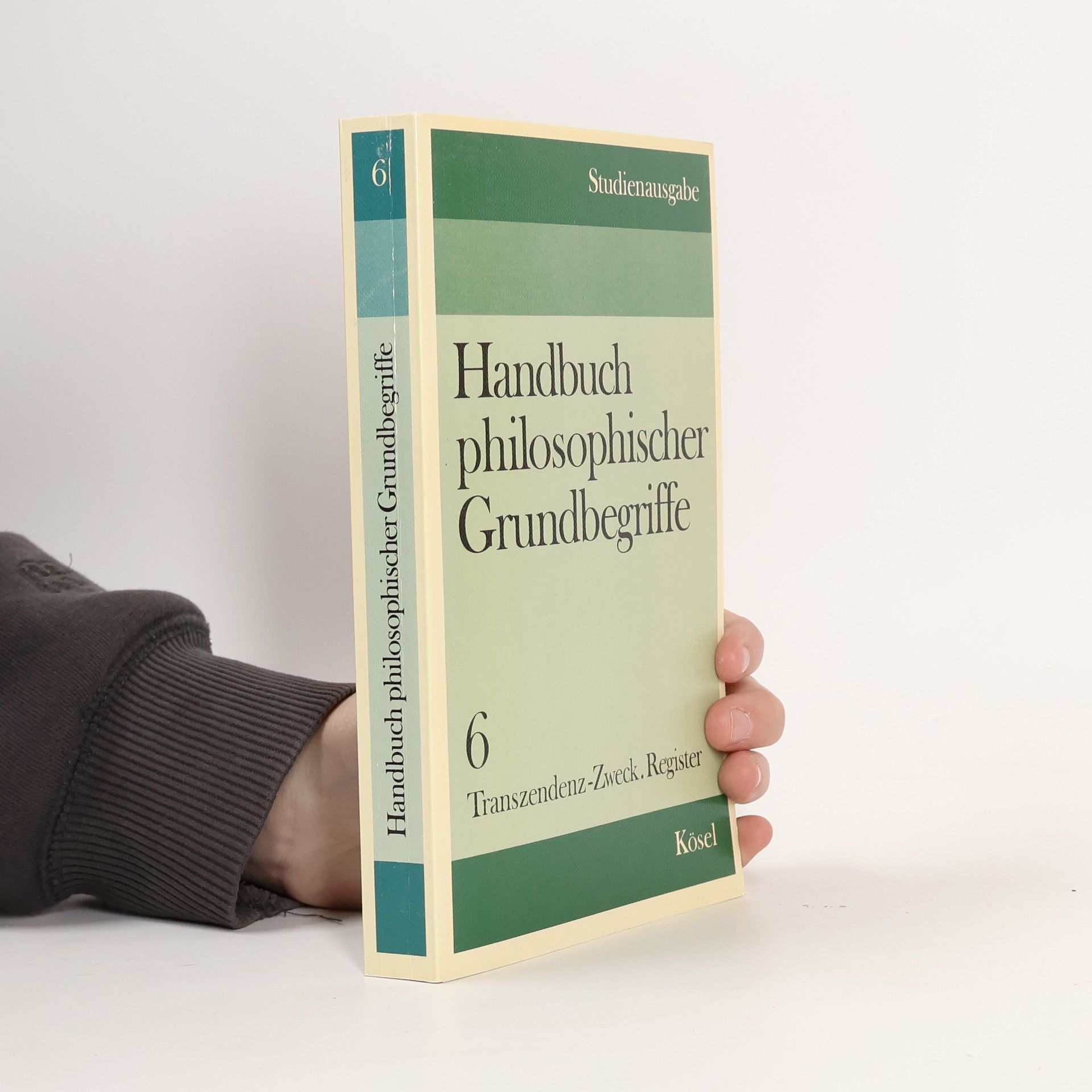
Diese Einführung in Schellings Denken für Interessierte und Studierende nimmt zugleich zu zentralen Themen der Schelling-Forschung Stellung. Die Grundintention Schellings, der weniger als System- denn als genialer Problemdenker zwischen Fichte und Hegel gilt, zielt auf eine Philosophie des Absoluten als All-Einheitsphilosophie mit den Problemkomplexen Einheit und Vielheit, Absolutes und Endliches, Vernunft und Geschichte sowie Philosophie und Religion. Das Buch ist nach dem Werk von Kuno Fischer die erste neuere genetische Darlegung der Schelling'schen Philosophie nach ihren Hauptthemen in deutscher Sprache.
Verführung statt Erleuchtung
- 163 Seiten
- 6 Lesestunden
Mit Beiträgen Von Hans Michael Baumgartner ... [et Al.] ; Dieter Wellershoff (herausgeber). Includes Bibliographical References (p. 293-297).
Kolloquium Kunst und Philosophie - 3: Das Kunstwerk
- 392 Seiten
- 14 Lesestunden