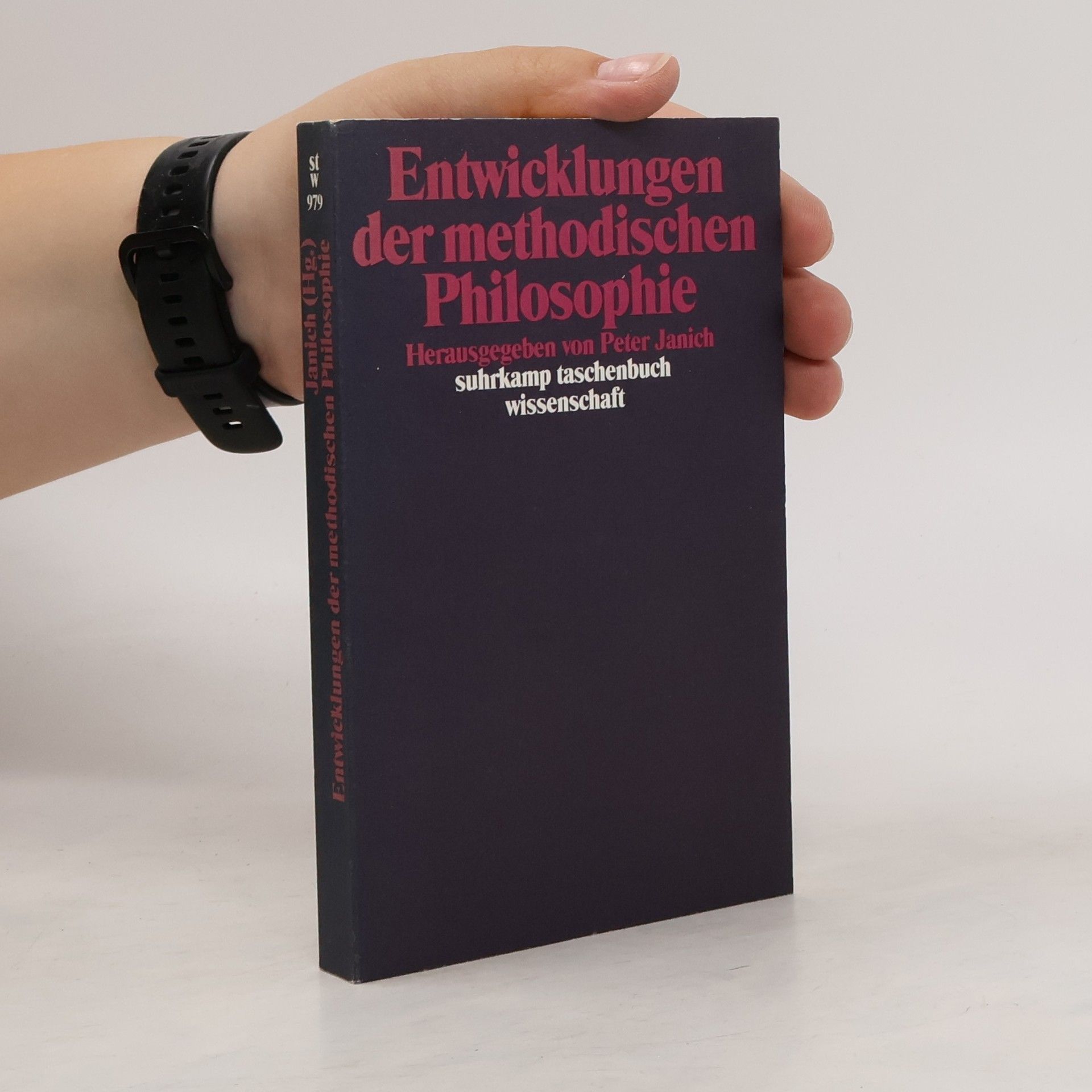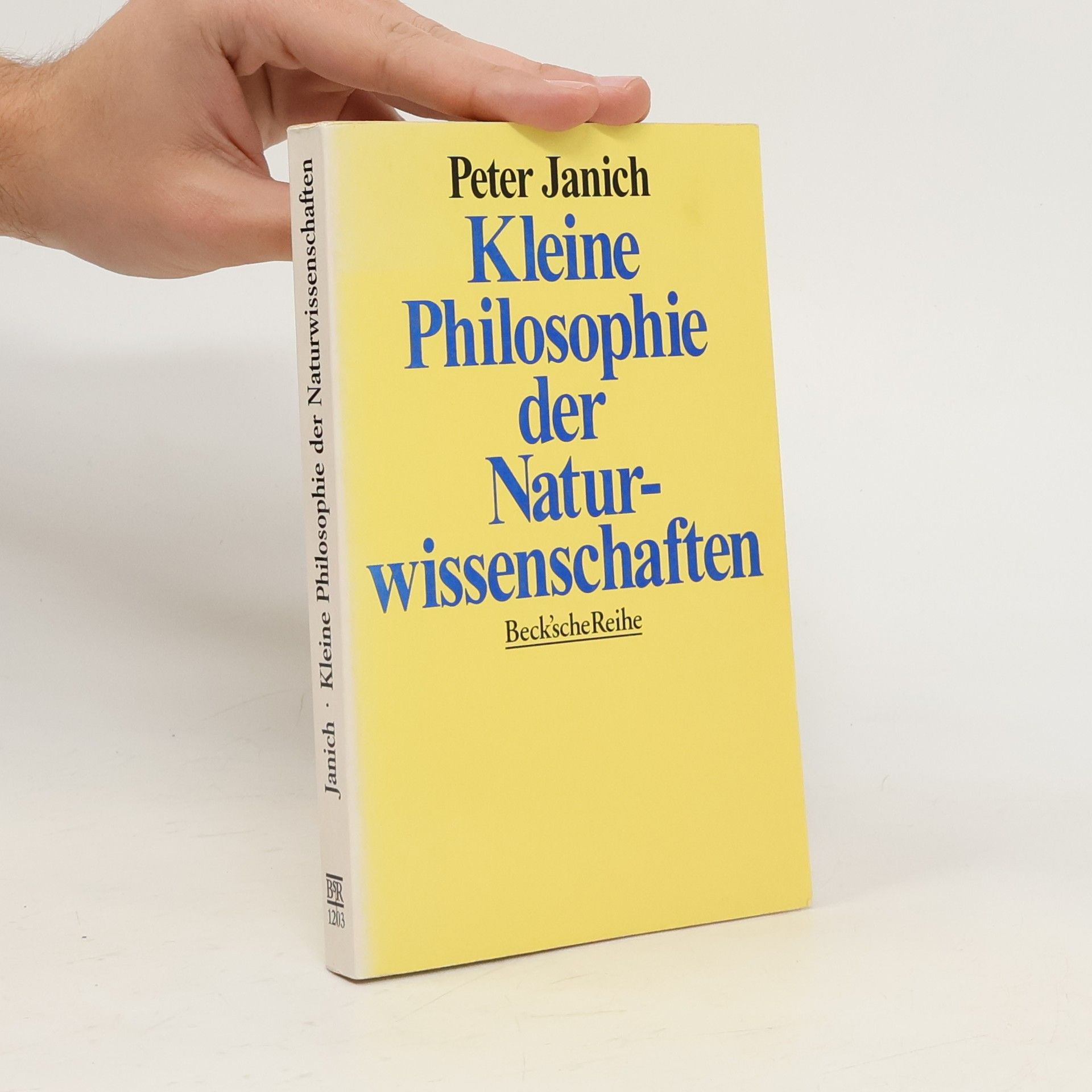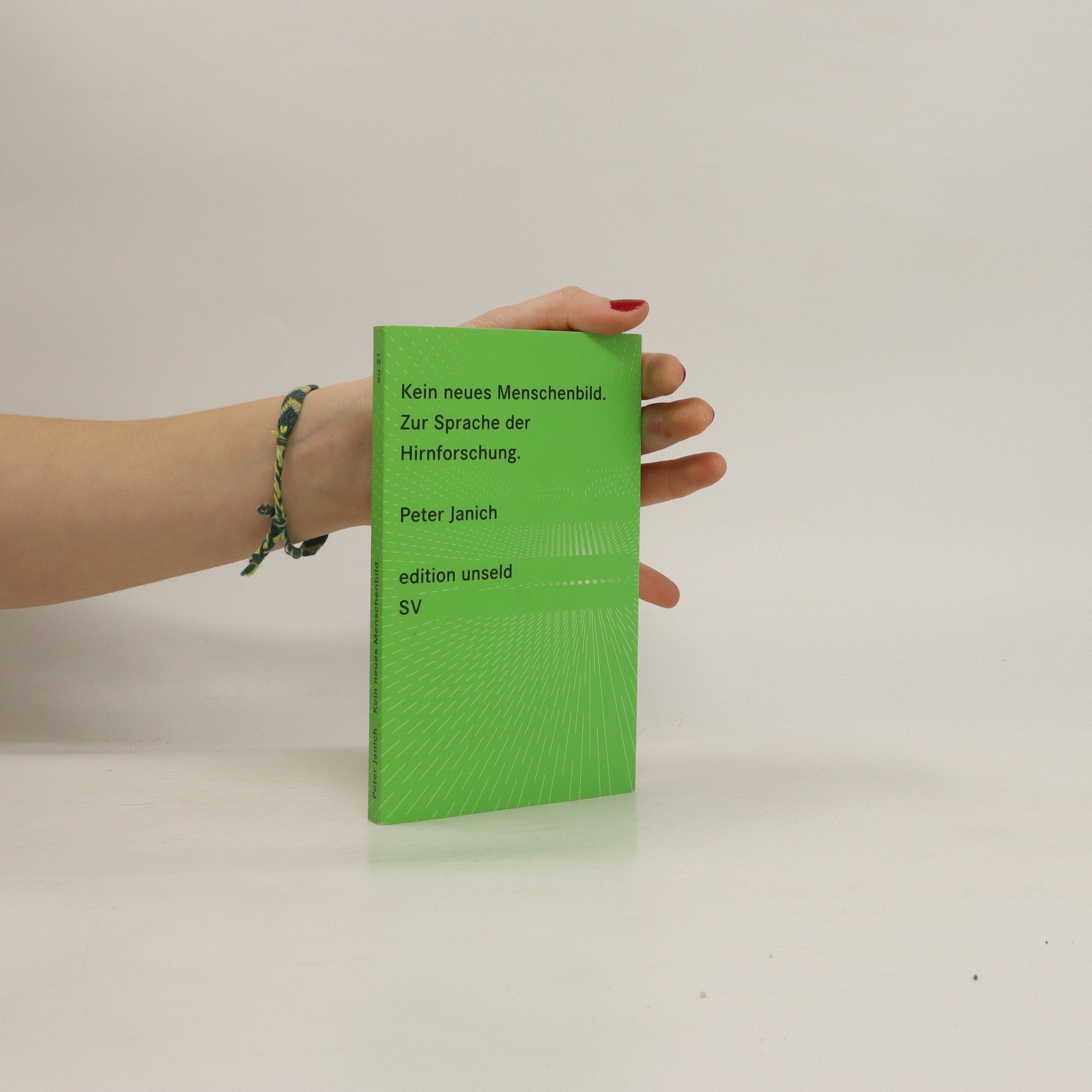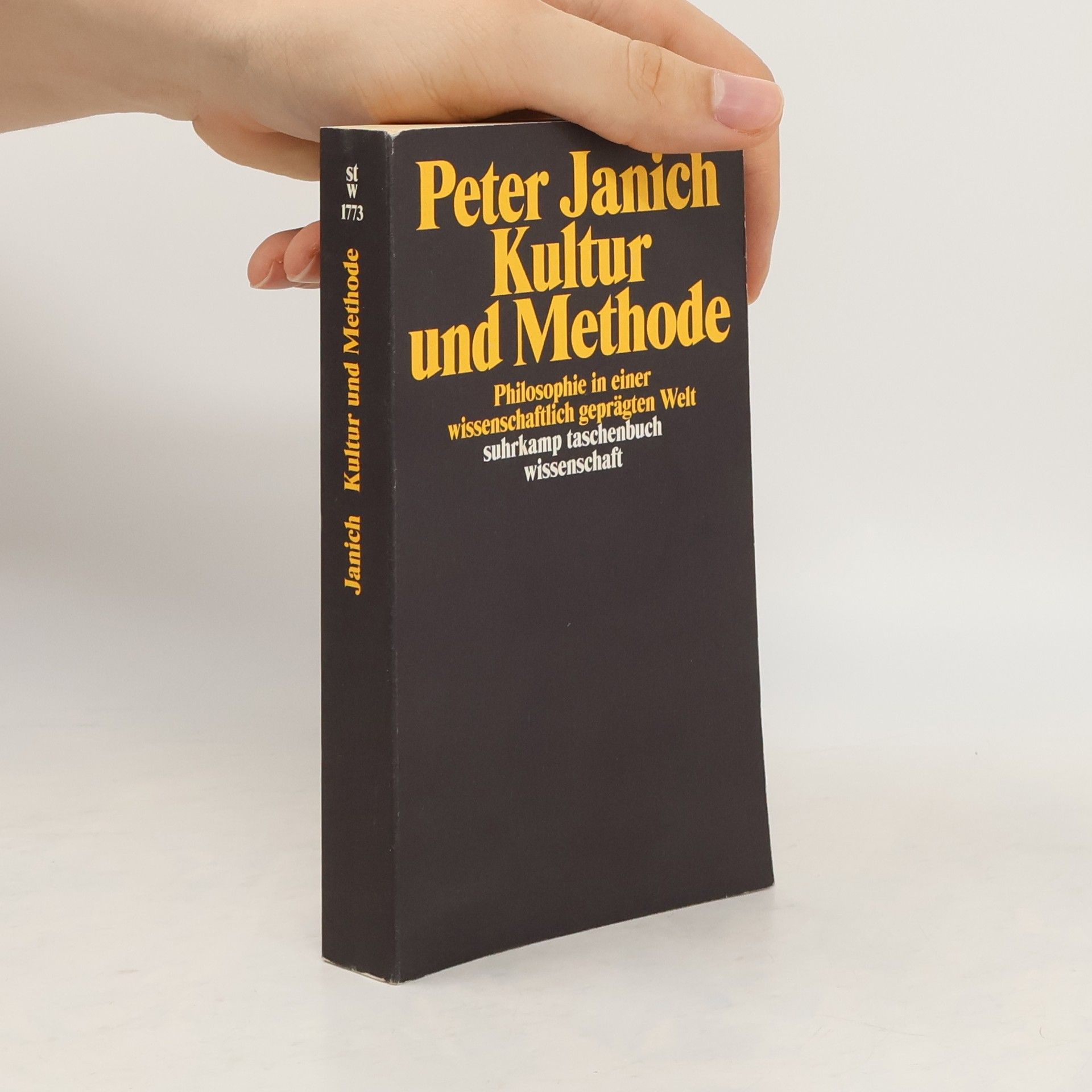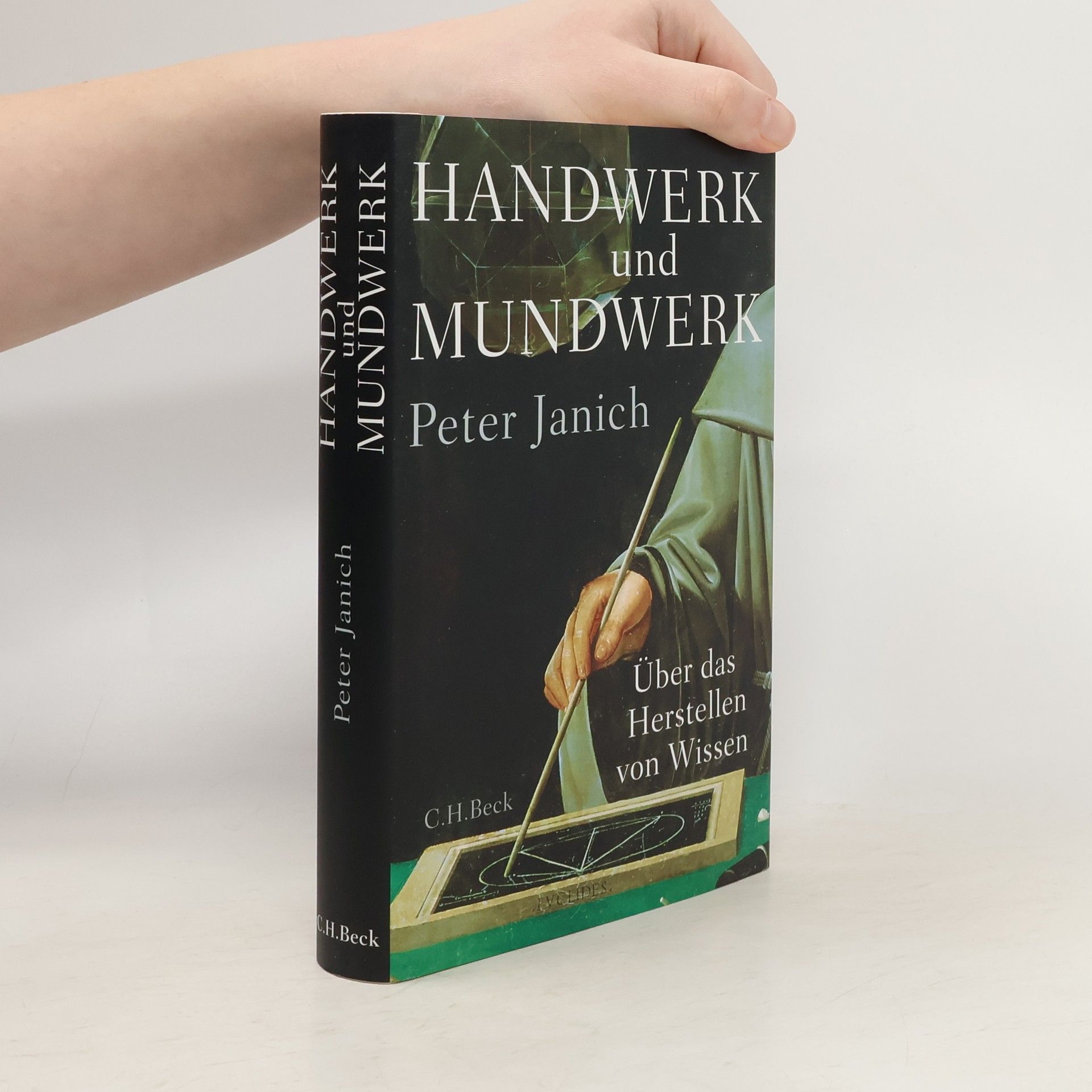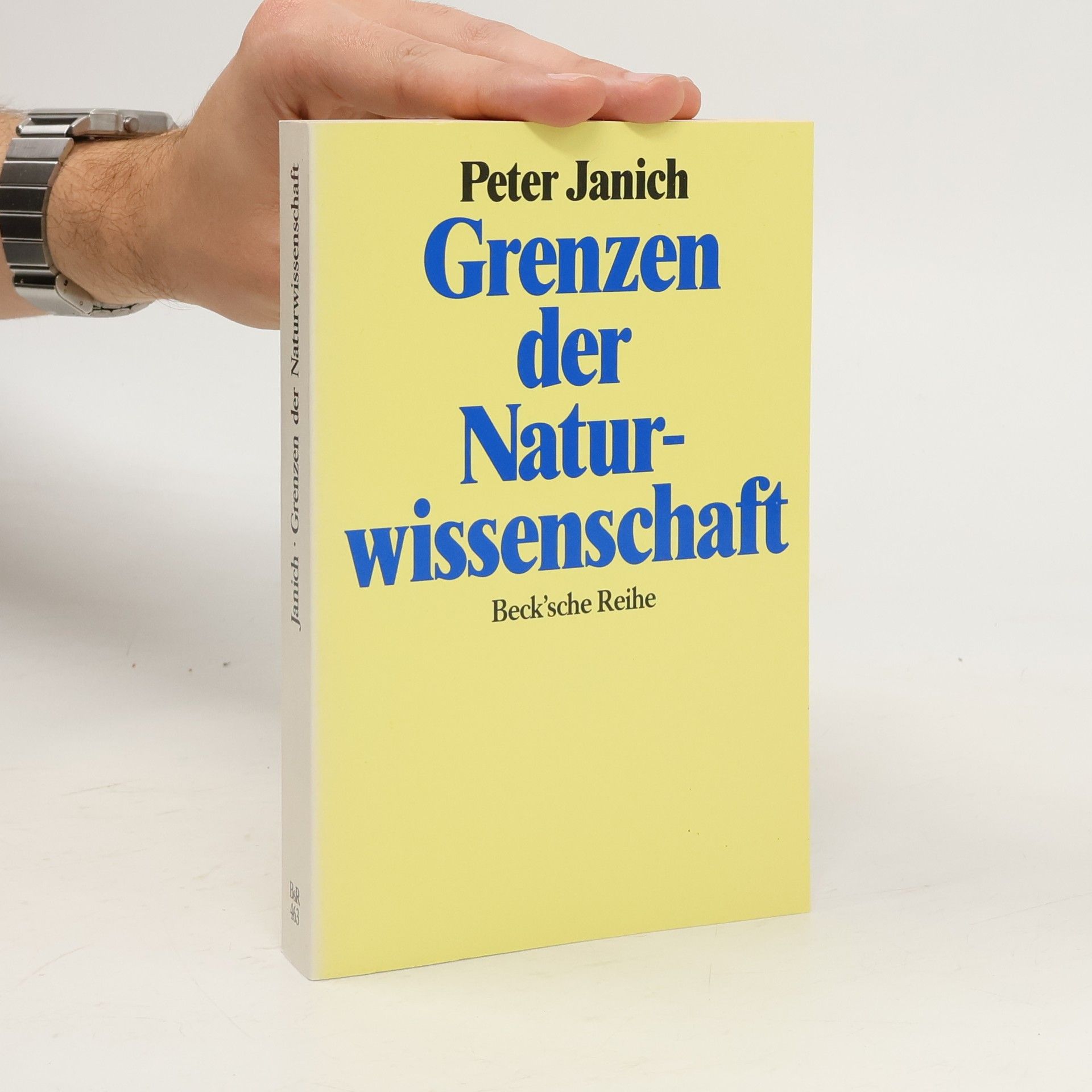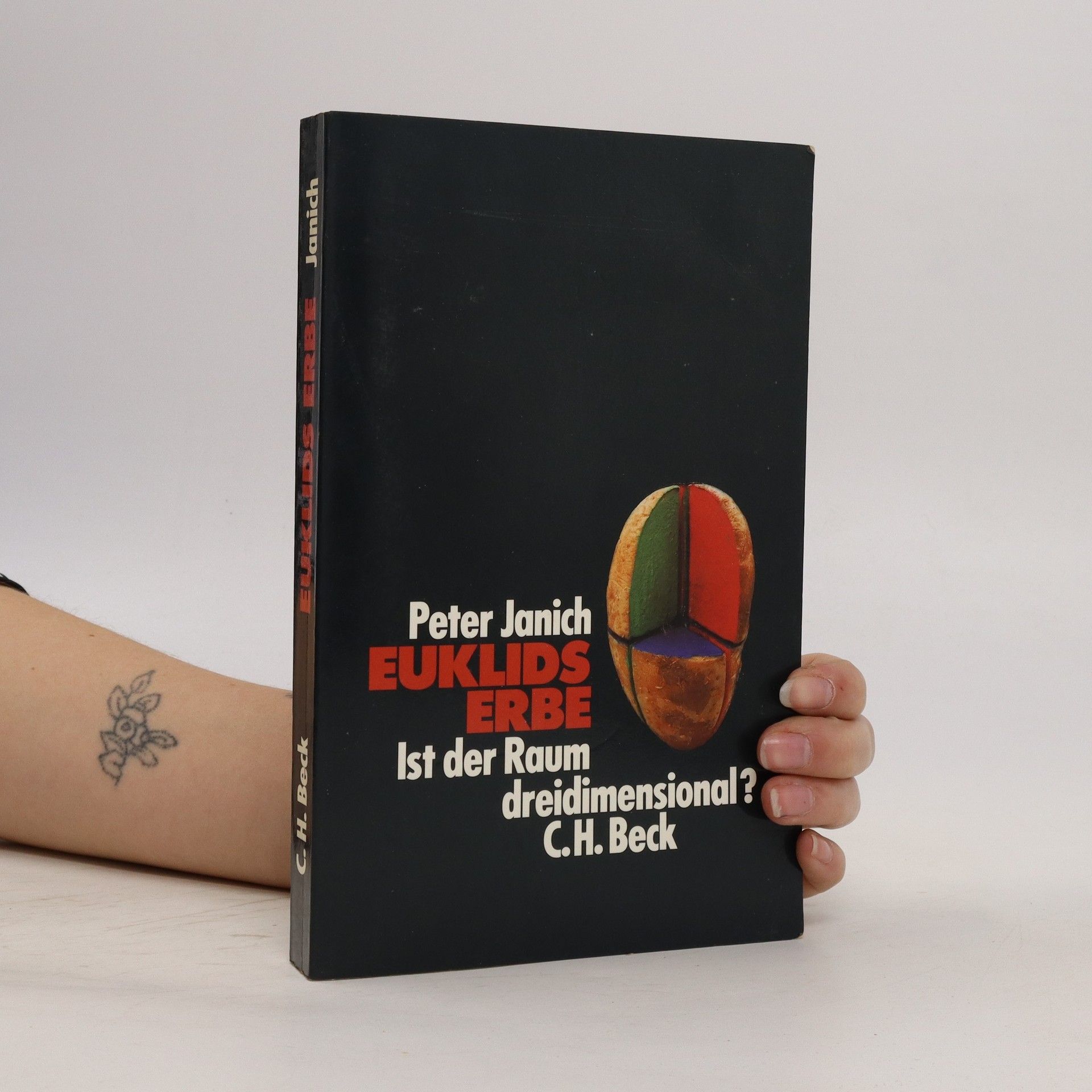Handwerk und Mundwerk
Über das Herstellen von Wissen
Bereits die griechischantike Philosophie stellte das Handwerk in der Rangfolge der Wertschätzung weit unter die viel edlere "reine Theorie". Seither steht der Theoretiker im Gegensatz zum Praktiker, also zum Arbeiter und Handwerker. Es wirkt das Vorurteil, dass der Handwerker nichts zur theoriefähigen Erkenntnis beitrage. Der Physiker genießt mehr Ansehen als der Ingenieur, und dieser wieder mehr als der Handwerker. Peter Janich unternimmt in diesem spannend geschriebenen Buch eine beeindruckende Forschungsreise durch die Wissenschaftsgeschichte. Ein philosophischer Blick auf die Fächer Geometrie, Physik, Chemie, Lebens- und Kommunikationswissenschaft zeigt, dass diese ihre Gegenstände handwerklicher Herstellung verdanken. Mehr noch, die zweckmäßige Reihenfolge von Schritten im Herstellen gibt dem "Mundwerk", also der logischen Begriffs- und Theoriebildung, eine eigene Rationalität. Was der Handwerker in das gute Funktionieren seiner Produkte als Zweck investiert, macht am Ende den technischen Erfolg der modernen Naturwissenschaften aus. Das Buch ist anschauliche Wissenschaftsphilosophie und nicht zuletzt eine Ehrenrettung des Handwerks vor seinen Verächtern.