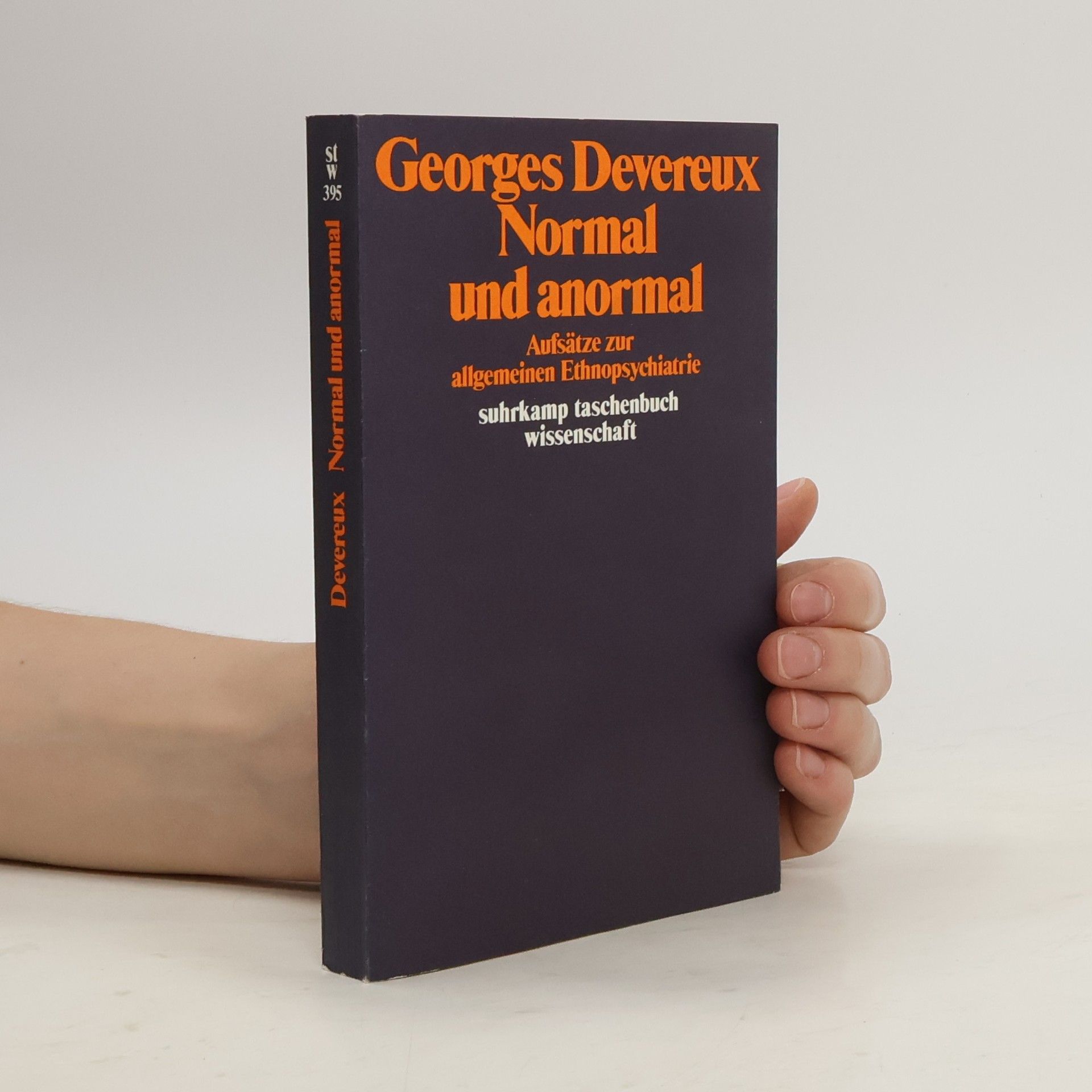Angst und Methode in den Verhaltenswissenschaften – die Summe der jahrzehntelangen ethnopsychoanalytischen Forschungen und der psychoanalytischen Praxis von Georges Devereux – ist eine Kritik der verhaltenswissenschaftlichen Methodologie, die zu objektiver Erkenntnis zu gelangen glaubt, indem sie die Subjektivität des Forschers ausschaltet. An einer Fülle von Beispielen aus allen Bereichen der Humanwissenschaften und der Literatur zeigt Devereux demgegenüber, daß die Reaktionen des Verhaltenswissenschaftlers auf sein Material und auf seine Arbeit als die elementarsten Daten aller Verhaltenswissenschaft zu behandeln sind. Devereux fragt, nach welchen Regeln das zu untersuchende Objekt konstituiert wird, und liefert den Nachweis dafür, in welchem Maße die Angst des Beobachters den Erkenntnisprozeß und damit die Vergegenständlichung des Beobachteten beeinflußt. Die Verhaltenswissenschaften sind sowohl in ihren Methoden wie in ihren Ergebnissen eher ein Produkt der Angst vor dem Erkenntnisobjekt als der »Liebe zur Wahrheit«.
George Devereux Bücher
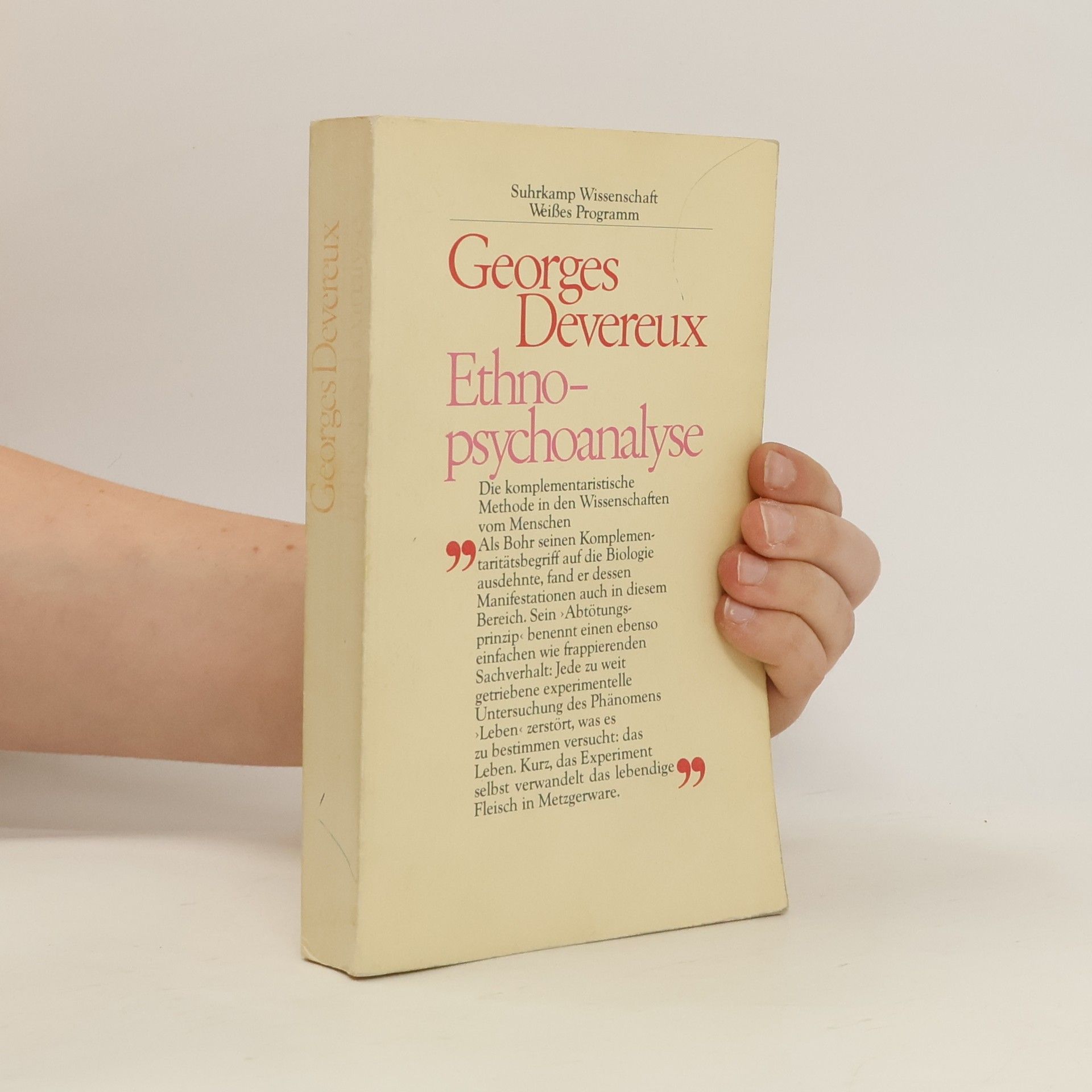
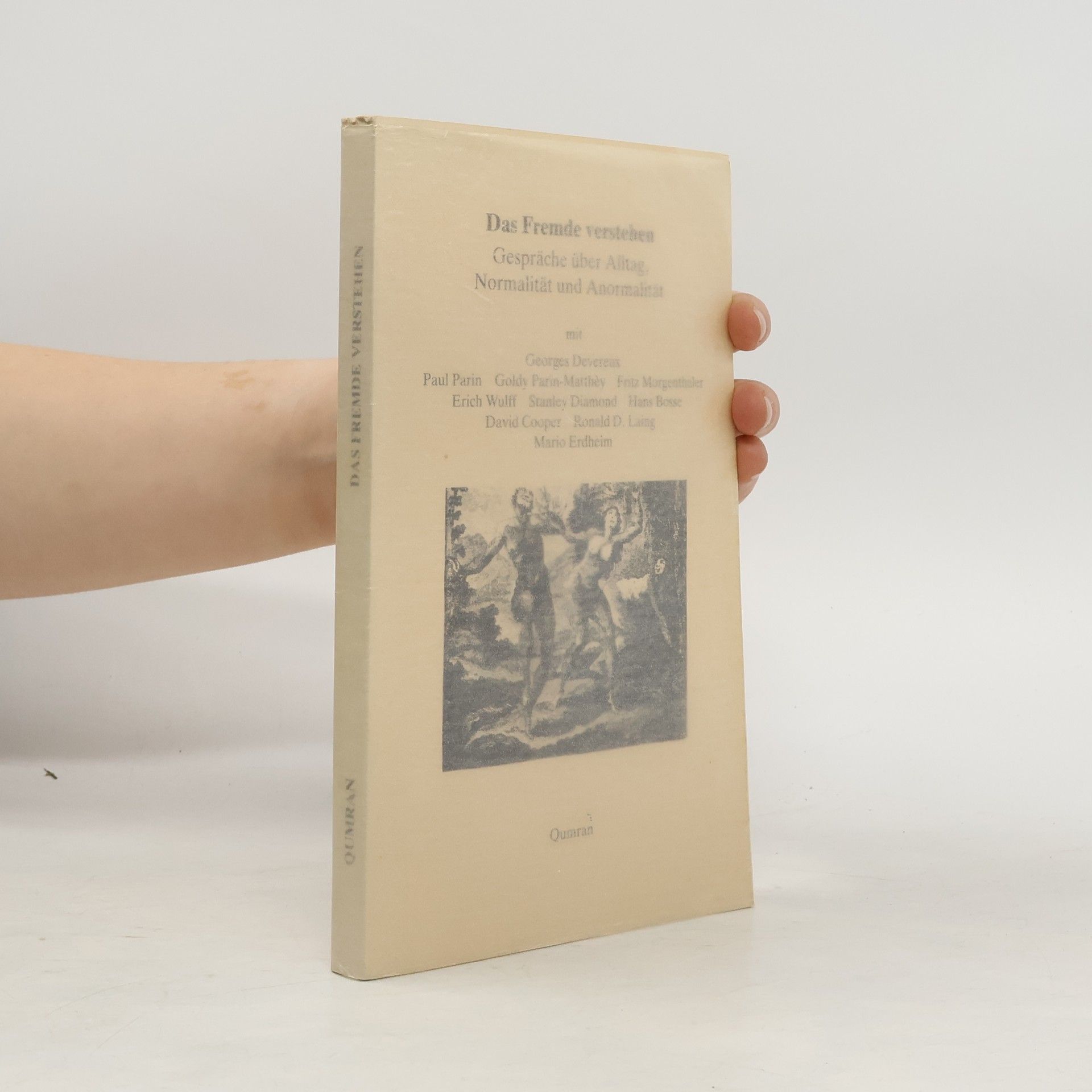

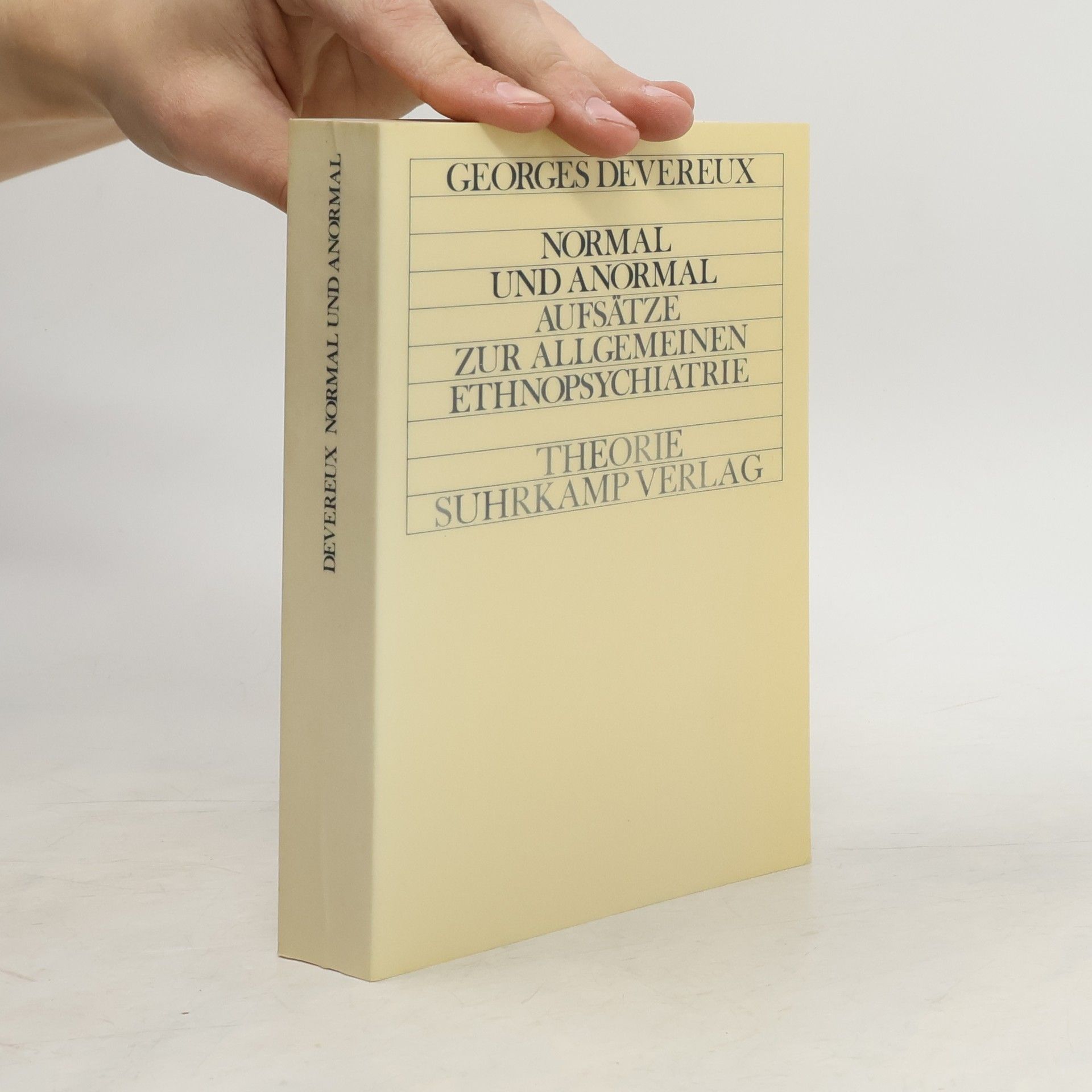


Normal und anormal
Aufsätze zur allgemeinen Ethnopsychiatrie
Zentraler Gegenstand der von Georges Devereux entwickelten Ethnopsychiatrie ist die Kultur als ein standardisiertes System von Abwehrmechanismen. »Devereux entwickelt diesen Ansatz in einer kritischen Analyse des traditionellen Trauma-Konzepts. Galt bisher das Trauma als Folge von Streßsituationen an sich, d. h. von schädlichen Kräften, die auf das Individuum einwirken, so hebt Devereux hervor, daß ein Streß nur dann traumatisierend wirke, ›wenn die Kultur keinerlei vorherbestimmte, in Serie produzierte, Abwehrmechanismen zur Verfügung stelle‹. Der eminente Wert von Devereux᾿ Leistung besteht nicht nur darin, daß er theoretisch ein neues Gebiet eröffnet hat, sondern vor allem darin, daß er seine Theorien immer in bezug auf die Praxis des Psychiaters oder Ethnologen entwickelt.« (Mario Erdheim)
Georges Devereux demonstriert die psychologische Glaubwürdigkeit der Träume, die in den Dramen von Aischylos, Sophokles und Euripides für bestimmte Charaktere verfasst wurden. Er begegnet dem Einwand, dass fiktive Personen und antike Dichter nicht psychoanalytisch interpretiert werden können, mit einem radikalen textkritischen Ansatz. Die Überlieferungsgeschichte der Texte wird als psychologisch darstellbare Geschichte von Fehlleistungen und Verdrängungen betrachtet. Zur Überprüfung der Traumauthentizität gehört nicht nur die inhaltliche Trauminterpretation, sondern auch die Analyse der Textüberlieferung sowie der philologischen und literaturwissenschaftlichen Kontroversen. Der „Analysand“ ist nicht der fiktive Träumer oder der Dichter, sondern der Text selbst, was die Arbeit zu einer auf Konstruktion basierenden „Quasi-Psychoanalyse“ macht. Die verwendeten Elemente stammen aus drei normalerweise getrennten Disziplinen: Altphilologie, inhaltlich orientierte Literaturwissenschaft und Psychoanalyse. Durch enge Zusammenarbeit mit führenden Gräzisten und umfassende Literaturrecherche erreicht Devereux ein oft unerfülltes Ziel: eine interdisziplinäre Gesamtansicht.
Ethnopsychoanalyse. Die komplementaristische Methode in den Wissenschaften vom Menschen
- 317 Seiten
- 12 Lesestunden