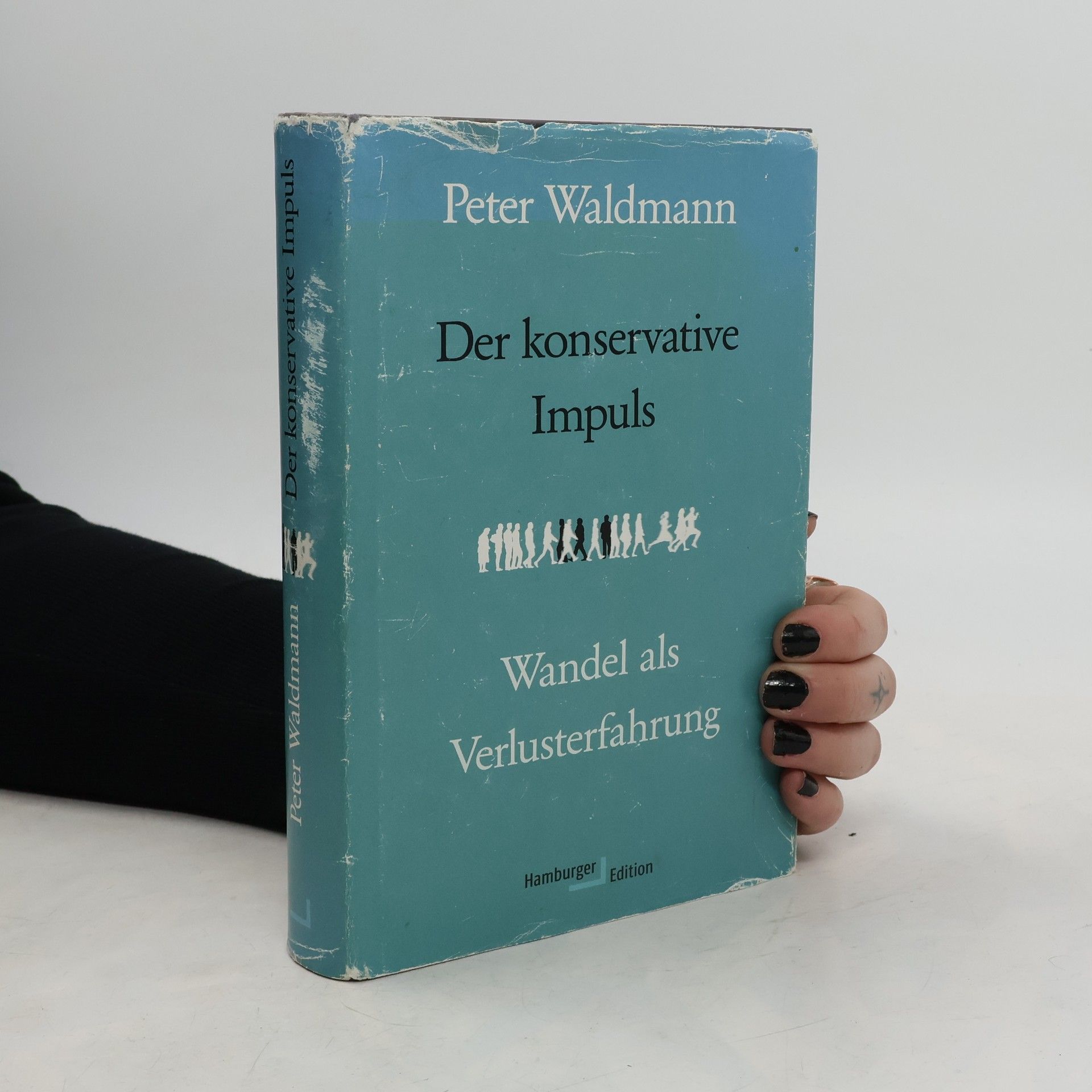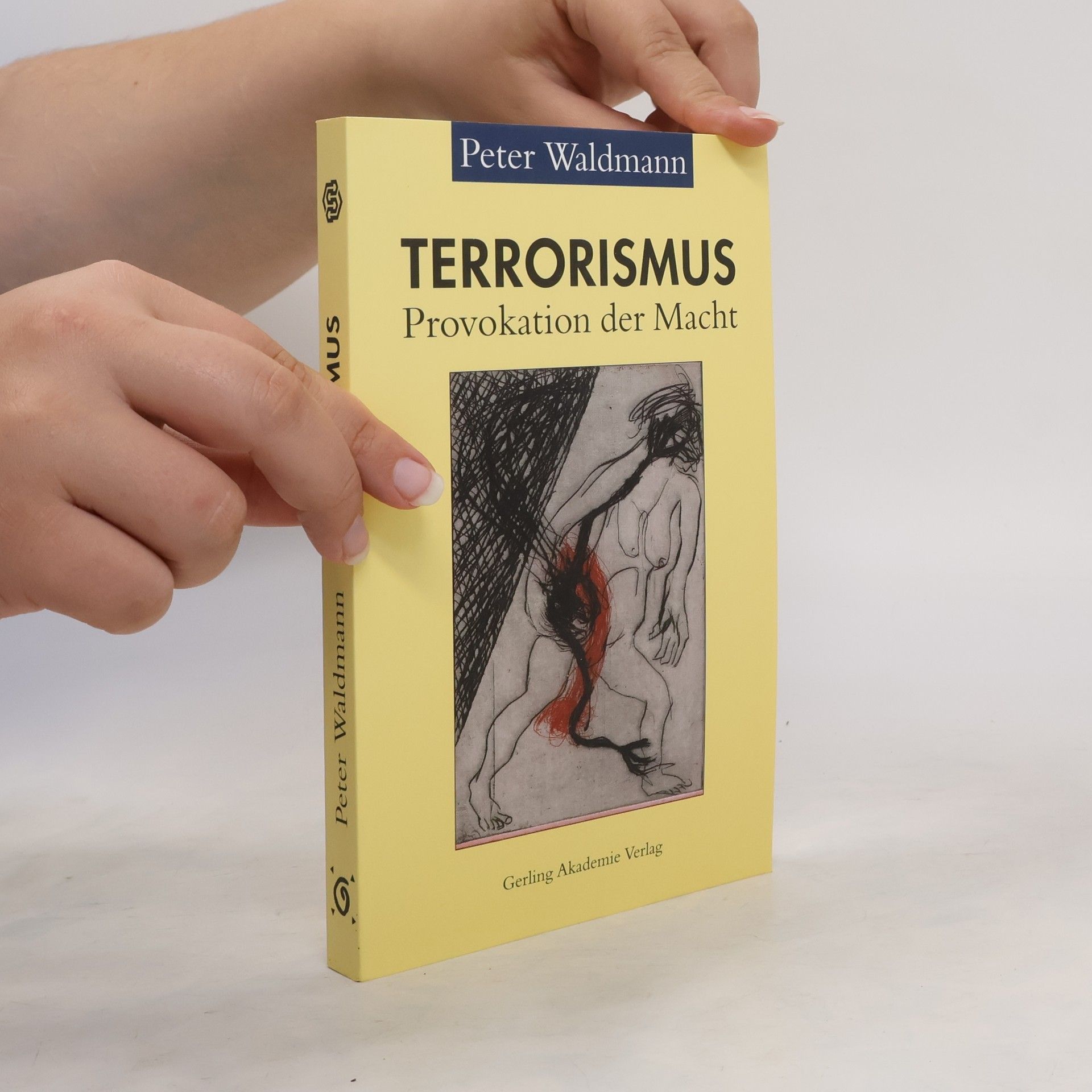Elitenbildung im kulturellen und historischen Vergleich
Der prägende Einfluss der Familien, Vorbilder und Lehrmeister
- 207 Seiten
- 8 Lesestunden
Die Studie von Peter Waldmann hinterfragt die gängige Auffassung in der Elitensoziologie, dass Spitzenpositionen allein durch individuelle Tüchtigkeit besetzt werden. Stattdessen untersucht sie, wie Gesellschaften sicherstellen können, dass die Klügsten und Leistungsstärksten Führungsrollen einnehmen. Historisch und kulturvergleichend analysiert sie die Elitenbildung vom Feudalismus bis zu den späten 70er Jahren in Ländern wie Deutschland, Frankreich, den USA, Japan und China. Zentrale Erkenntnisse zeigen die Schlüsselrolle von Oberschichtfamilien, individueller Ausbildung durch Lehrmeister und den Einfluss konkreter Personen im Auswahlprozess.