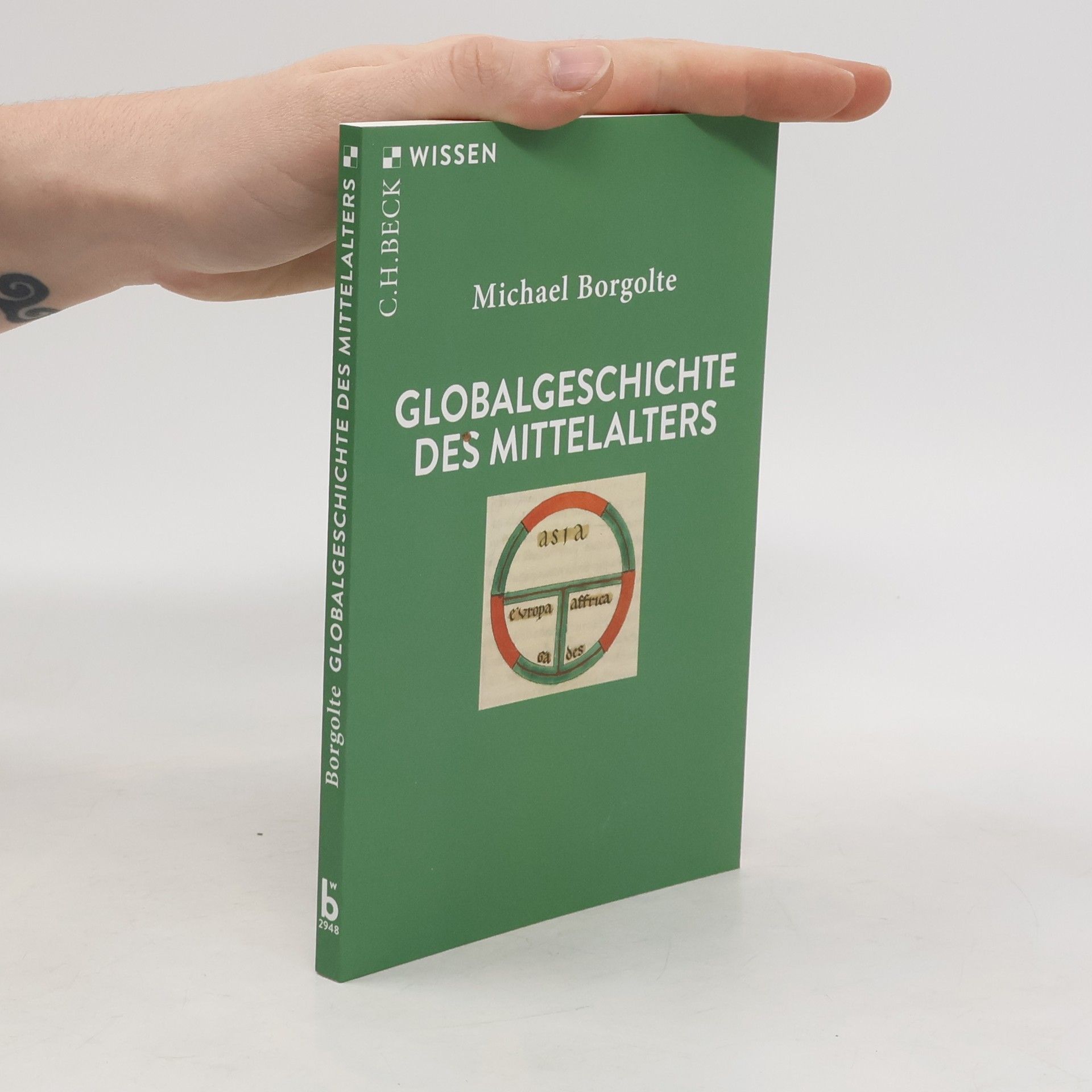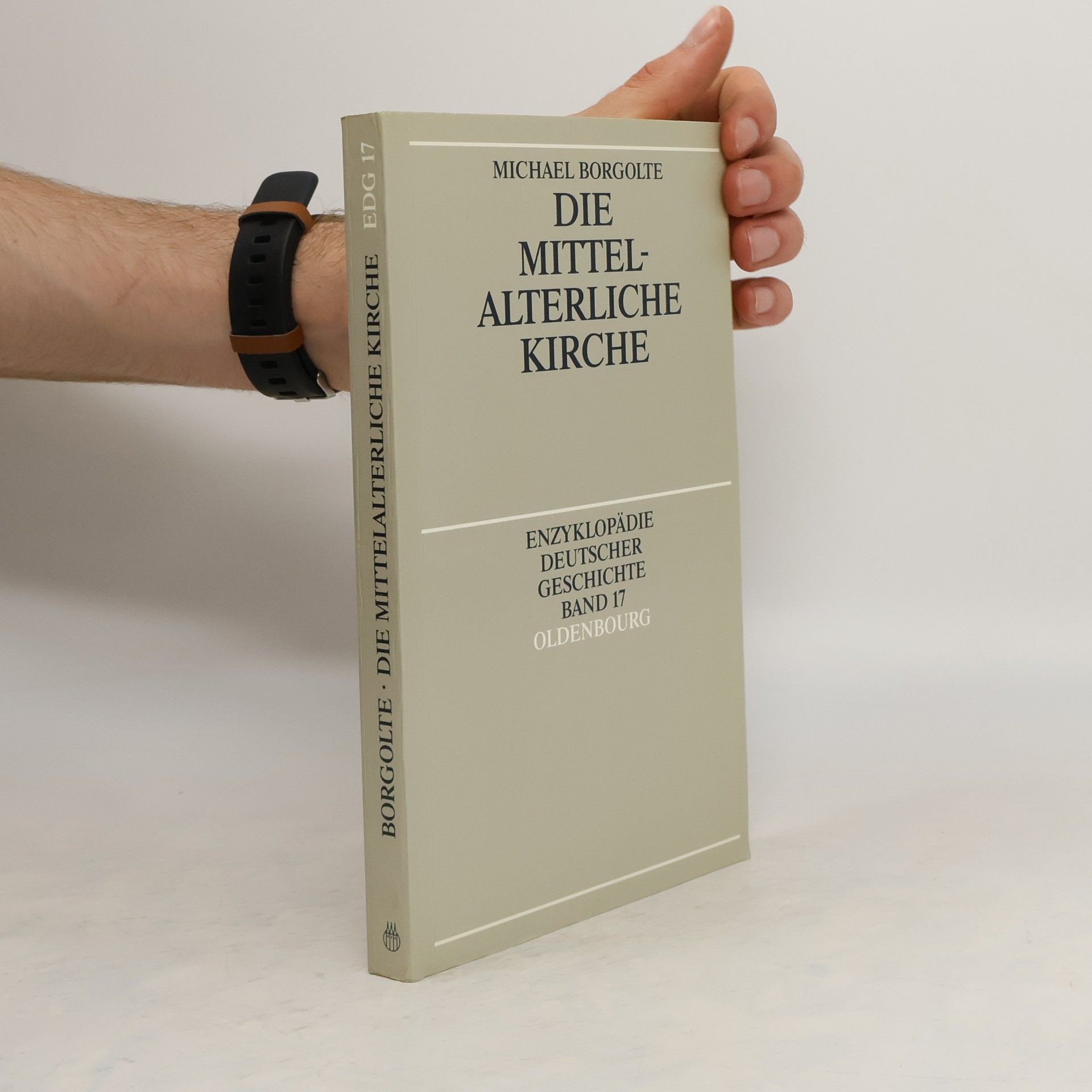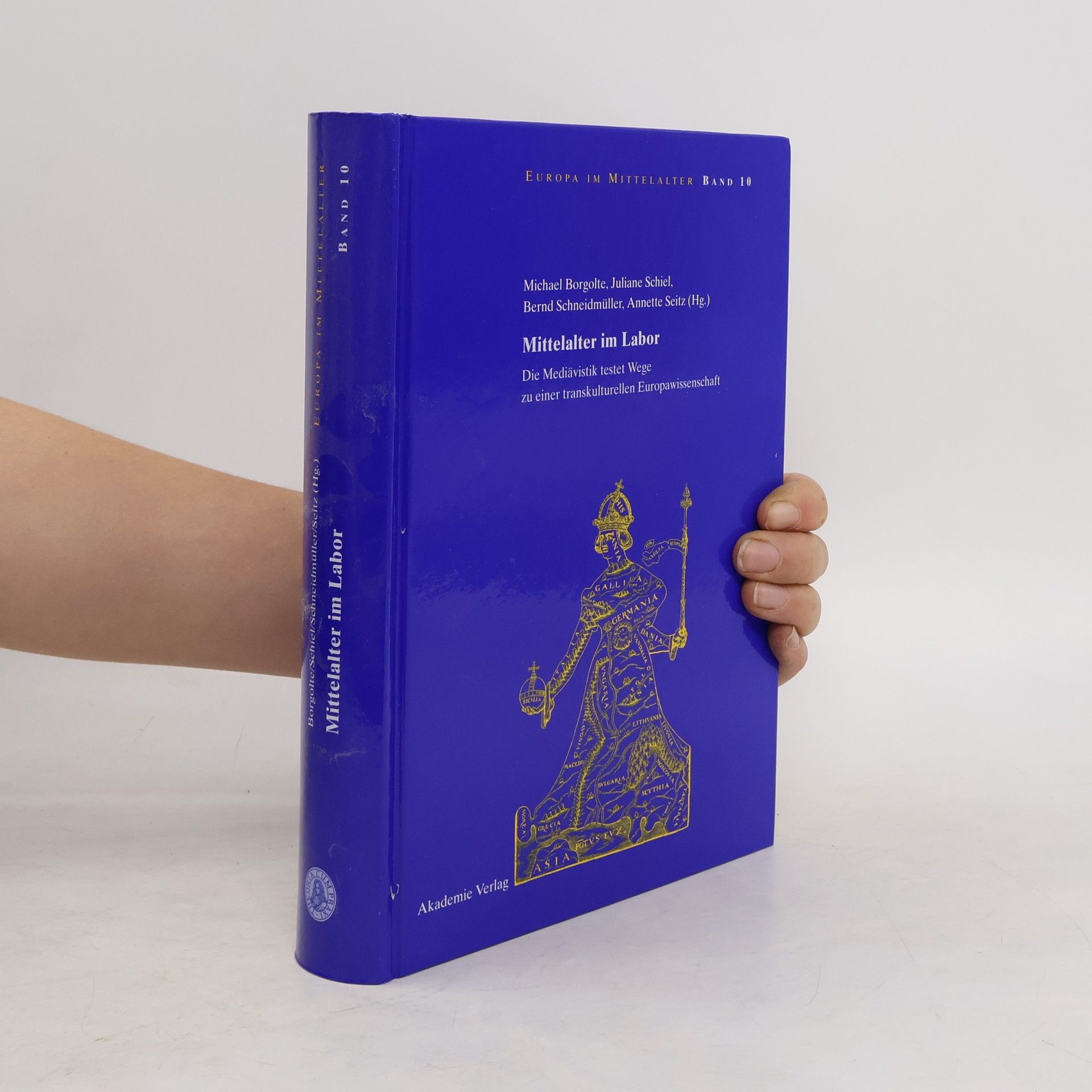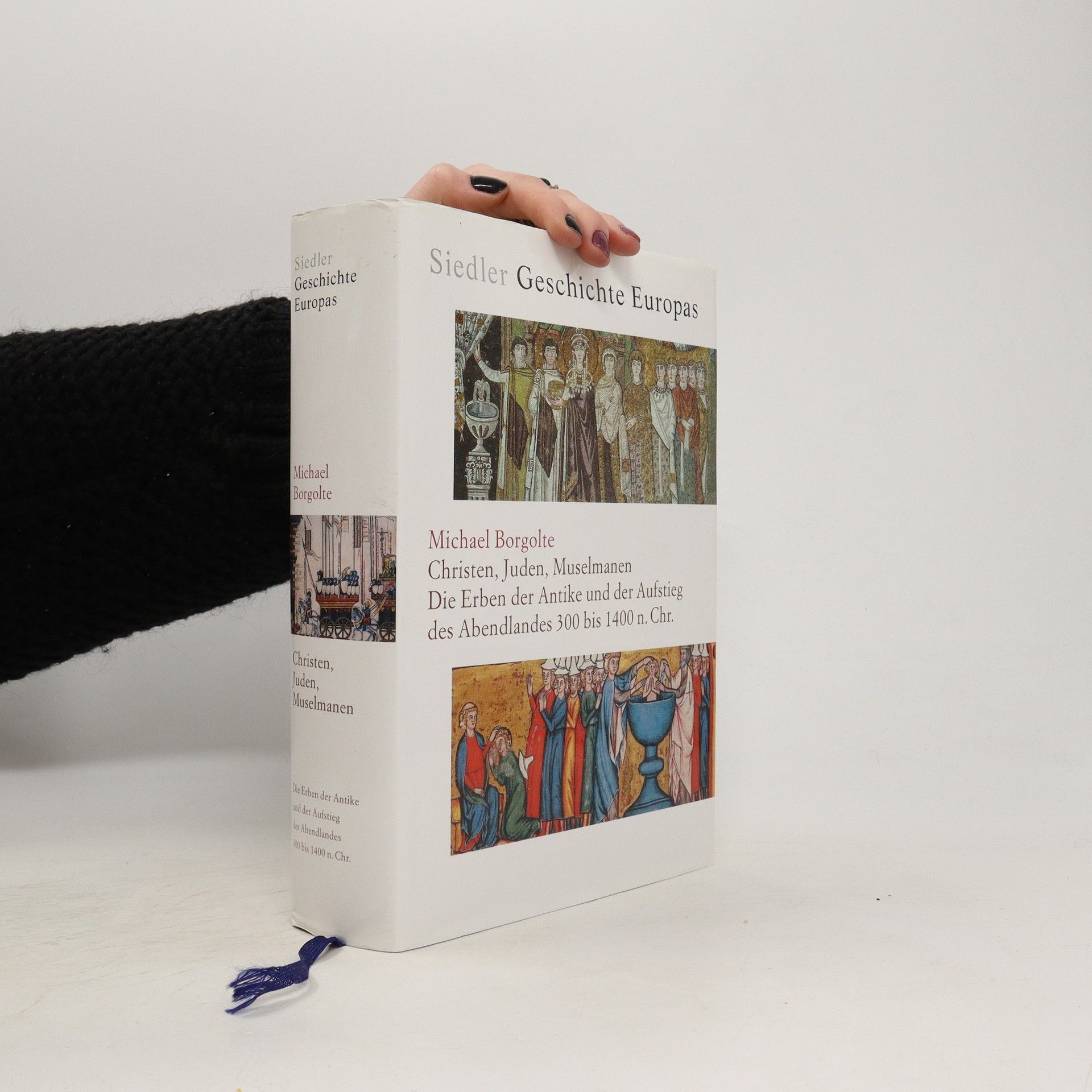Die Welten des Mittelalters
Globalgeschichte eines Jahrtausends
Die globalisierte Welt der Gegenwart mit ihren Orientierungskrisen erfordert eine Neubestimmung auch des Mittelalters jenseits eurozentrischer Blickverengungen. Michael Borgolte zeigt in seiner magistralen Darstellung, dass Europa zwar stets ein Teil der größten «Welt» von drei Kontinenten – Europa, Asien und Afrika – war, aber sich erst in einem langanhaltenden historischen Prozess aus seiner globalen Randposition befreien und zur eigenständigen Gestaltungsmacht werden konnte. Der bedeutende Mediävist legt damit nichts Geringeres vor als die erste Globalgeschichte der mittelalterlichen Welt.Anders als heute war die mittelalterliche Welt noch nicht global vernetzt. Sie war geprägt von zahlreichen Lebenswelten, die sich inselartig über den Globus verteilten, von Amerika bis China, im Nordmeer und Pazifik, unterschiedlich verdichtet in Europa und Afrika. Doch diese Inseln waren nicht alle isoliert. Es entstanden zahlreiche wirtschaftliche, kulturelle und religiöse Verbindungen von einer Intensität und Weite, die der Antike noch unbekannt waren. Mit stupender Gelehrsamkeit entfaltet Michael Borgolte in seinem Buch ein Panorama dieser Welten des Mittelalters und verknüpft sie zu einer Globalgeschichte, wie sie – auch international – noch nie geschrieben worden ist.