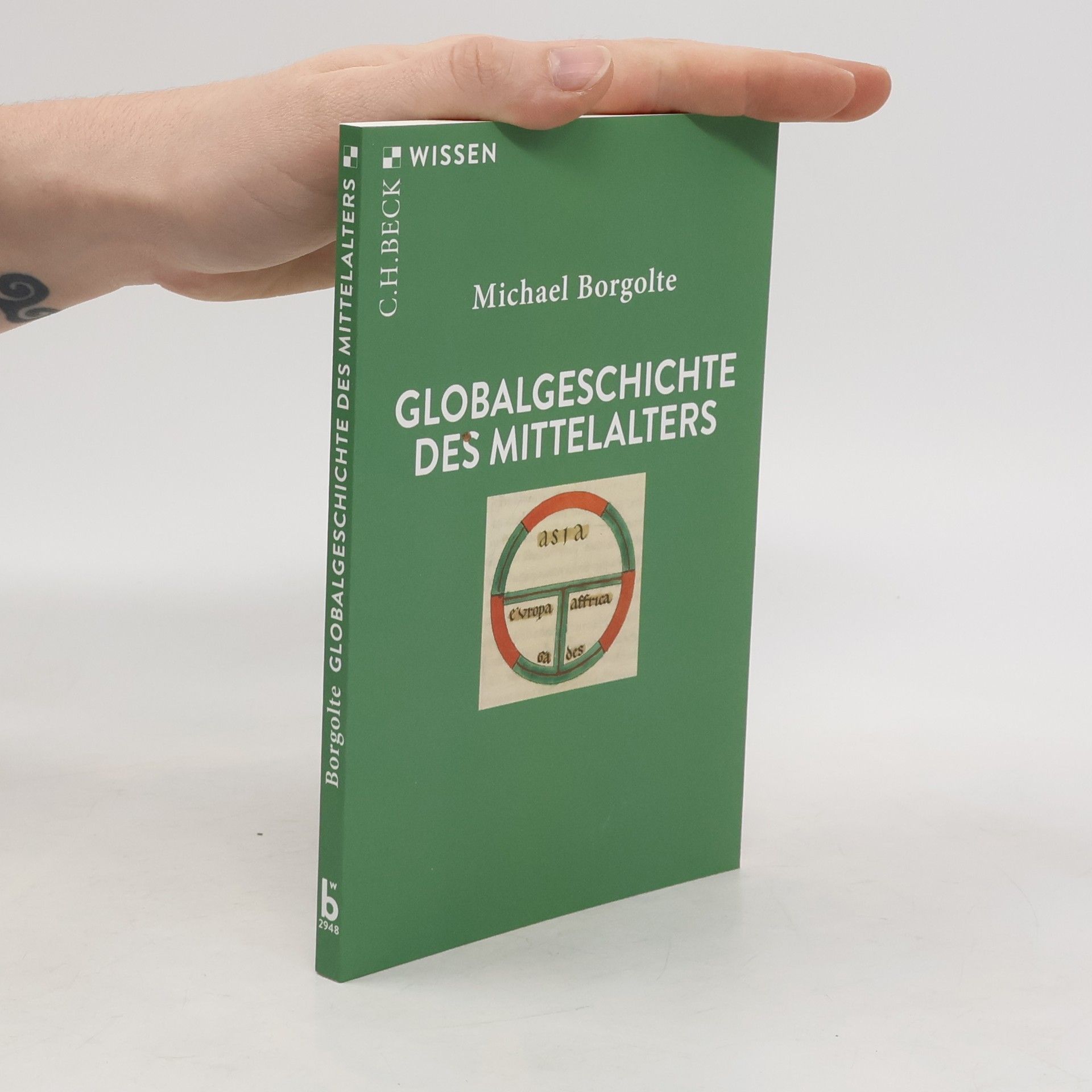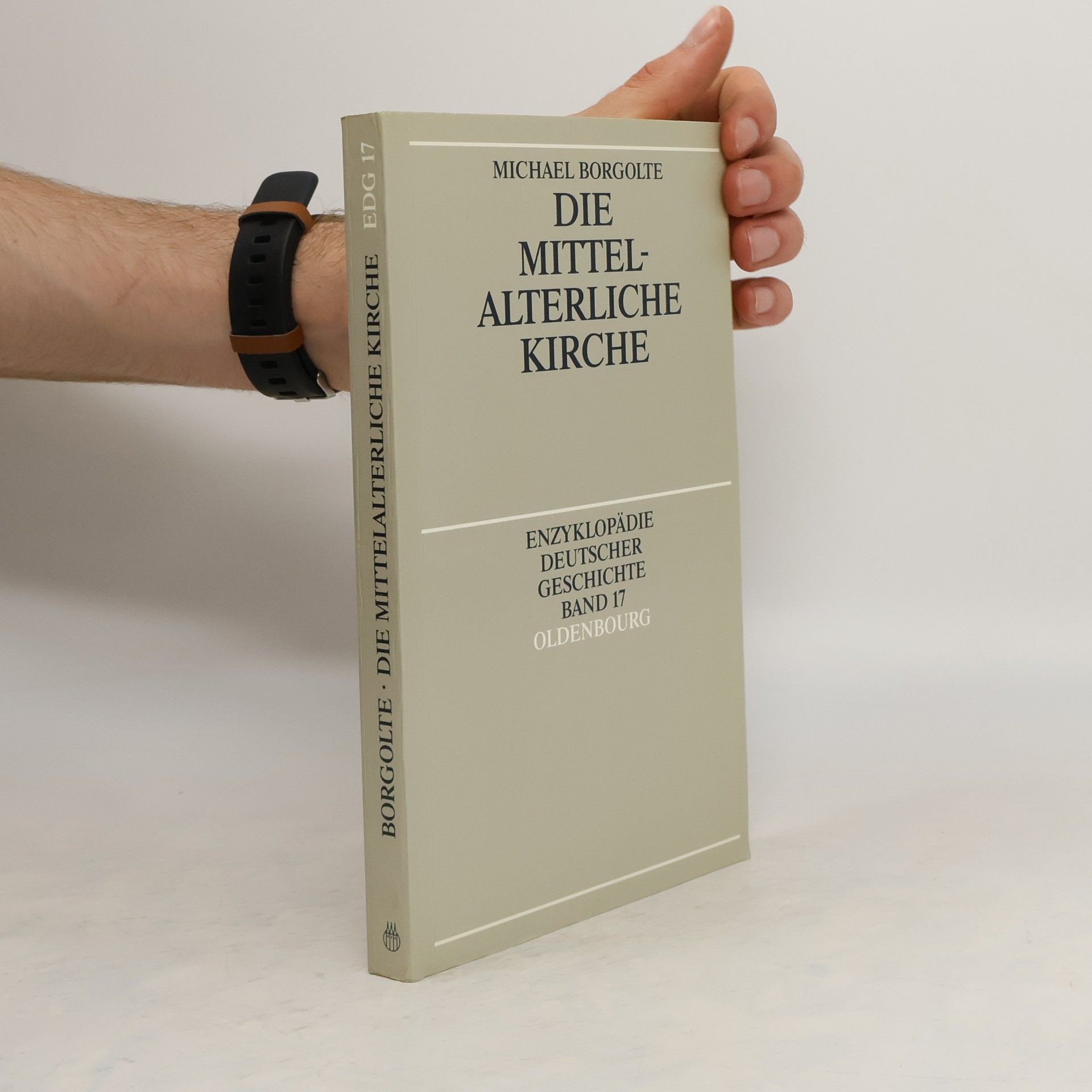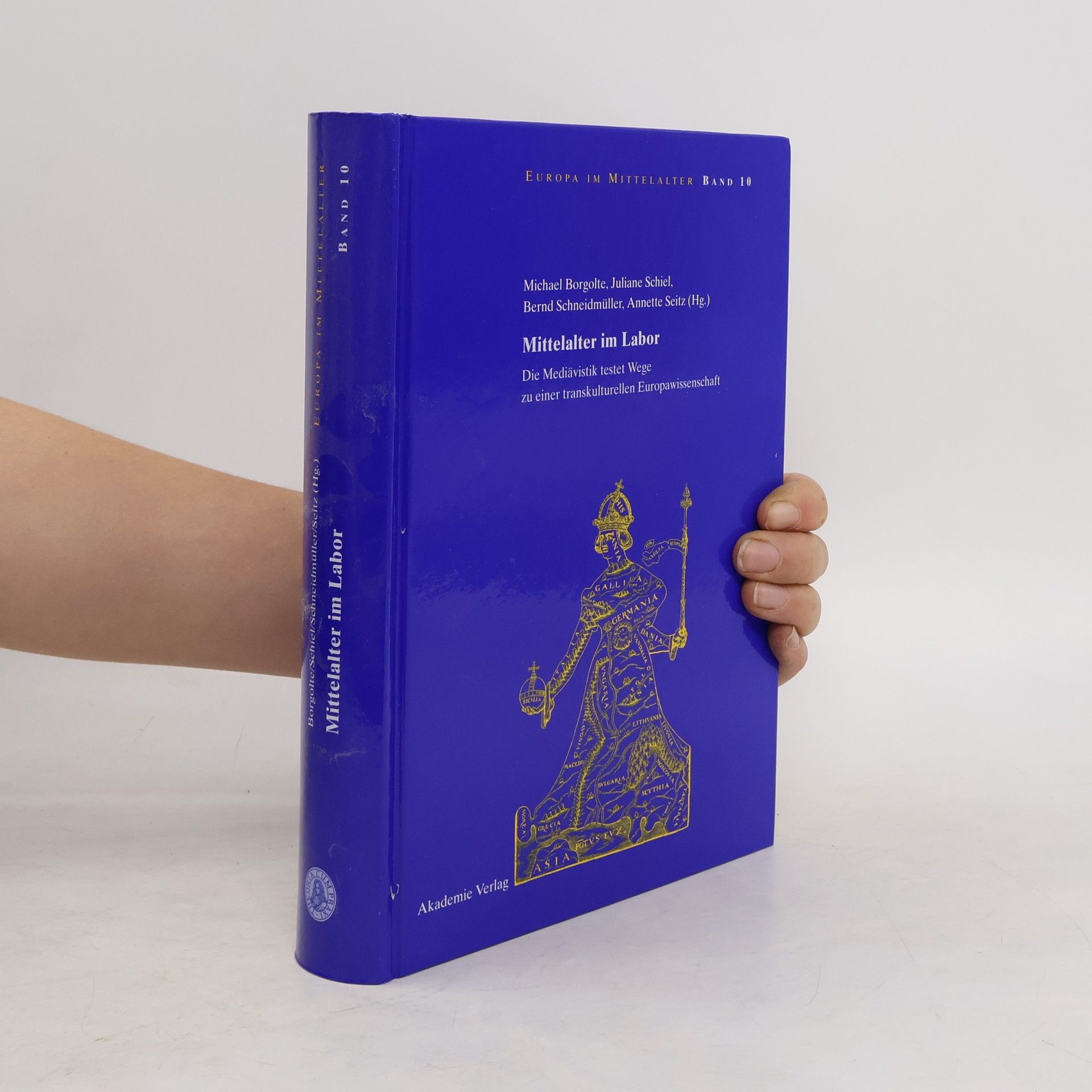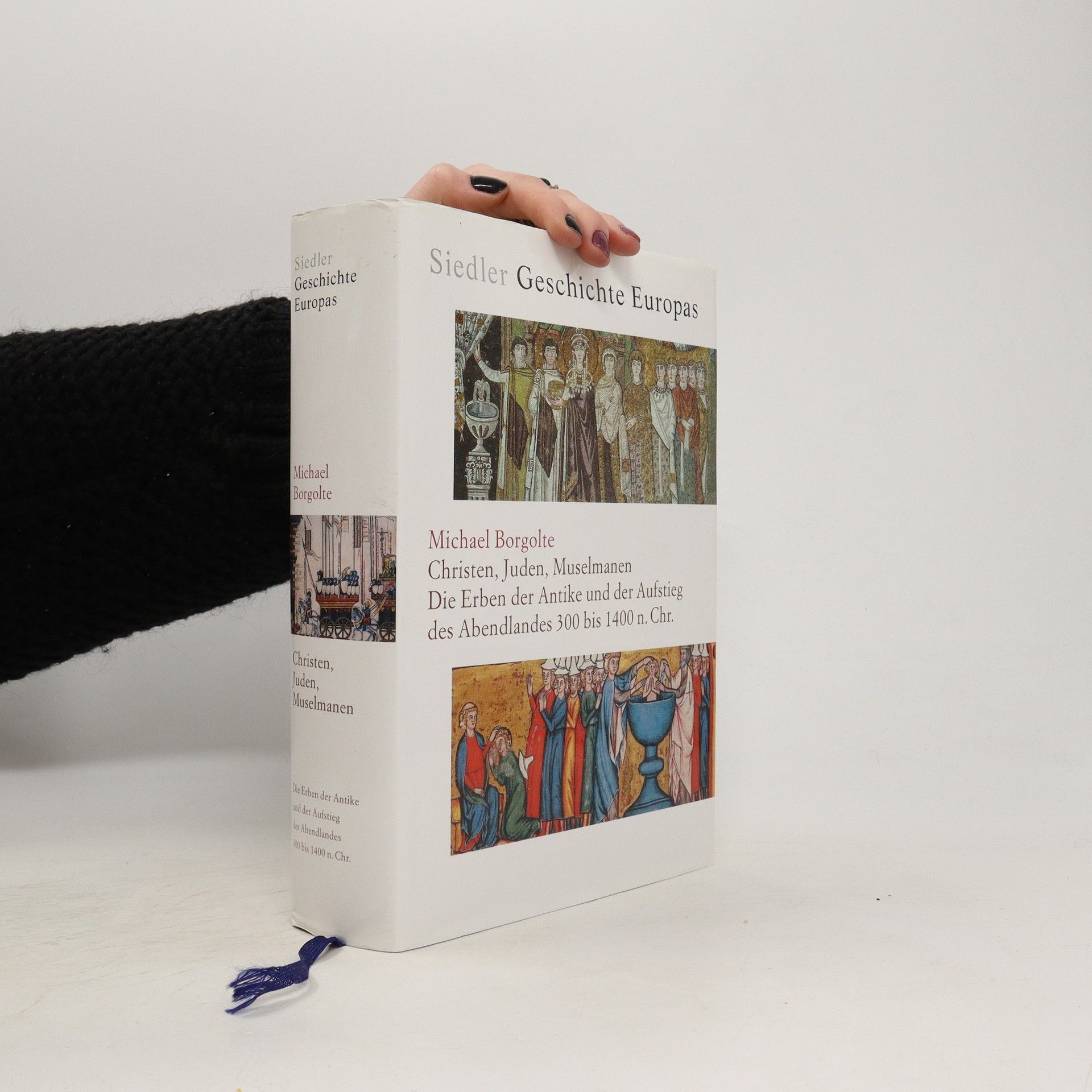Königin in der Fremde
Frühmittelalterliche Heiratsmigration und die Anfänge der europäischen Bündnispolitik
- 472 Seiten
- 17 Lesestunden
Die Rolle von Königstöchtern als "Heiratsmigrantinnen" wird in diesem Werk beleuchtet, das die politischen Ehen zwischen dem 5. und 11. Jahrhundert untersucht. Michael Borgolte zeigt, wie diese Frauen oft selbstbewusst ihre neuen Lebensumstände gestalteten und dabei zur Bildung eines Netzwerks christlicher Staaten in Europa beitrugen. Durch biografische Skizzen wird deutlich, dass viele Frauen ihre Rolle als Chance zur Lebensgestaltung sahen, während andere sich gegen die Erwartungen auflehnten. Das Buch thematisiert auch die Erfahrungen frühmittelalterlicher Migrantinnen und deren Einfluss auf die europäische Geschichte.