Einigkeit Recht Freiheit
Die liberale Studentenkorporation. Freie Wissenschaftliche Vereinigung 1881–1933. Eine Textedition nebst Anmerkungen zu Otto Dibelius und einem Aufsatz zu Georg Friedrich Nicolai und Kurt Hiller
Michael B. Buchholz ist Funktionsbereichsleiter im Krankenhaus für Psychotherapie und psychosomatische Medizin „Tiefenbrunn“ bei Göttingen.

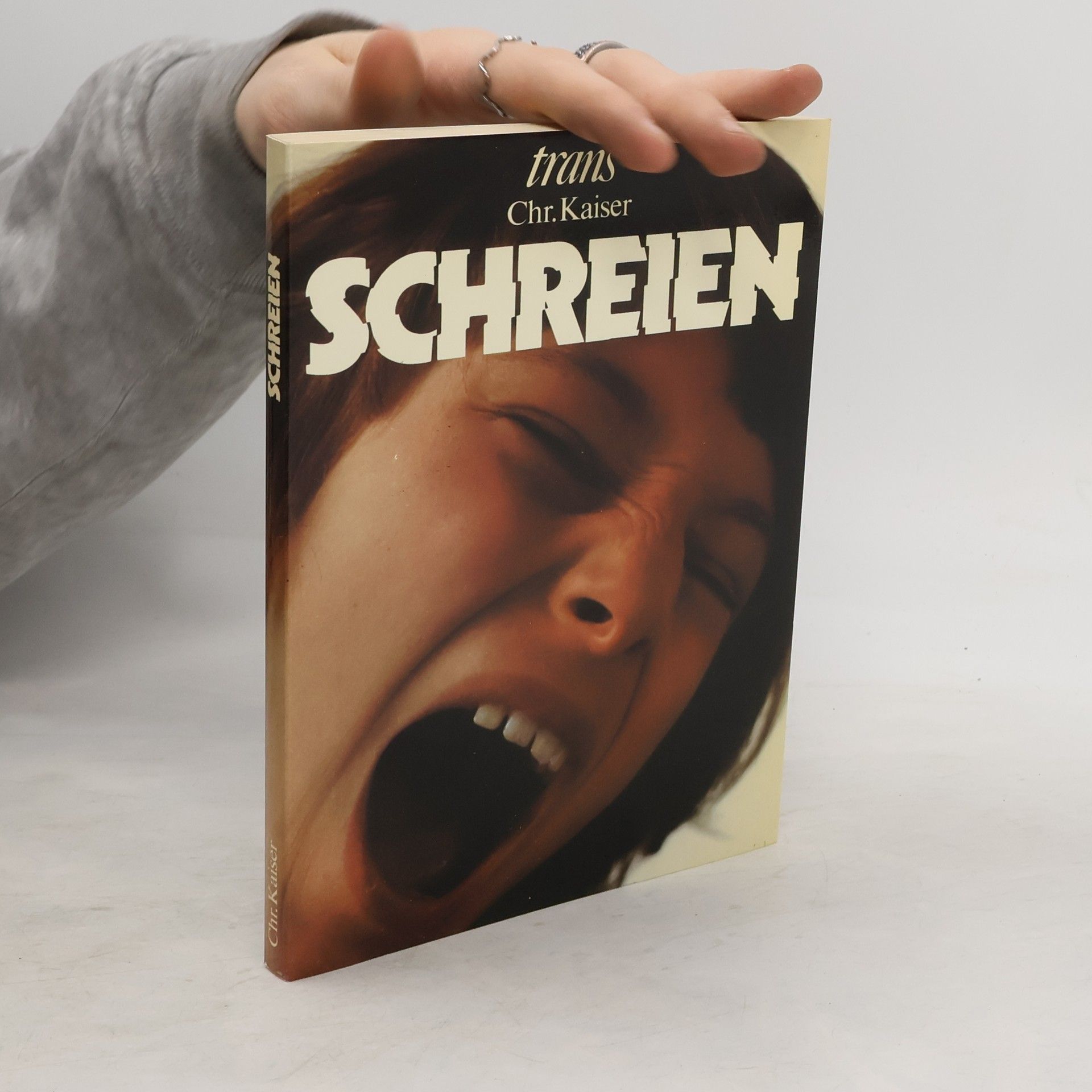
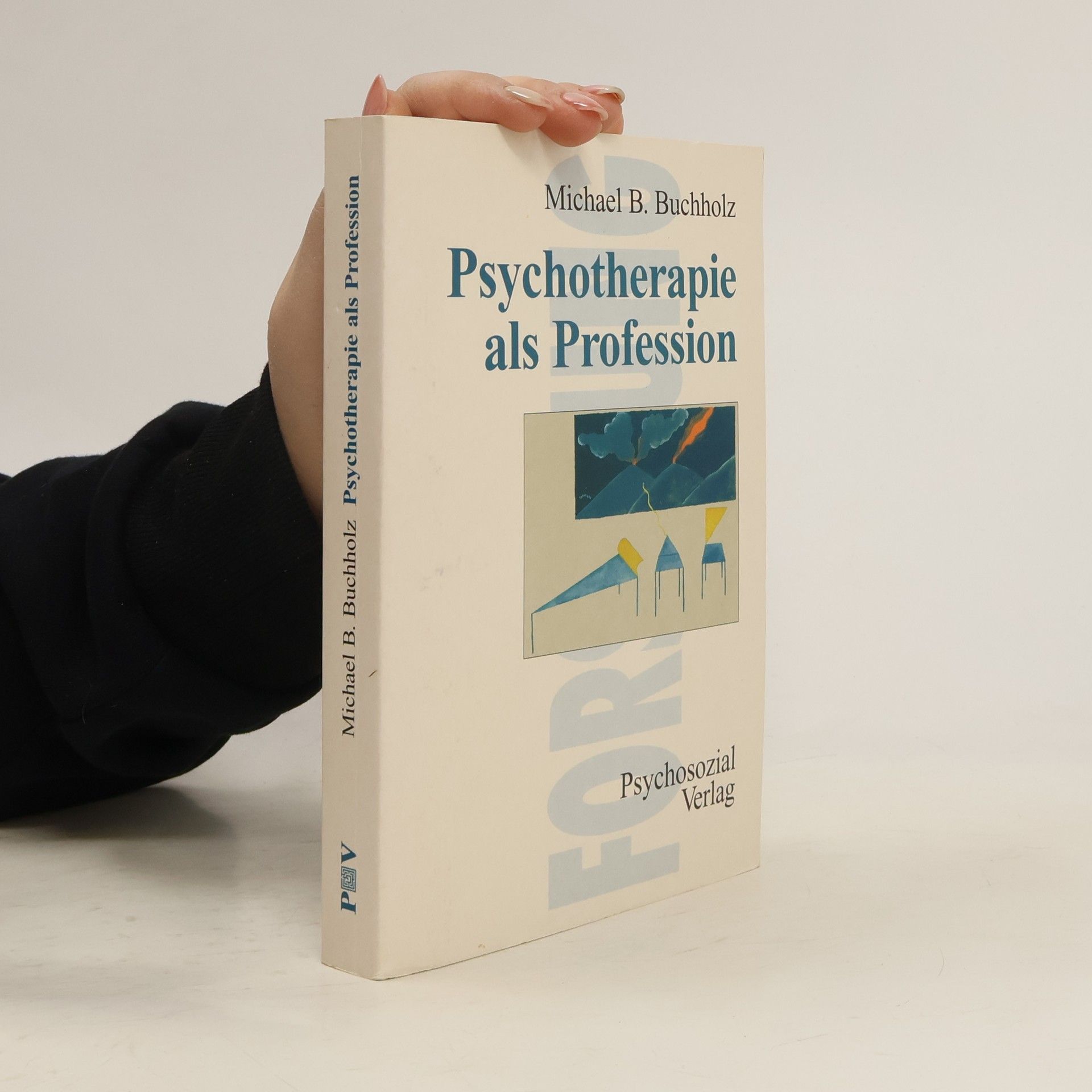
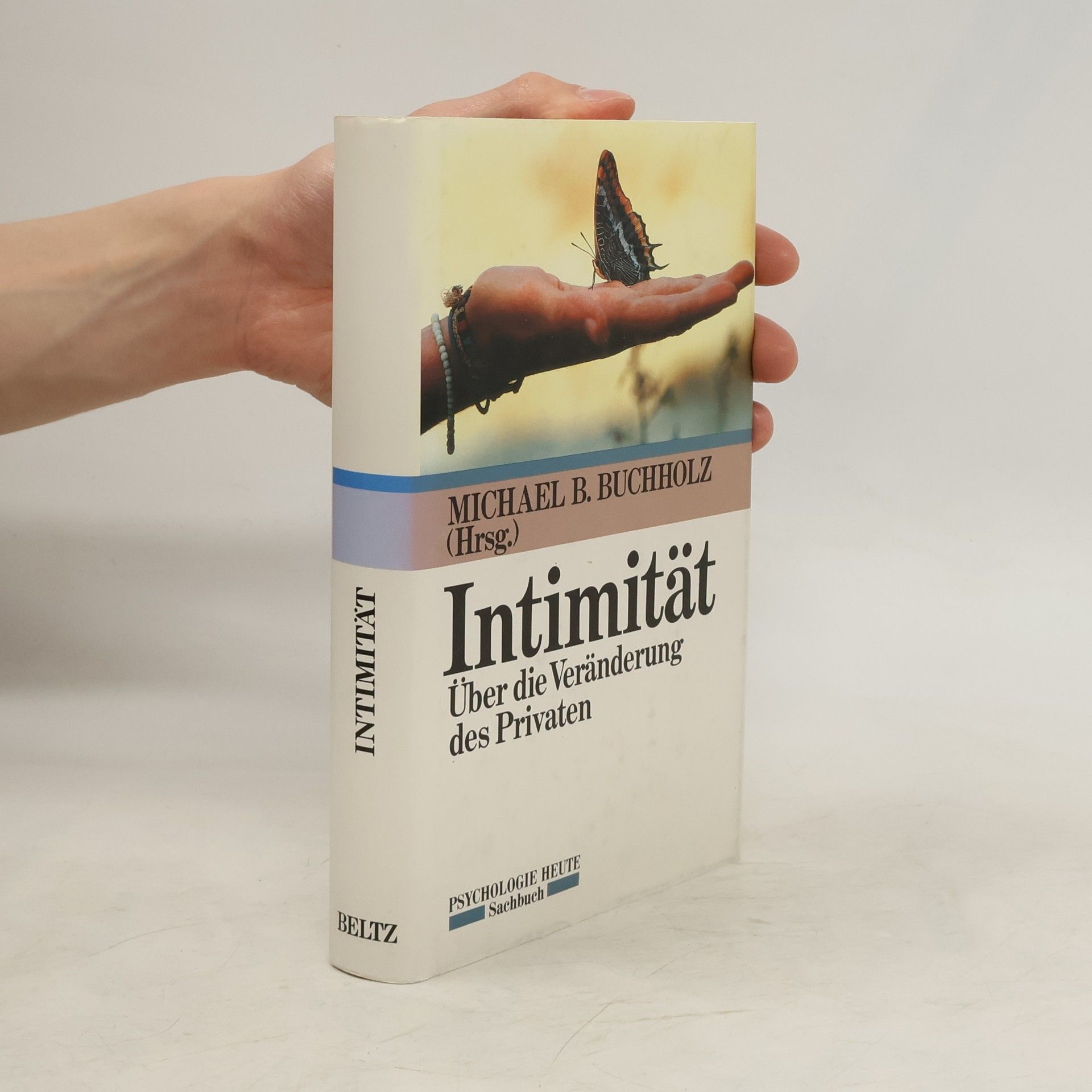
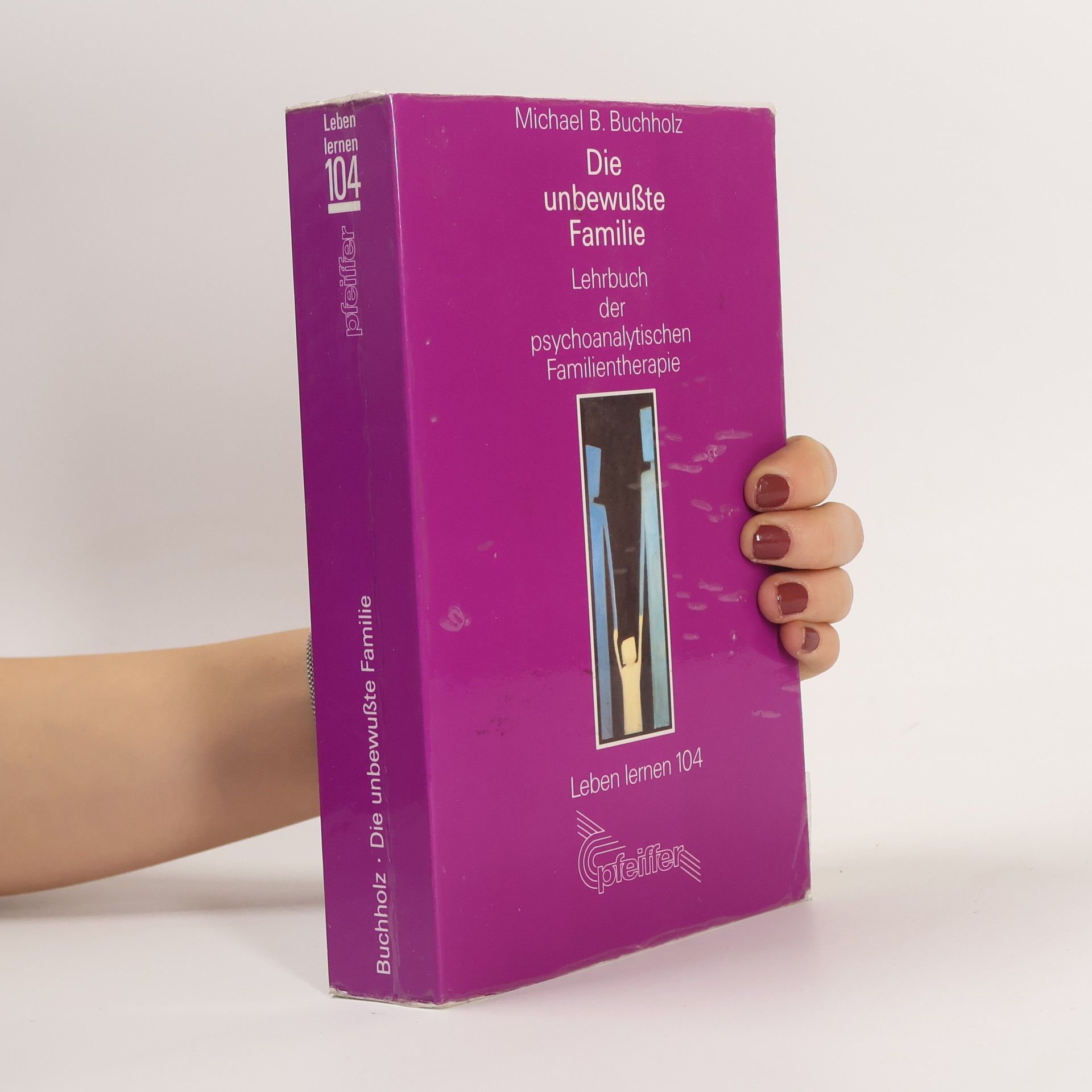

Die liberale Studentenkorporation. Freie Wissenschaftliche Vereinigung 1881–1933. Eine Textedition nebst Anmerkungen zu Otto Dibelius und einem Aufsatz zu Georg Friedrich Nicolai und Kurt Hiller
Implizite Dimensionen im psychotherapeutischen Geschehen
Entscheidende therapeutische Veränderungsprozesse vollziehen sich auf eine unserem Bewusstsein nur schwer zugängliche Weise. Jede Anpassung an Lebensumstände hängt fundamental von impliziten, nicht bewussten, präreflexiven und automatisierten Prozessen ab, die jenseits des Denkens und der Sprache liegen. Deshalb ist in den letzten Jahrzehnten das implizite Beziehungswissen immer stärker ins Blickfeld der interdisziplinären Forschung geraten. Es erweist sich als Bindeglied zwischen Psychologie und Biologie. Aus Sicht der Psychoanalyse, der Bioenergetischen Analyse und der Analytischen Körperpsychotherapie arbeiten die Beiträger unterschiedliche Zugänge und Facetten des Impliziten als verkörperte Beziehungsdimension heraus. Dabei berücksichtigen sie unter anderem die Neurowissenschaften, die Säuglingsforschung und die neuropsychologische Gedächtnisforschung. Mit Beiträgen von Michael B. Buchholz, Jörg Clauer, Peter Geißler, Sebastian Leikert, André Sassenfeld, Maria Steiner Fahrni und Thomas Stephenson
Erfahrungen verschiedener Professionen
Auseinandersetzungen in Philosophie, Medizin und Psychoanalyse
Der Autor vertritt pointiert und theoretisch ambitioniert eine neue Sichtweise in der Psychotherapieforschung. Ihn treibt die Sorge, der psychotherapeutischen Profession könne gerade durch übermächtige Verwissenschaftlichung der lebendige Geist ausgetrieben werden. Die Autonomie der psychotherapeutischen Profession begründet zu bewahren ist das Anliegen dieses Buchs. Michael B. Buchholz ist Psychoanalytiker und Familientherapeut, leitender Mitarbeiter in einer großen psychotherapeutischen Klinik und Professor am Fachbereich Sozialwissenschaft der Universität Göttingen.
Qualitative Studien zu Konversation und Metapher, Geste und Plan
Ziel methodisch geleiteter wissenschaftlicher Anstrengungen ist hier deshalb nicht die Erzeugung irgend eines positiven Wissens -ein Punkt ubrigens, in dem sich knallharte Empiriker nicht von den Dogmatikern des UnbewuBten unter scheiden. Beide. scheinen immer schon positiv zu wissen, was „los“ ist. Ziel ist umgekehrt vielmehr, etwas sichtbar zu machen, was mit methodisch unbewaffnetem Auge sich nicht zeigt. Etwas Neues oder das Alte neu zu se hen, das wird auch Leserin oder Leser einbeziehen und verandern. Zumindest in dem Sinne, als Standortwechsel erzwungen werden, Irritationen auftreten ob der Vielfalt all dessen, was in einem Text steckt. Polyzentrisch denken also mit methodischer Absicherung; nicht aus Schwache, sondern um der Eindimensio nalitat zu entgehen. Lassen Sie sich also von den Autoren dieses Buches methodisch Landkarten an die Hand geben, um immer wieder das Territorium desselben Gespraches zu durchschreiten. Jede Karte wird eine andere Landschaft zeigen, andere Schnei sen durch den Dschungel weisen. Die Lektlire wird sich nicht lohnen, wenn man erwartet, am Ende zu wissen, was in diesem psychotherapeutischen Gesprach „los“ war, aber sie wird sich fUr den lohnen, der einen Zugewinn an Perspektiven erhofft, einen Reichtum an Tiefe, fUr dessen Integration es mehr als zweier Augen bedarf.
Das Sachbuch beleuchtet kritisch das Schreien und seine Bedeutung innerhalb unserer Gesellschaft, Kultur und den Medien. Es werden Themen wie zum Beispiel therapeutisches Schreien, zugelassenes Schreien, Schreien im Krankenhaus und das Schreien in der Geschichte behandelt.