Kleines Lexikon der ethnischen Minderheiten in Deutschland
- 253 Seiten
- 9 Lesestunden

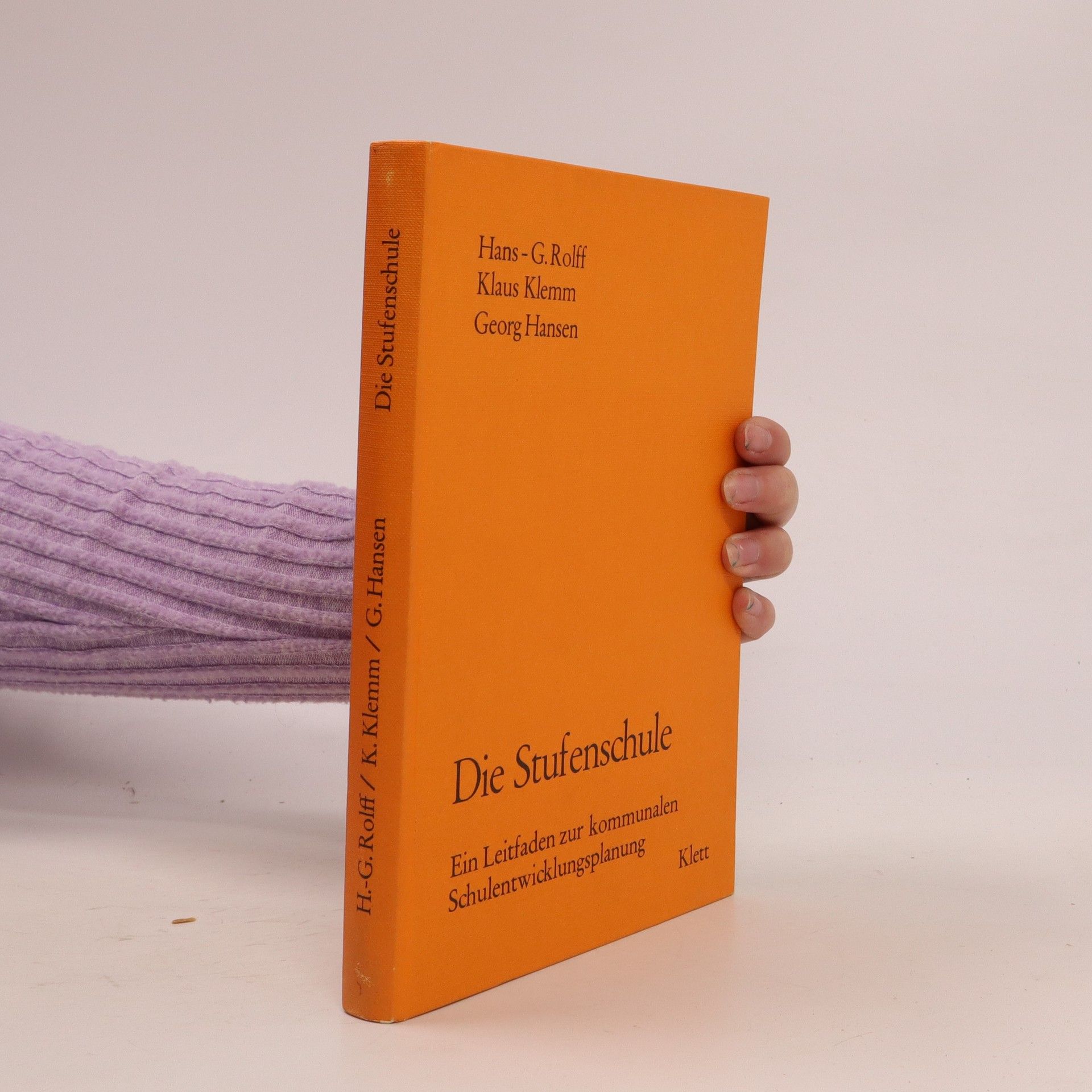

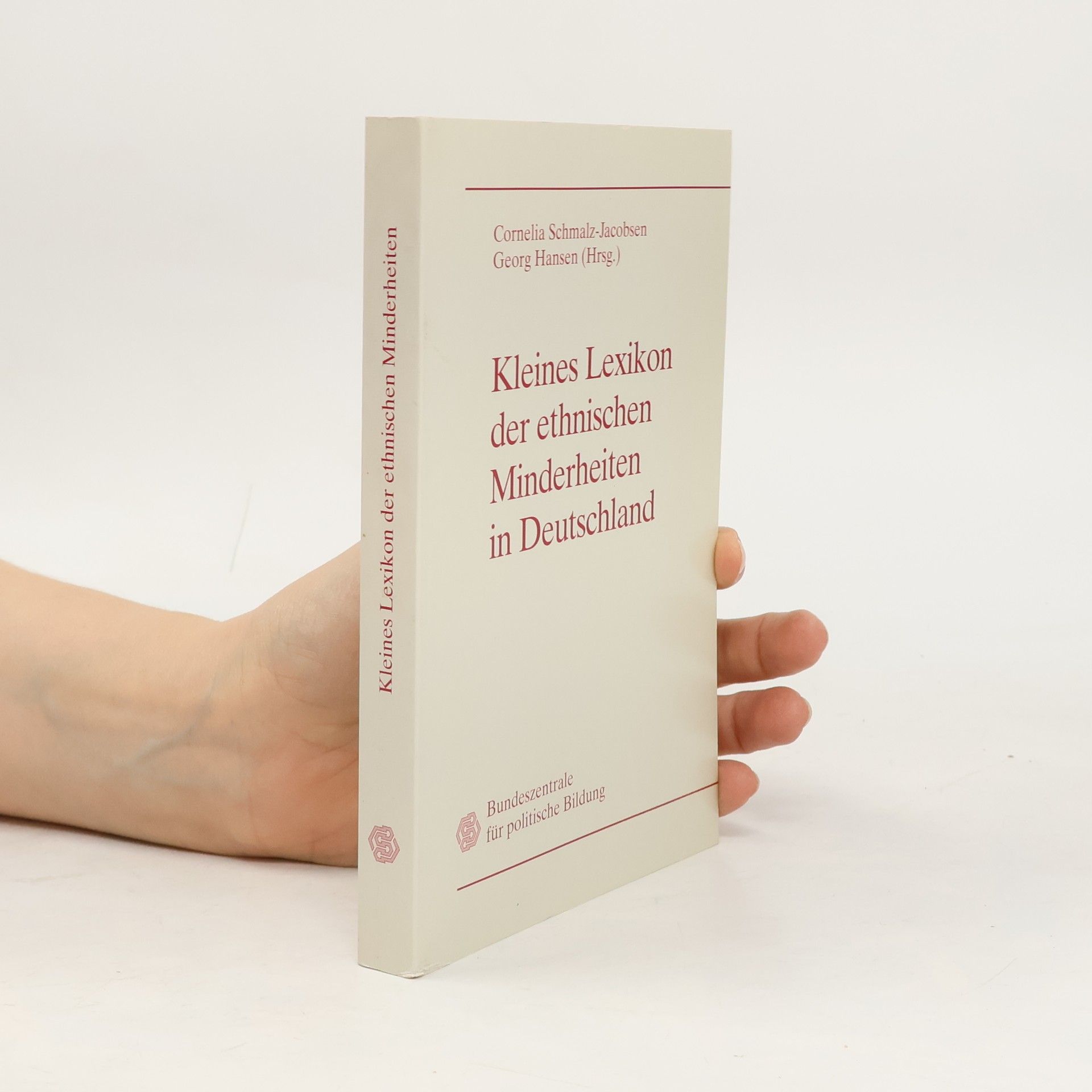
Die Diskussion um Einwanderung oder Zuwanderung, Green Card und „Kinder statt Inder“, Rentensicherung durch Arbeitskräfteeinfuhr oder „das Boot ist voll“ wird überwiegend tagesaktuell geführt. Den Diskutanten ist häufig der historische Kontext, in dem sie sich bewegen weder bewusst noch bekannt. Ein Blick auf die Wurzeln des geltenden Staatsangehörigkeitsrechts und dessen Konsequenzen für die Diskussion um Einwanderung kann dabei helfen, über der Tagesaktualität nicht die langfristige Perspektive zu verlieren. Ethnie/Ethnizität und Kultur sind zu zentralen und gängigen Kategorien in diesen Diskussionen geworden – was nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass die Kategorie Rasse seit einigen Jahrzehnten in der Bundesrepublik nicht nur als anrüchig, sondern auch als wissenschaftlich unbrauchbar angesehen wird. Differenz wird mit Hinweis auf die Kultur bzw. den ethnischen Hintergrund als erklärt betrachtet. Die Popularität der Kategorien enthebt uns gewissermaßen der Notwendigkeit genauer hinzusehen. Vor dem Hintergrund einer inflationierten Verwendung ungeklärter Begriffe in Wissenschaft, Politik und Medien versucht der Autor, den Begriff Ethnie zu klären, die Funktion von Ethnizität zu umreißen, Formen der Ethnisierung darzustellen und schließlich das historisch gewordene völkische Staatsverständnis in der Bundesrepublik zu untersuchen.