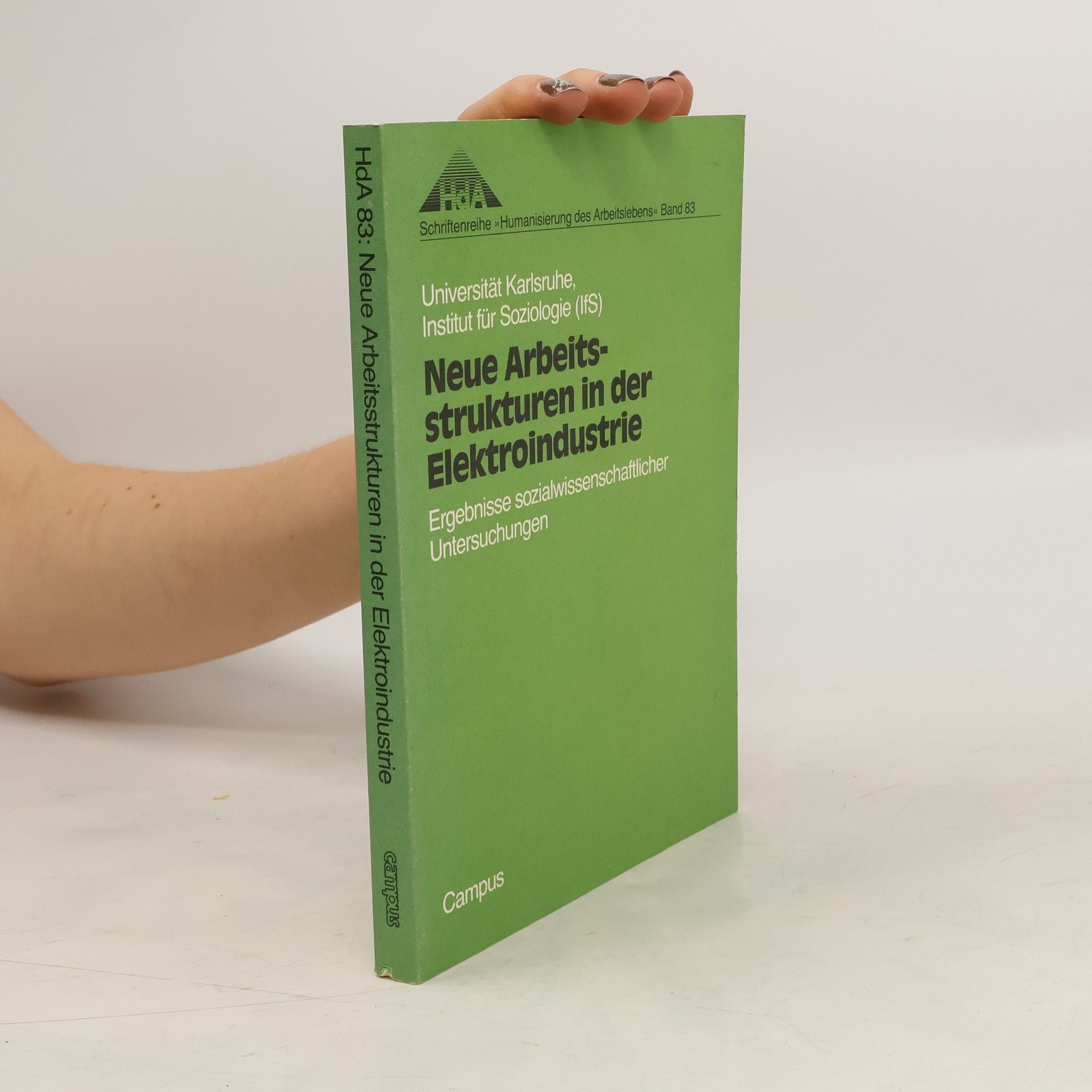Post bedeutet Nachrichtenbeförderung und war stets mit Geschwindigkeit verbunden. Vom Landweg kam man sehr bald zum Weg über Wasser und durch die Luft. Keineswegs reibungslos verlief die Abstimmung der aufkommenden Luftfahrt mit den Anforderungen der Postbehörden. Die Bühne lieferten Flugshows in Verbindung mit ersten Postflügen mit unterschiedlichem Erfolg. Das Buch gibt einen internationalen Überblick über deren Charakteristiken vor dem Ersten Weltkrieg. Es ist sowohl an Luftfahrthistoriker als auch an Aerophilatelisten gerichtet. Eine Innovation war die „Flugpost am Rhein und am Main“ im Juni 1912, veranstaltet von der Großherzogin von Hessen und bei Rhein. Hier gelang es erstmals, Post per Luftschiff und Flugzeug im allgemeinen Postweg zu befördern. Über alle Briefkästen einer Region konnten Flugpostkarten für den weltweiten Postverkehr eingeliefert werden. Flugpionier August Euler war die treibende Kraft für eine allgemeine Luftpost. Das vorliegende Sachbuch versucht die Hintergründe, auch anhand von nicht bekannten Quellen, aufzuzeigen und philatelistischen Fragen nachzugehen. Die „Flugpost am Rhein und am Main“ gilt als Vorbild für die Entwicklung der Luftpost, auch nach den beiden Weltkriegen.
Hanns Peter Euler Bücher