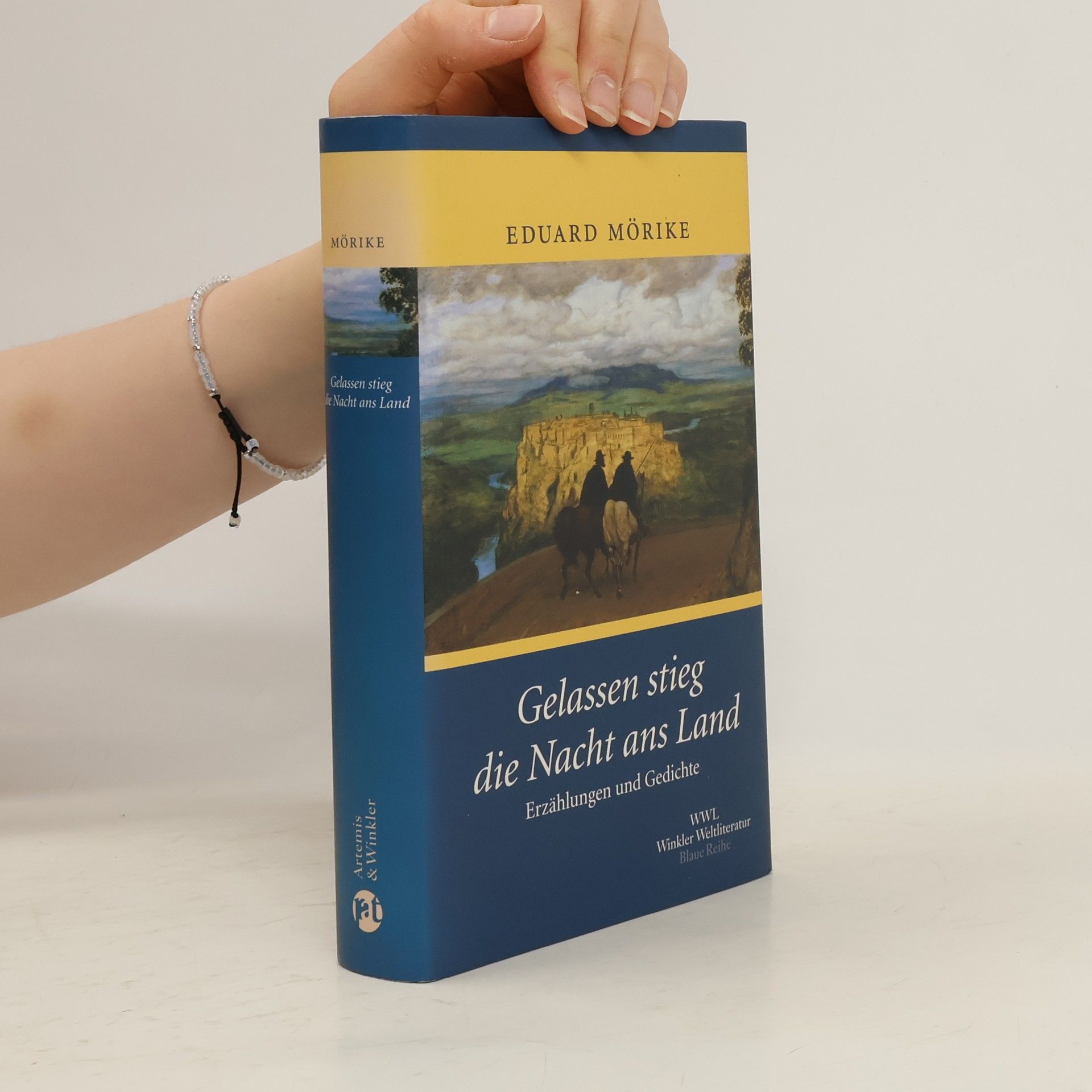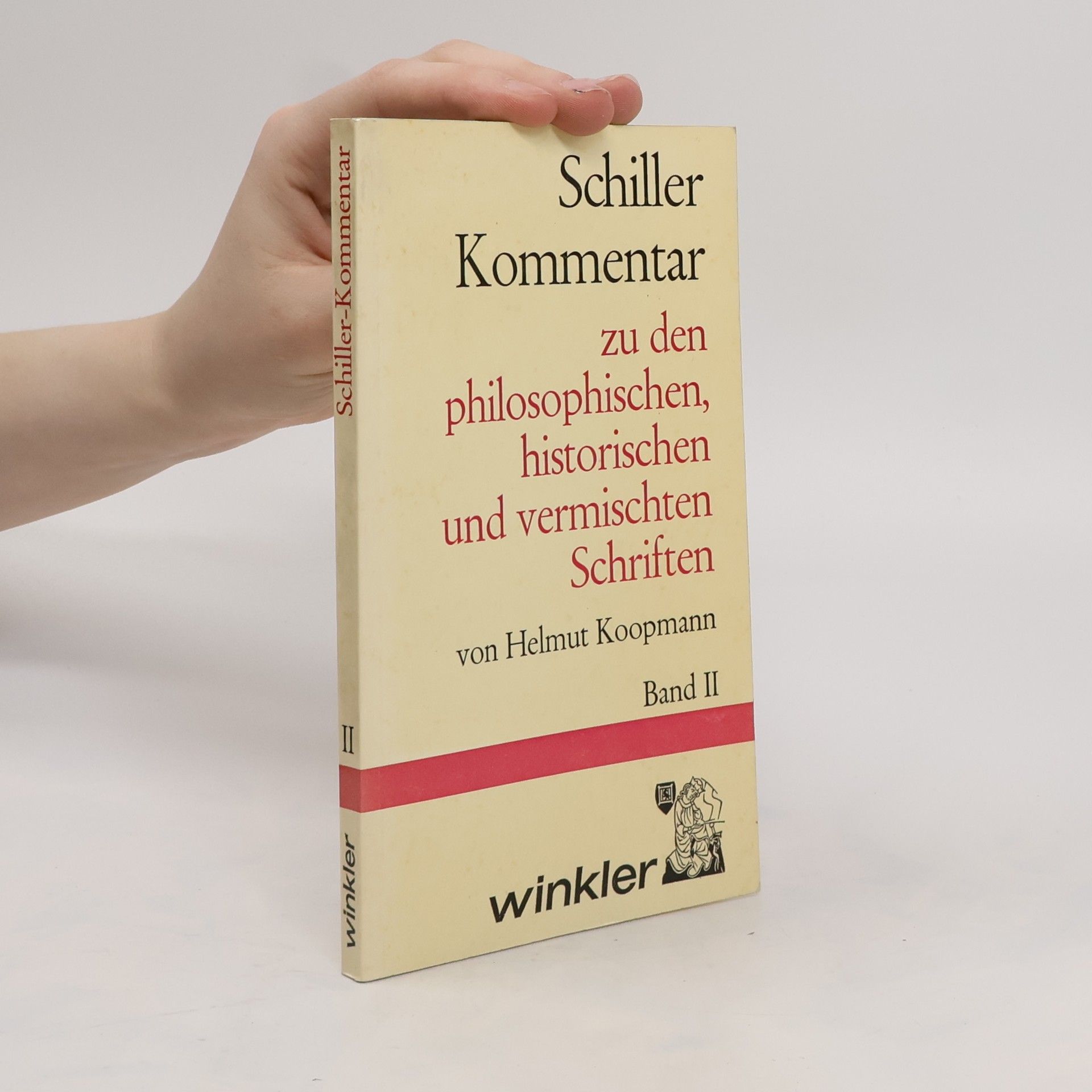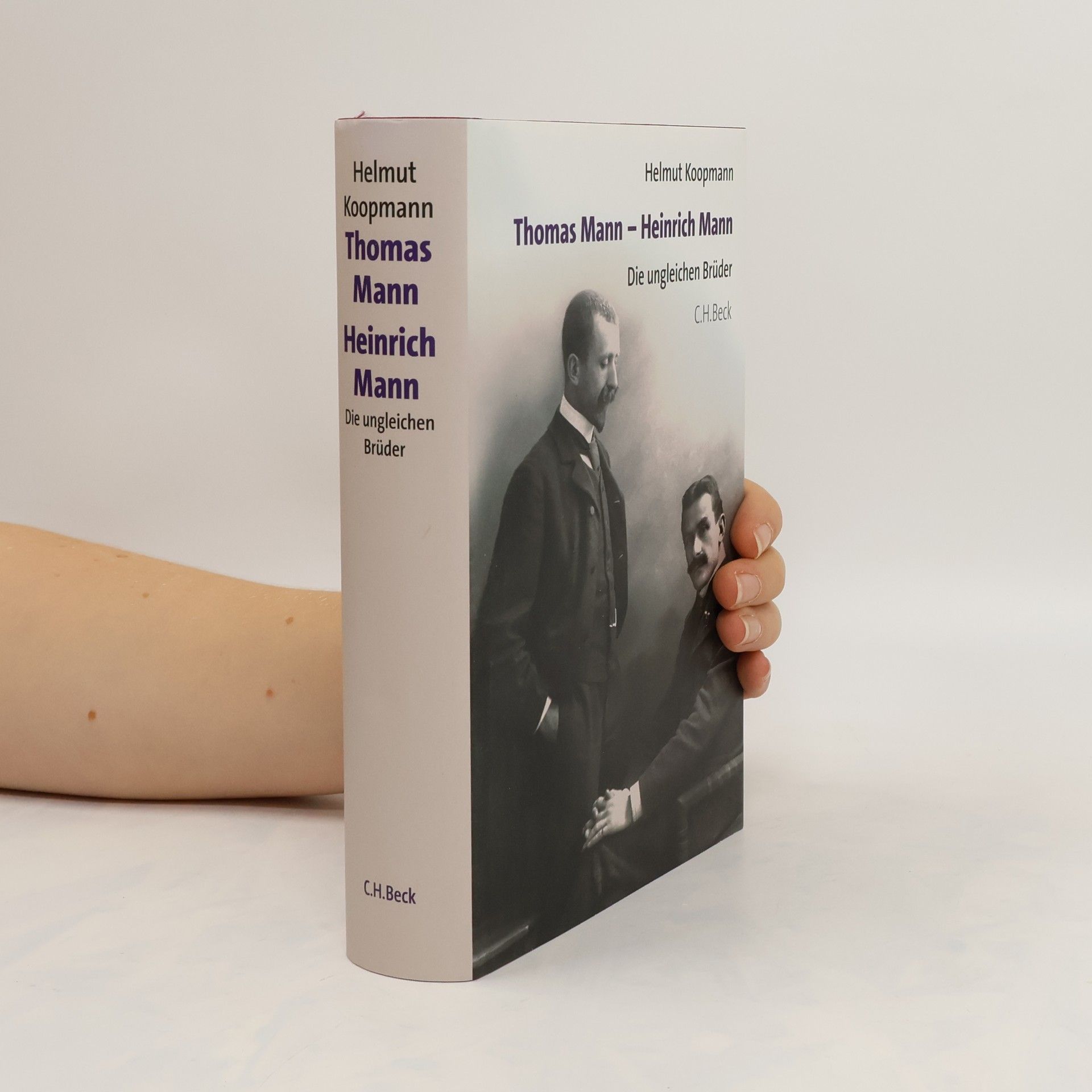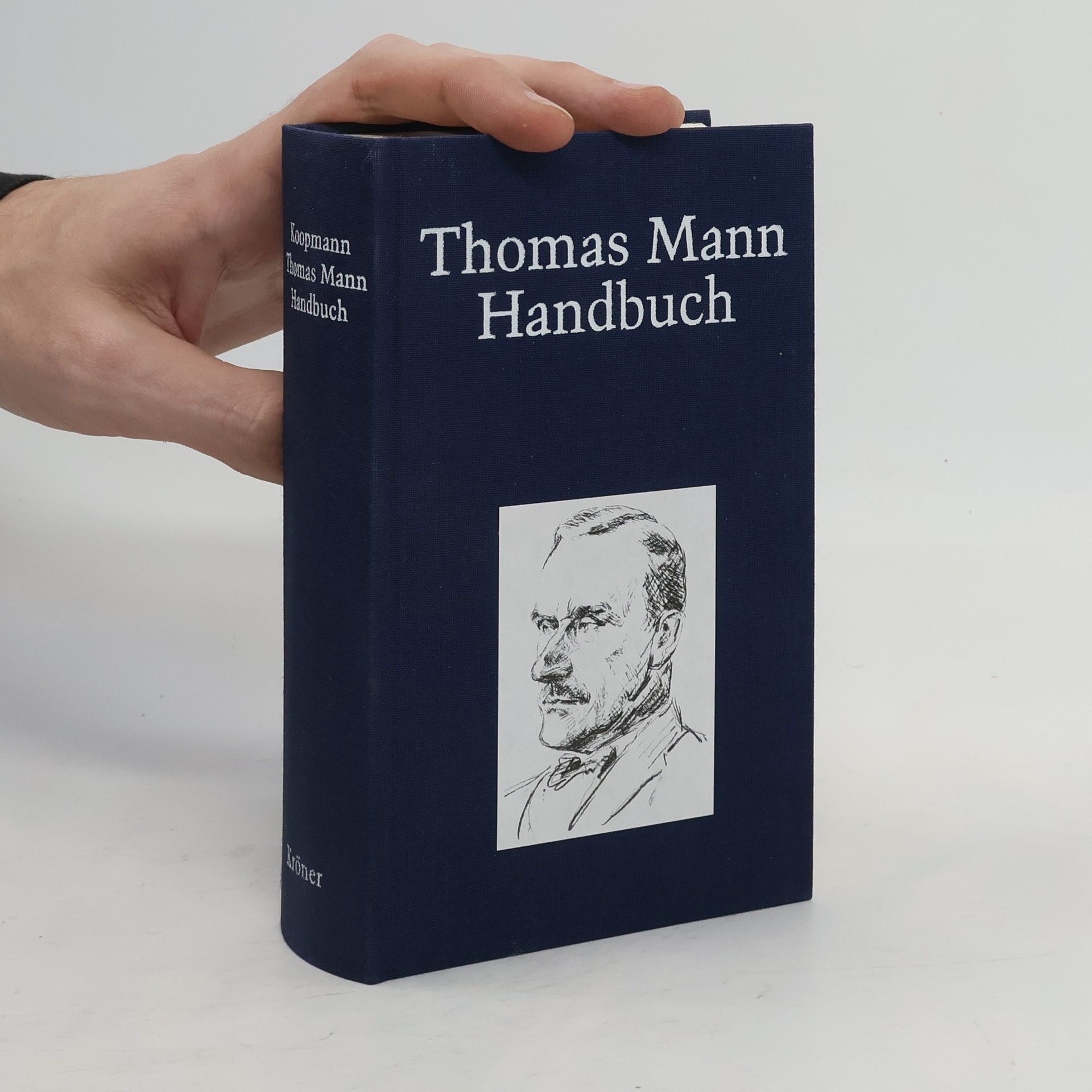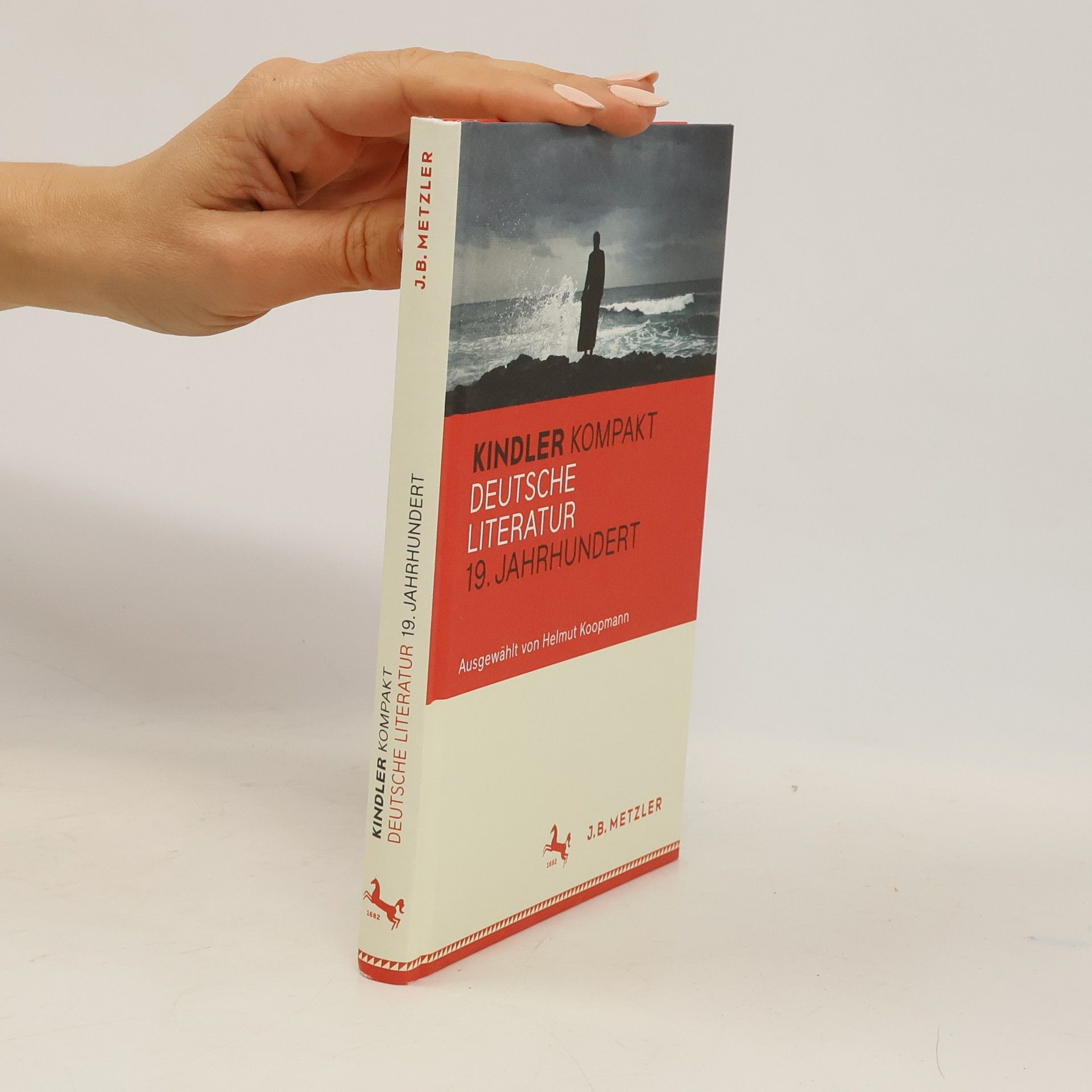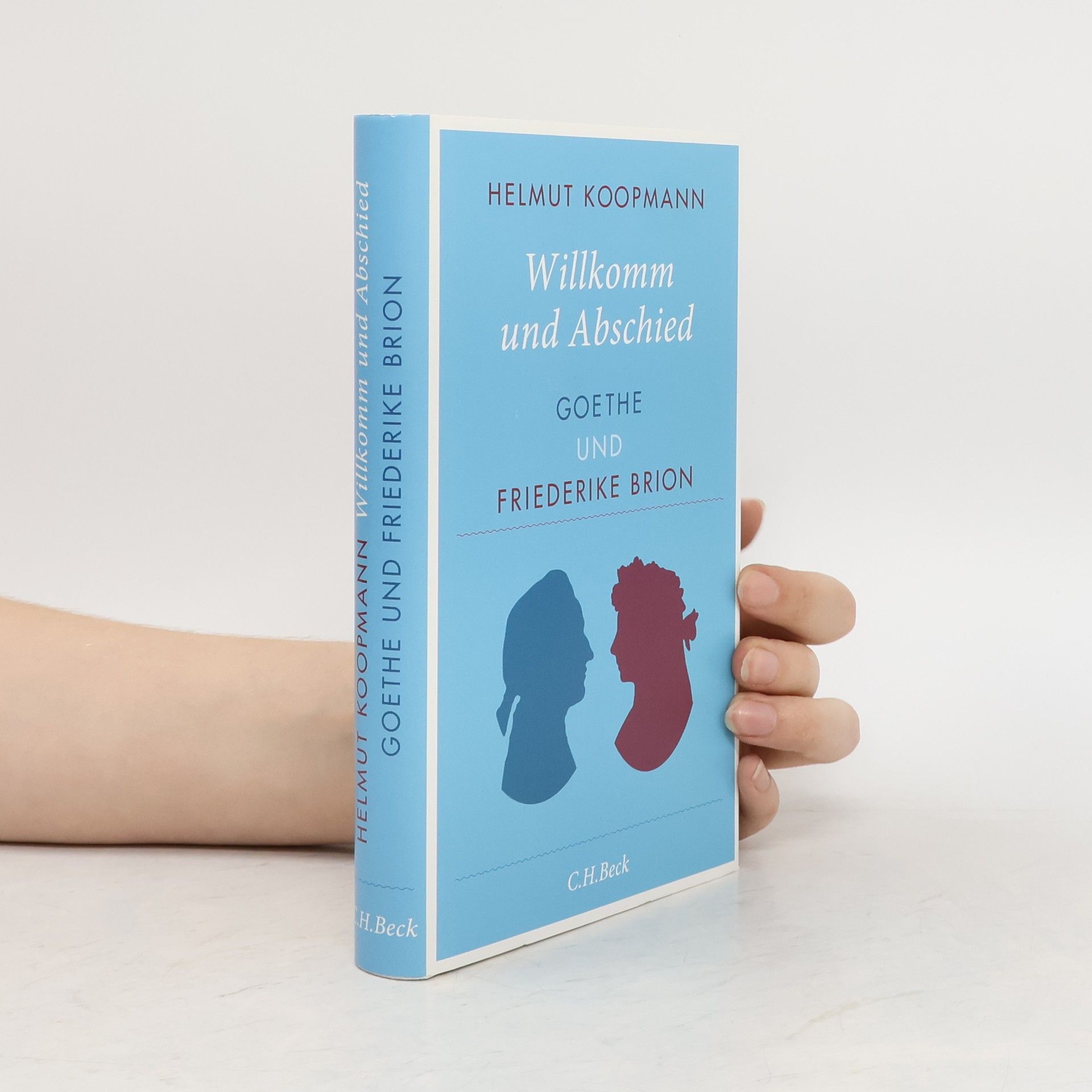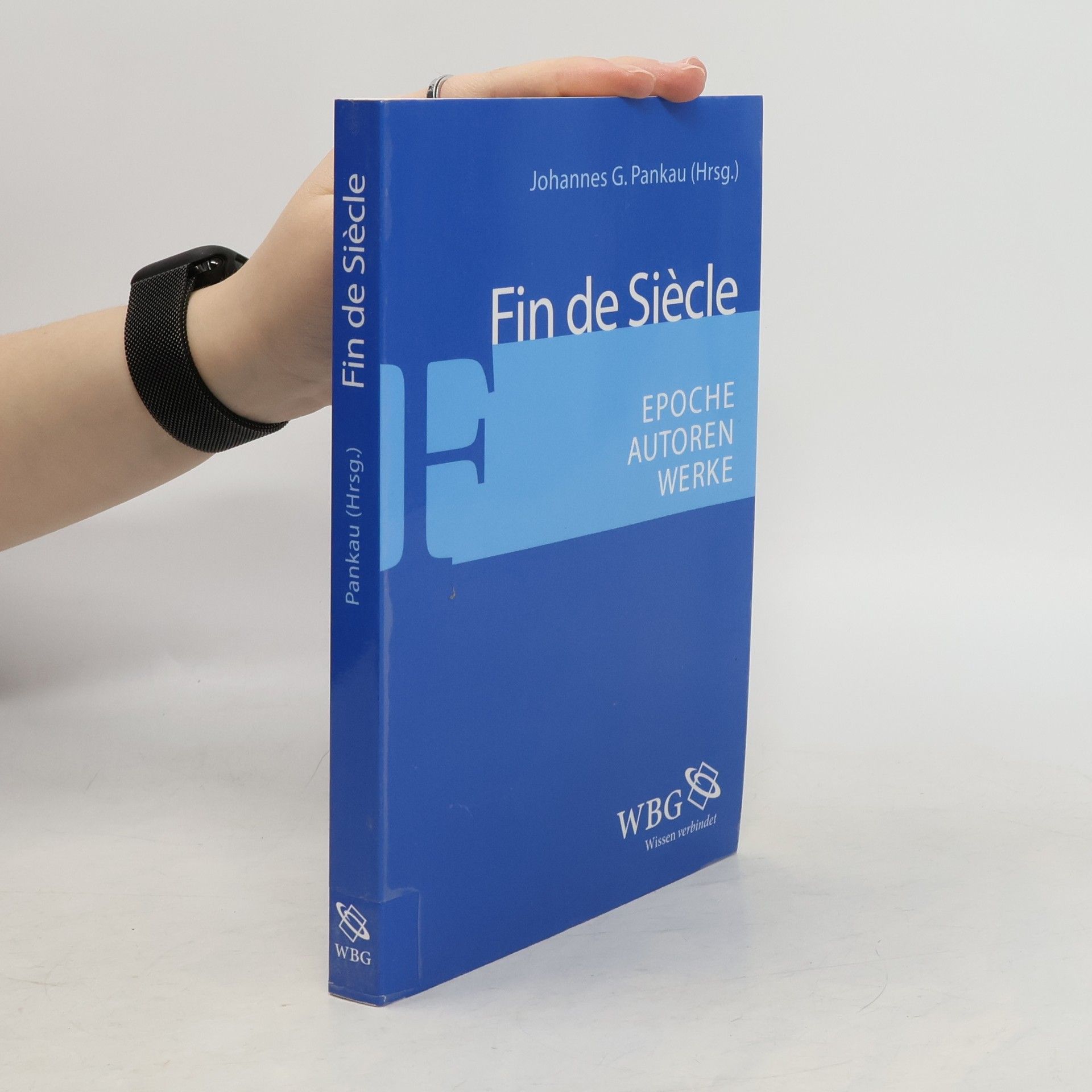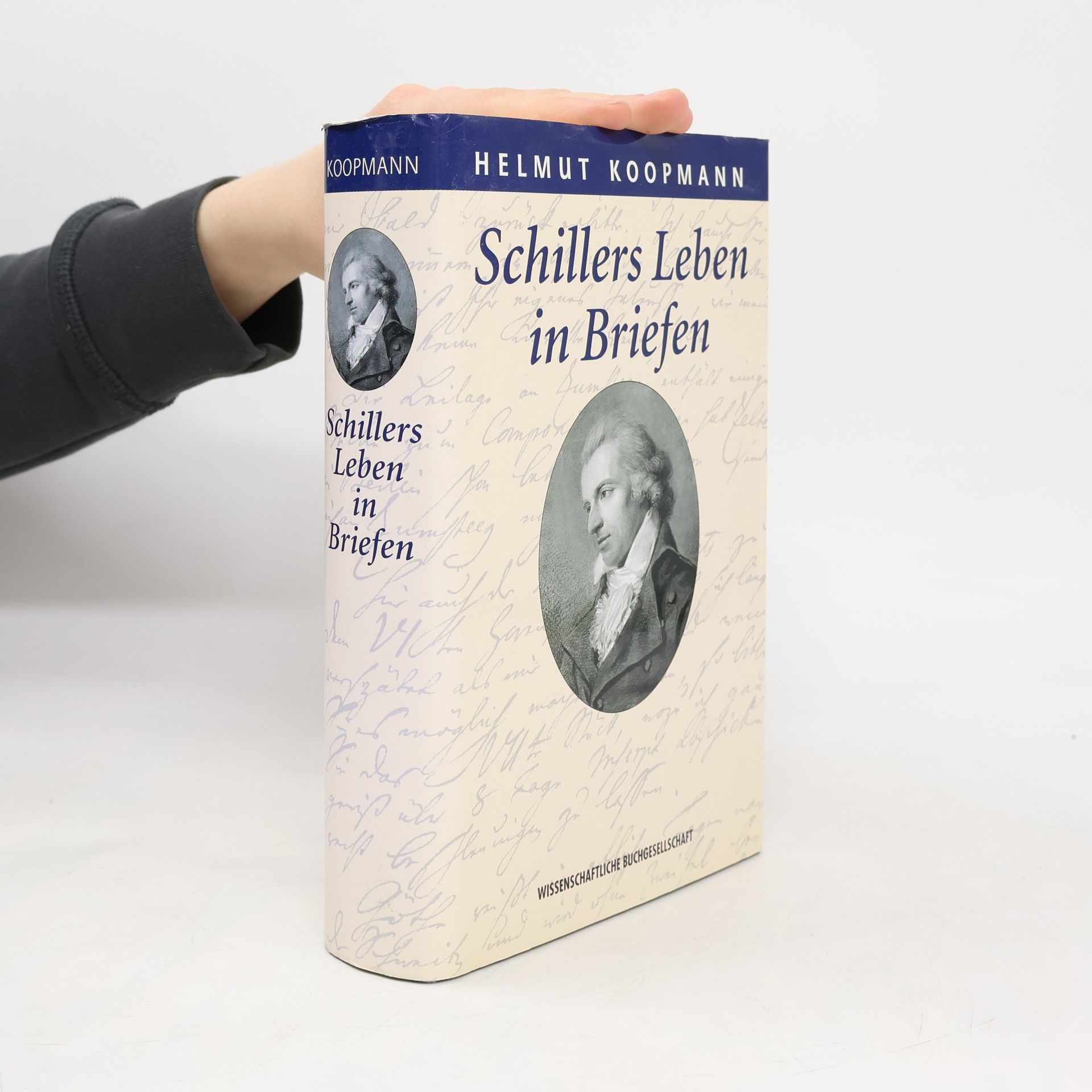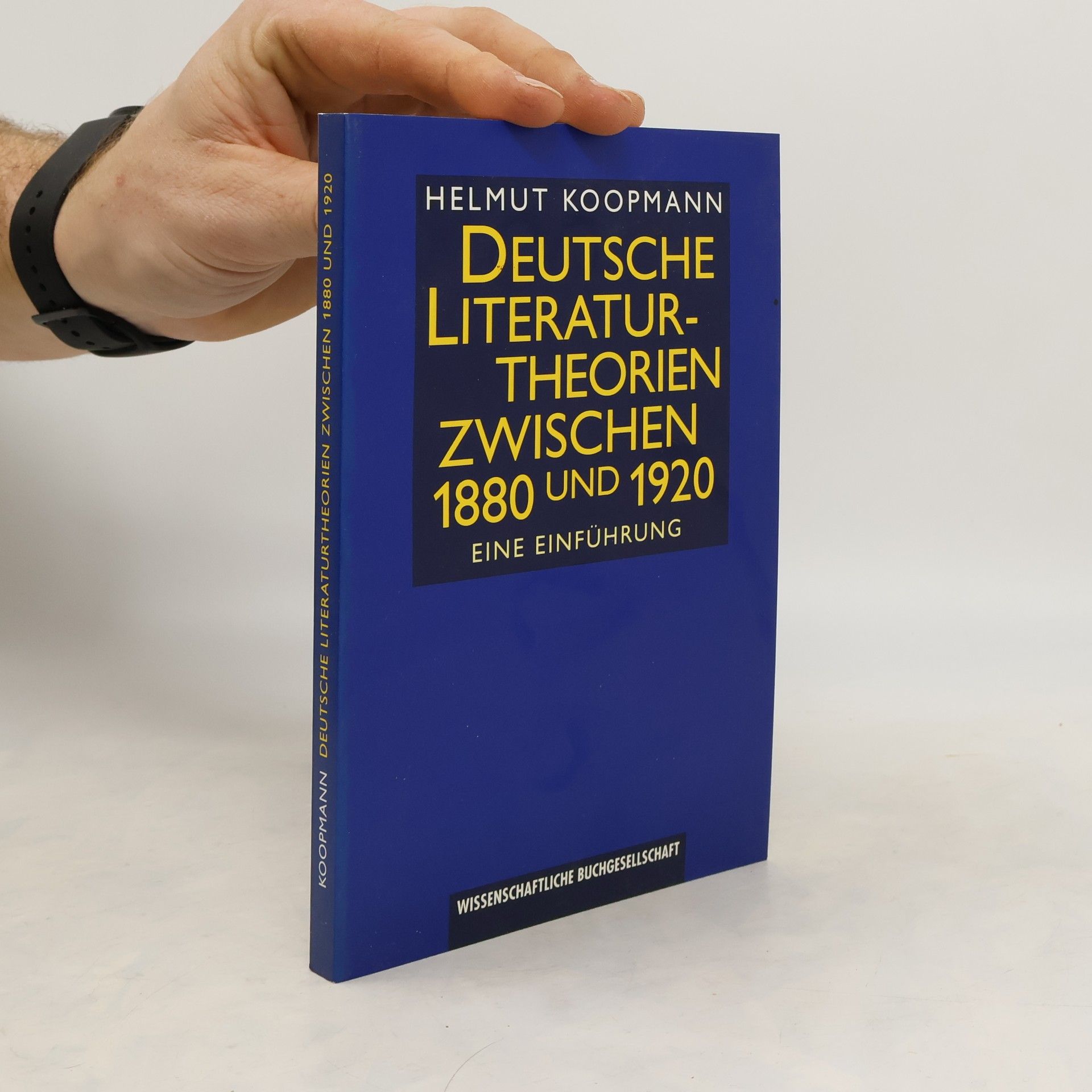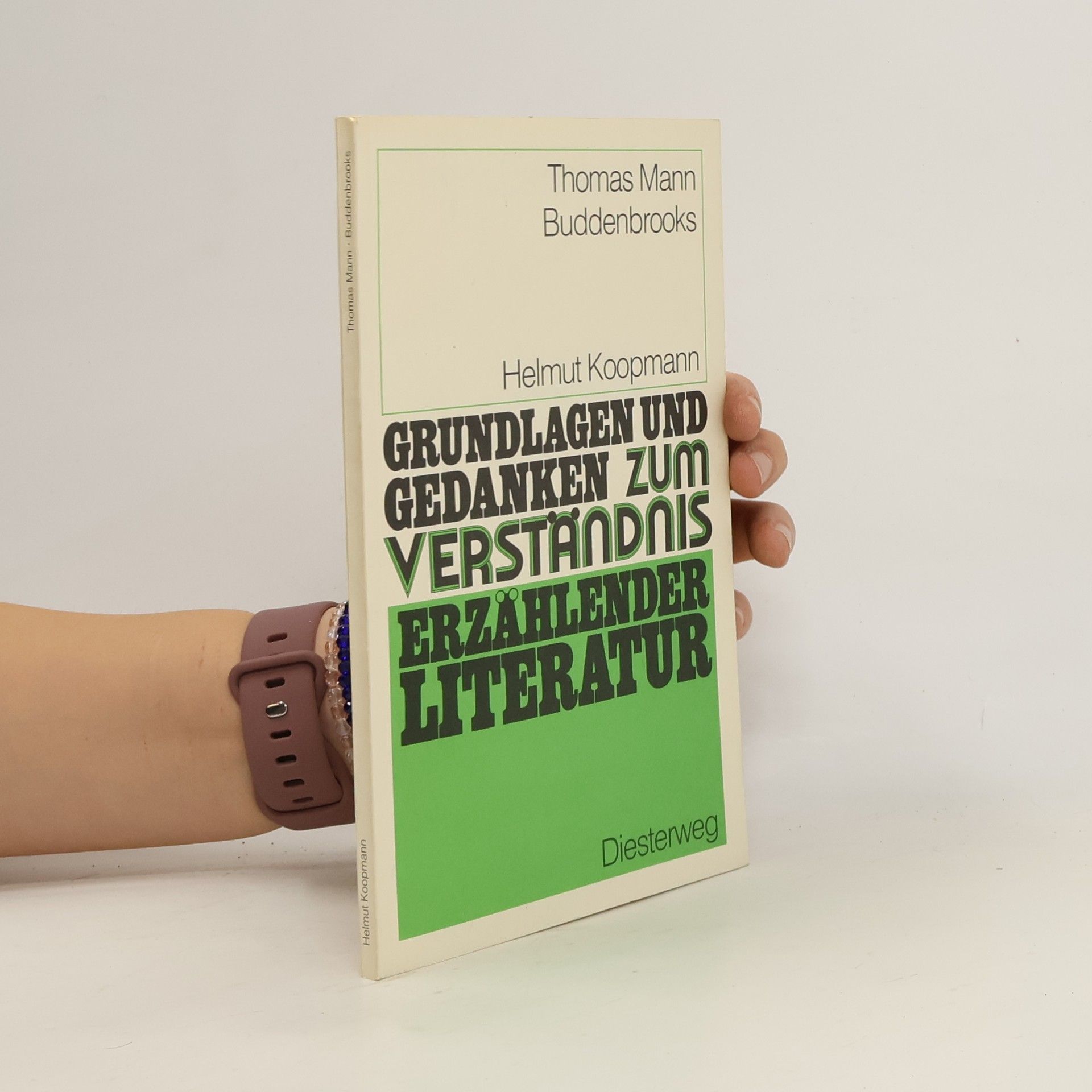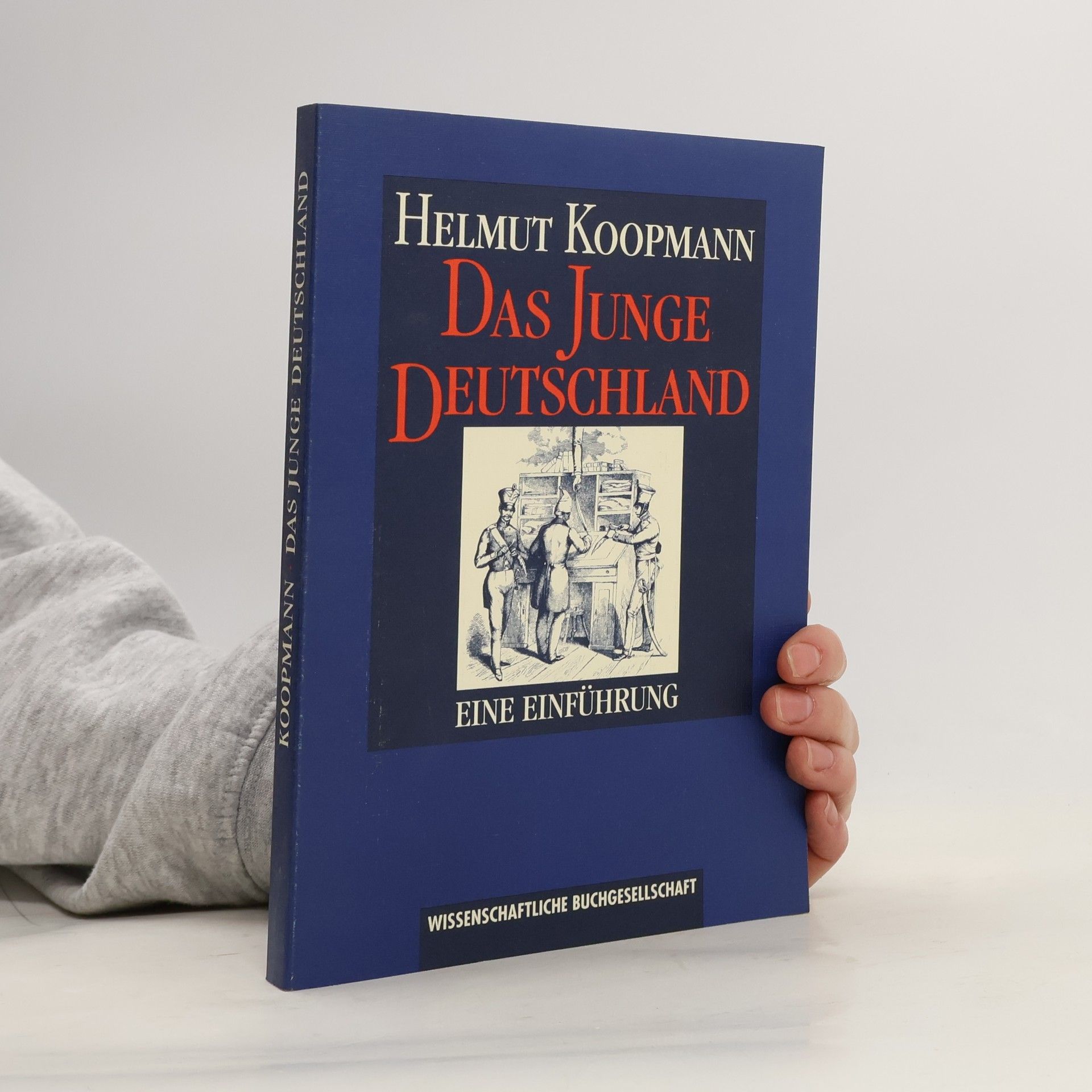Kindler kompakt Deutsche Literatur, 19. Jahrhundert
- 186 Seiten
- 7 Lesestunden
Die Kindler Kompakt Bände präsentieren in handlicher Form die 30 - 40 wichtigsten Autoren udn Werke einer Literatur eines Jahrhunderts. Auf 192 Seiten werden sie vorgestellt. Dazu gibt es eine kompakte Einleitung des Herausgebers. Hier werden die Epochen verortet, die großen Linien gezogen, das Wesentliche zusammengefasst. Das alles handlich und in schöner Form, zweifarbige Gestaltung, lesbarer Satz. Schöne literarische Begleiter in allen Lebenslagen - wer Klassiker kauft, wird von Kindler Kompakt begeistert sein!