Stärkung der Forschung durch Datenschutz
- 94 Seiten
- 4 Lesestunden
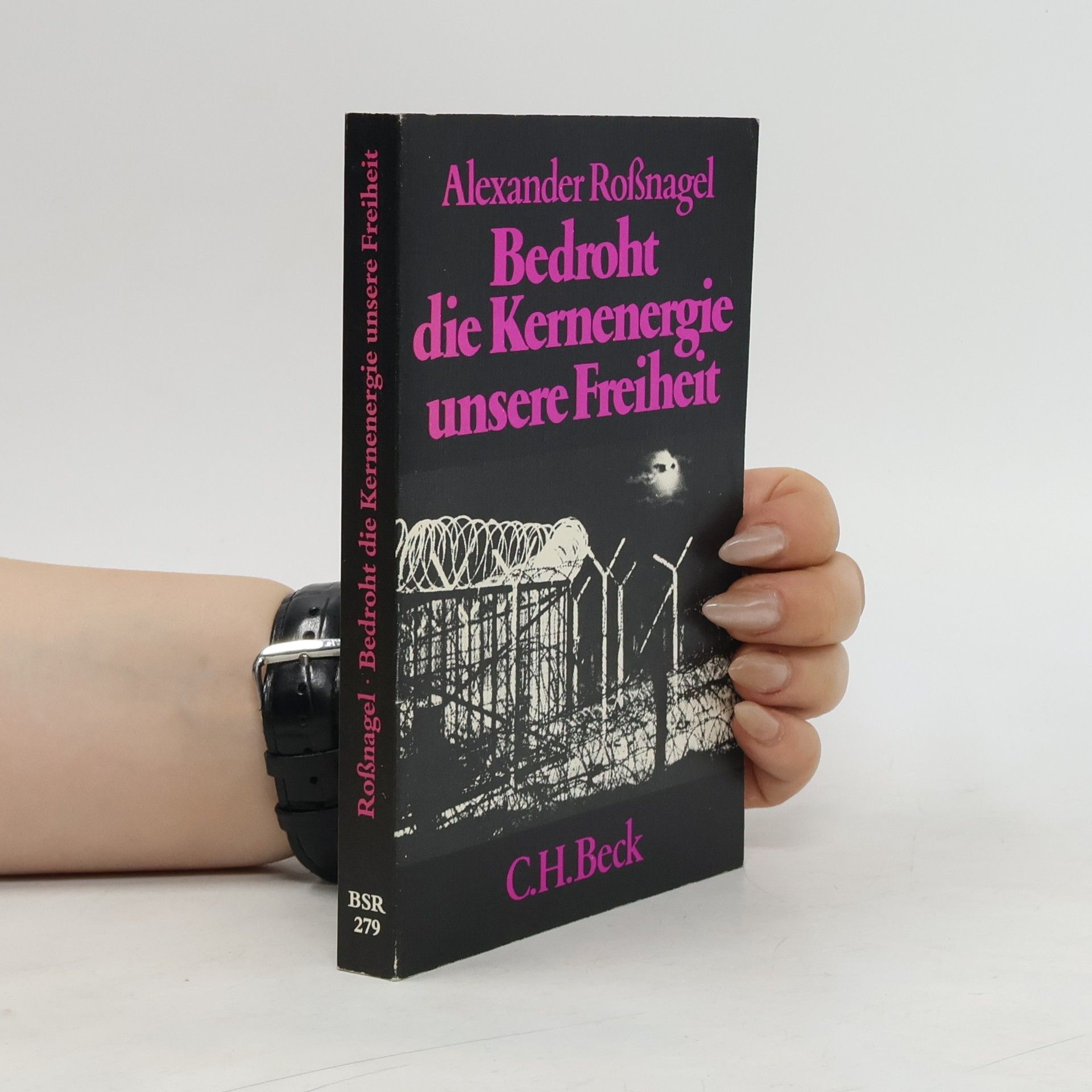


Analysen und Empfehlungen zum Schutz der Grundrechte in der digitalen Welt
Die in diesem Open-Access-Buch zusammengeführten interdisziplinären Untersuchungen des „Forums Privatheit“ gehen der Frage nach, wie sich die Verwirklichungsbedingungen von Privatheit und Selbstbestimmung durch die Digitalisierung aller Lebensbereiche radikal ändern. Nahezu jede Lebensregung hinterlässt Datenspuren, ermöglicht vielfältige und intensive Datensammlungen über Menschen, unterstützt Verhaltensbeeinflussungen und verstärkt Ungleichgewichte in der Informationsmacht. Es analysiert die Auswirkungen der Digitalisierung auf den rechtlichen und politischen Schutz der Grundrechte, die ökonomischen Beziehungen, die gesellschaftliche Integration und die individuelle Entfaltung. Das Buch zeigt aber auch auf, wie Digitalisierung und ihre gesellschaftlichen Rahmenbedingungen technisch, sozial, ökonomisch und rechtlich gestaltet werden können, um Privatheit und Selbstbestimmung zu schützen.