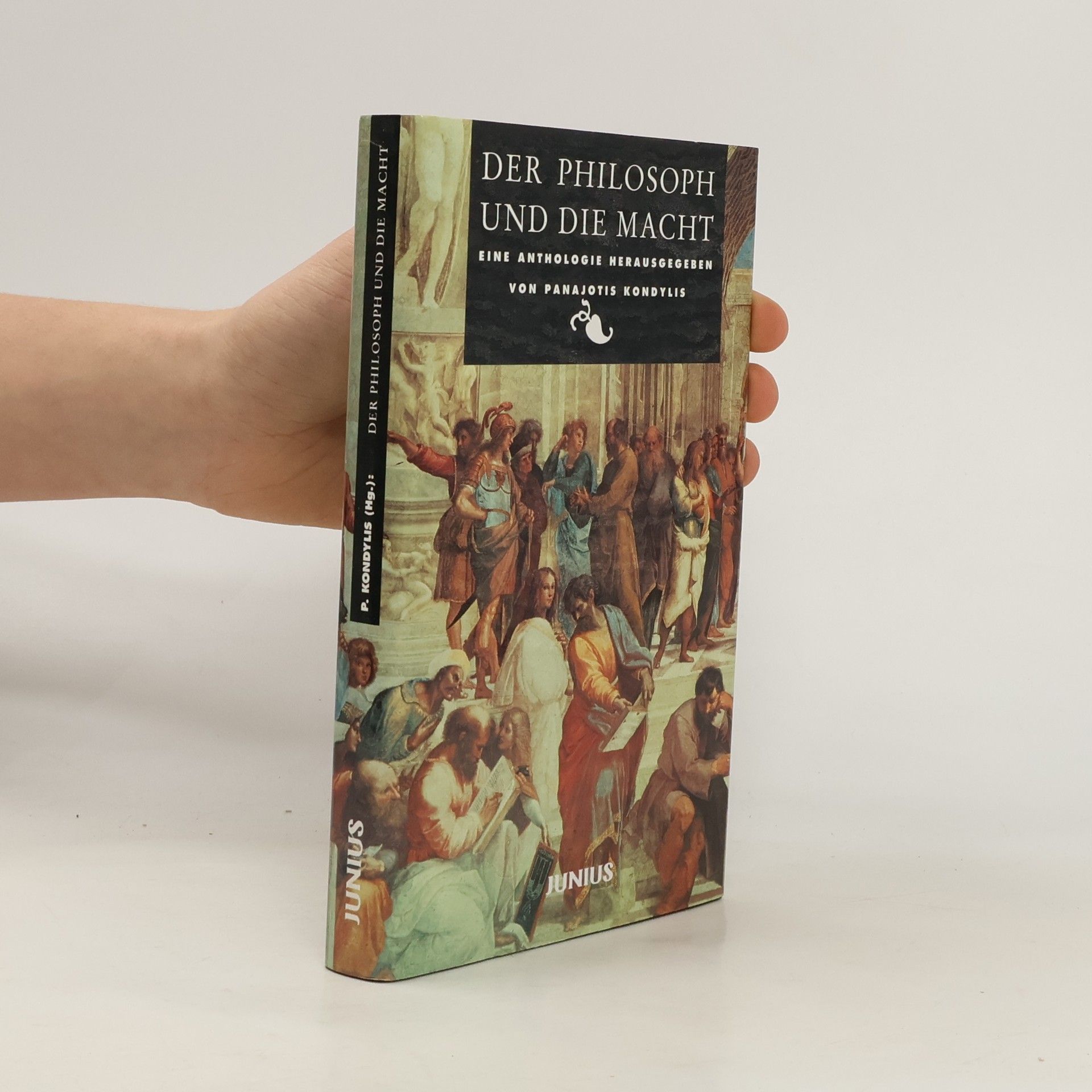Panajotis Kondylis analysiert in seiner geistesgeschichtlichen Untersuchung die Theorien zum Krieg von Clausewitz über Marx und Engels bis hin zu Lenin. Er beleuchtet die Armee, die gesellschaftlichen Auswirkungen des Krieges und die Strategien der Kriegsparteien, während er auch die anthropologischen Faktoren, die zum Krieg führen, thematisiert.
Panagiotis Kondylis Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)





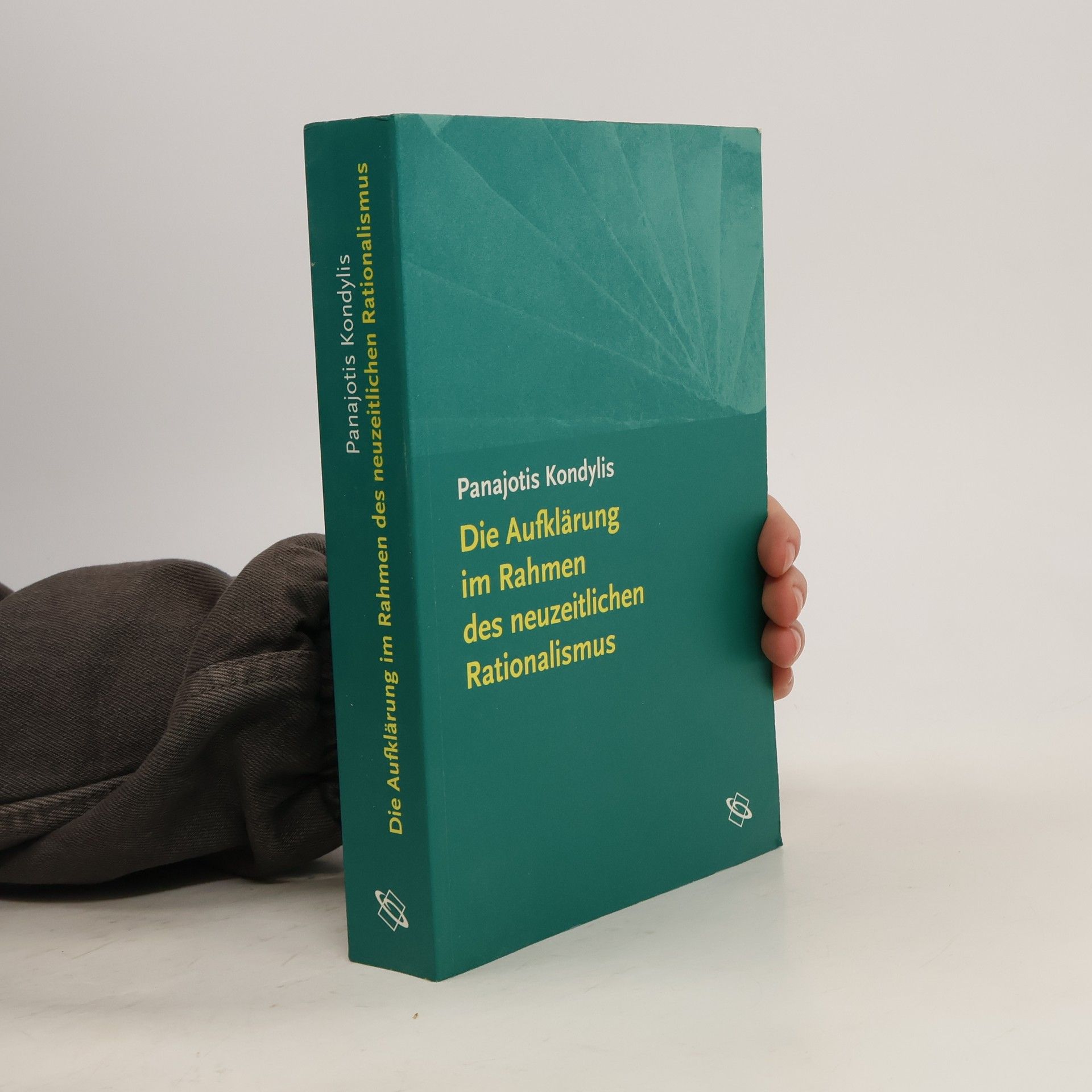
In konkreter Lage
Gespräche
Panajotis Kondylis, der griechische Philosoph und Ideentheoretiker, wusste: Nur durch einen totalen existenziellen Einsatz, eine wachsame Beobachtung konkreter, stets geschichtlich bedingter Situationen und lebendiger, um ihre Selbsterhaltung und dabei notgedrungen auch um die Erweiterung ihrer Macht bestrebter Menschen sowie durch eine unaufhaltsame Filtrierung der Beobachtungen mit strenger Reflexion, die vor keinem Vorurteil kapituliert und keinen Konflikt scheut, gelangt der Geist zur Reife und entgeht der normativen Bindung. In den drei in den 1990er-Jahren geführten Interviews präsentiert sich dieses Wissen in praktischer Vollendung und bietet zugleich einen grundlegenden Einstieg in das Denken Kondylis’ – ein Denken, das sich Philosophie, Anthropologie, Ökonomie und Geschichte zunutze macht, ohne sich den Disziplinengrenzen zu beugen. Ein Denken, das die politisch-ideologischen Strömungen und Theorien der Vergangenheit durchleuchtet, um ihre Bedeutung für die Gegenwart und den Einfluss, den sie auf das Heute haben, offenzulegen. Ein Denken, das an kein Ende kommt und sich als ein geradezu planetarisches erweist.
Panajotis Kondylis (1943-1998) schuf eine Reihe bedeutender Standardwerke zur europäischen Geistes- und Ideengeschichte. Dabei verband er Forschungen verschiedener Geisteswissenschaften miteinander und entdeckte eine allen gemeinsame Anthropologie. Für sie hatte er sein Opus Magnum, „Das Politische und der Mensch“ vorgesehen. Von den drei Bänden „Grundzüge der Sozialontologie“ konnte er nur den ersten Band (Soziale Beziehung, Verstehen, Rationalität) fertigstellen; für Band II (Gesellschaft als politisches Kollektiv) und III (Identität, Macht, Kultur) liegen für eine Reihe der geplanten Themen die Notate vor. Sie sind eine großartige Fundgrube: Sie geben Einblick in sein methodisches Vorgehen, um den Werken bekannter Autoren (u. a. M. Weber, S. Freud, K. Marx, A. Gehlen, C. Schmitt) gerecht zu werden, sowie darin, wie die Verdichtung seiner Themen schrittweise erfolgt und wo es naheliegt, vorhandene Notizen zu einem Text zu vervollständigen.
Planetarische Politik nach dem Kalten Krieg
- 147 Seiten
- 6 Lesestunden
Der Philosoph und die Lust
Eine Anthologie
Der Philosoph hat umfassendes Wissen über die Lust, betrachtet sie jedoch aus der Distanz, um sie zu qualifizieren und Hierarchien aufzustellen. Er erkennt nur die als „sittlich“ geltenden Lustarten an, da er befürchtet, seine Würde zu verlieren, wenn die Sinneslust seine Seele befällt. Im Mittelalter kämpften christliche Denker gegen die Lust, während Epikur eine lustfreundlichere Perspektive einbrachte. Mit dem neuzeitlichen Rationalismus wurde die Sinnlichkeit rehabilitiert, doch Lustverherrlicher wie la Mettrie und de Sade blieben Außenseiter. Vernunft und Tugend wachen über die Gesellschaft, da ungebändigte Lustbefriedigung nicht tragfähig wäre. Moderne Theorien, wie die von Herbert Marcuse, versuchten, das Lustprinzip über das Leistungsprinzip zu stellen, konnten jedoch das bestehende System nicht grundlegend verändern. Nietzsche bringt Lust und Macht zusammen, was auf Zusammenhänge hinweist, die der Philosoph nicht offen ansprechen kann. Indem er tierische Lust durch Ethik zähmt, strebt er nach einer „höheren“ Lust: der Macht. Geistige Lust wird höher bewertet als sinnliche, da sie mit Macht und Machtstreben verbunden ist. Die Ethik muss diese Verbindungen leugnen, um ihre soziale Funktion aufrechtzuerhalten. Beiträge von bedeutenden Denkern wie Aristoteles, Platon, Kant und Nietzsche beleuchten diese komplexen Zusammenhänge.
In seinem 1991 erstmals veröffentlichten Werk untersucht der Philosophie- und Sozialhistoriker Panajotis Kondylis die sozialen und geistigen Wandlungen seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts und zeigt deren strukturelle Einheit auf. Diese Entwicklungen führen zu einem Paradigmenwechsel: Anstelle der bürgerlich-liberalen Denk- und Lebensform dominiert im 20./21. Jahrhundert die egalitär-massendemokratische Konsumhaltung mit ihren Wohlstandsversprechungen. Die Überwindung der Güterknappheit schafft eine historisch einmalige Situation des Massenkonsums, der das postmoderne System antreibt. Die zentrale These besagt, dass der ökonomische Erfolg bürgerlicher Werte von Freiheit und Gleichheit gleichzeitig deren Niedergang verursacht. In einem verbreiteten Hedonismus fehlen ästhetische und ethische Vorbehalte, und die Analyse der politischen Realität wird durch universale Kommunikation ersetzt, die von der Hoffnung auf Weltfrieden geprägt ist. Im Zeitalter der pluralistischen Massendemokratie eröffnen sich neue Perspektiven auf die globale Gesellschaft, in der jedoch nicht der Handel den Krieg ablöst, sondern die Verteilungskämpfe zunehmen. Das Werk erhebt sowohl einen historischen und geistesgeschichtlichen als auch einen methodologischen Anspruch, indem es die Zusammenhänge zwischen sozialer, kultureller und raumzeitlicher Wahrnehmung beleuchtet.
Der Philosoph und Ideenhistoriker Panajotis Kondylis wendet sich in dieser lange Zeit vergriffenen, noch immer neuartigen und verblüffenden Interpretation gegen die Auffassung vom Konservativismus als Reaktion auf die Französische Revolution. In brillanten Gedankengängen, die ihn von Bonald und Burke über Carlyle und Chateaubriand zu Fénelon, de Maistre und Schlegel führen, weist er nach, dass der Konservativismus als soziale und politische Kraft bereits seit dem Mittelalter existierte, wo der Adel und sein Ständesystem aufkommende egalitäre Interpretationen des Rechts bekämpften. Doch Kondylis geht noch einen Schritt weiter und zeigt, wie der Konservativismus sich an die jeweilige Realität des ohne ihn nicht denkbaren modernen souveränen Staates anpasste, und analysiert ihn als politische Kraft, die in überraschenden Formen immer wieder auftaucht. So gelingt es ihm etwa aufzuzeigen, wie sich die zentralen Themen der sozialistischen Kapitalismuskritik im ideologischen Bereich der Gegenrevolution herausbildeten und bis heute idealisierte Bilder einer vorkapitalistischen Realität in Umlauf brachten. Konservativismus ist der nötige Beitrag, um die politischen und kulturellen Debatten unserer Zeit besser zu verstehen.