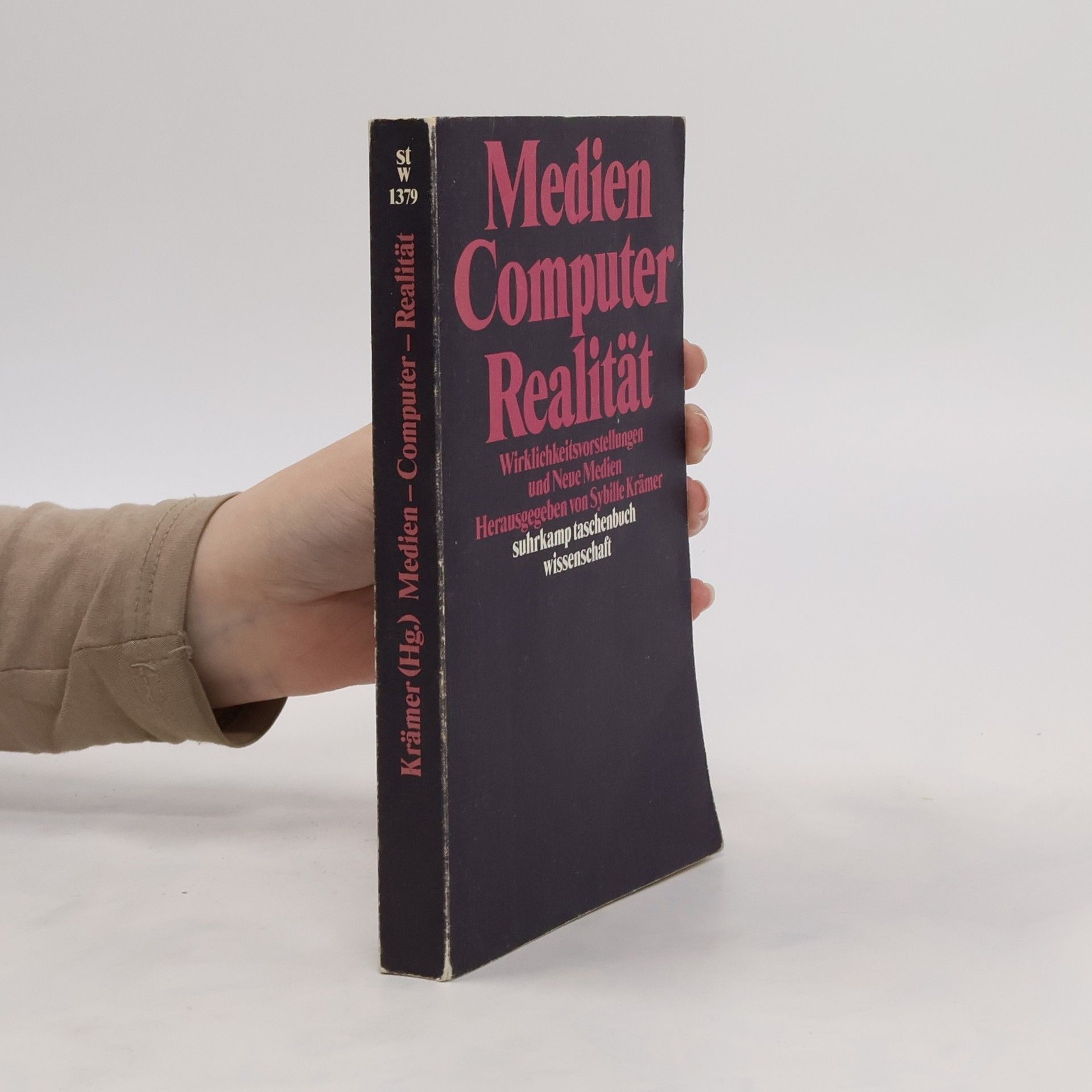Medium, Bote, Übertragung
- 379 Seiten
- 14 Lesestunden
Was ist ein Medium? Die zeitgenössische Mediendebatte rekonstruiert Medien zumeist in Begriffen technischer Mittel und Apparate und (v)erklärt sie zum archimedischen Punkt unseres Weltverhältnisses. Das neue Buch von Sybille Krämer unternimmt einen Perspektivenwechsel: Was bedeutet es, wenn wir Medien nicht als Mittel, sondern als Mitte und Mittler bestimmen? Die Antwort darauf wird durch das »Botenmodell« gegeben, das Übertragung als ein kulturphilosophisches Schlüsselkonzept ausweist. Der Bote erscheint in diesem Zusammenhang als die Figur eines Dritten, der zwischen heterogenen Welten plaziert ist und damit Kommunikation und Austausch ermöglicht. Die kulturstiftende Leistung des Übertragens wird am Beispiel der imaginären Figur des Engels, der Krankheitsübertragung durch Viren, der Eigentumsübertragung durch Geld, der Sprachübertragung in der Übersetzung, der Gefühlsübertragung in der Psychoanalyse und schließlich der Übertragung von Wahrnehmung und Wissen durch Zeugen analysiert. „Aisthetisierung“ – im Sinne des Wahrnehmbarmachens eines Abwesenden bzw. eines Unsinnlichen – erweist sich dabei als die Elementaraufgabe von Medien. Sybille Krämer will mit ihrem Buch den Boden bereiten für eine kritische Auseinandersetzung mit unserem demiurgischen Selbstverständnis als Homo faber bzw. Homo generator. Was bedeutet es, wenn wir uns eher als Bote denn als Macher und Konstrukteur begreifen?