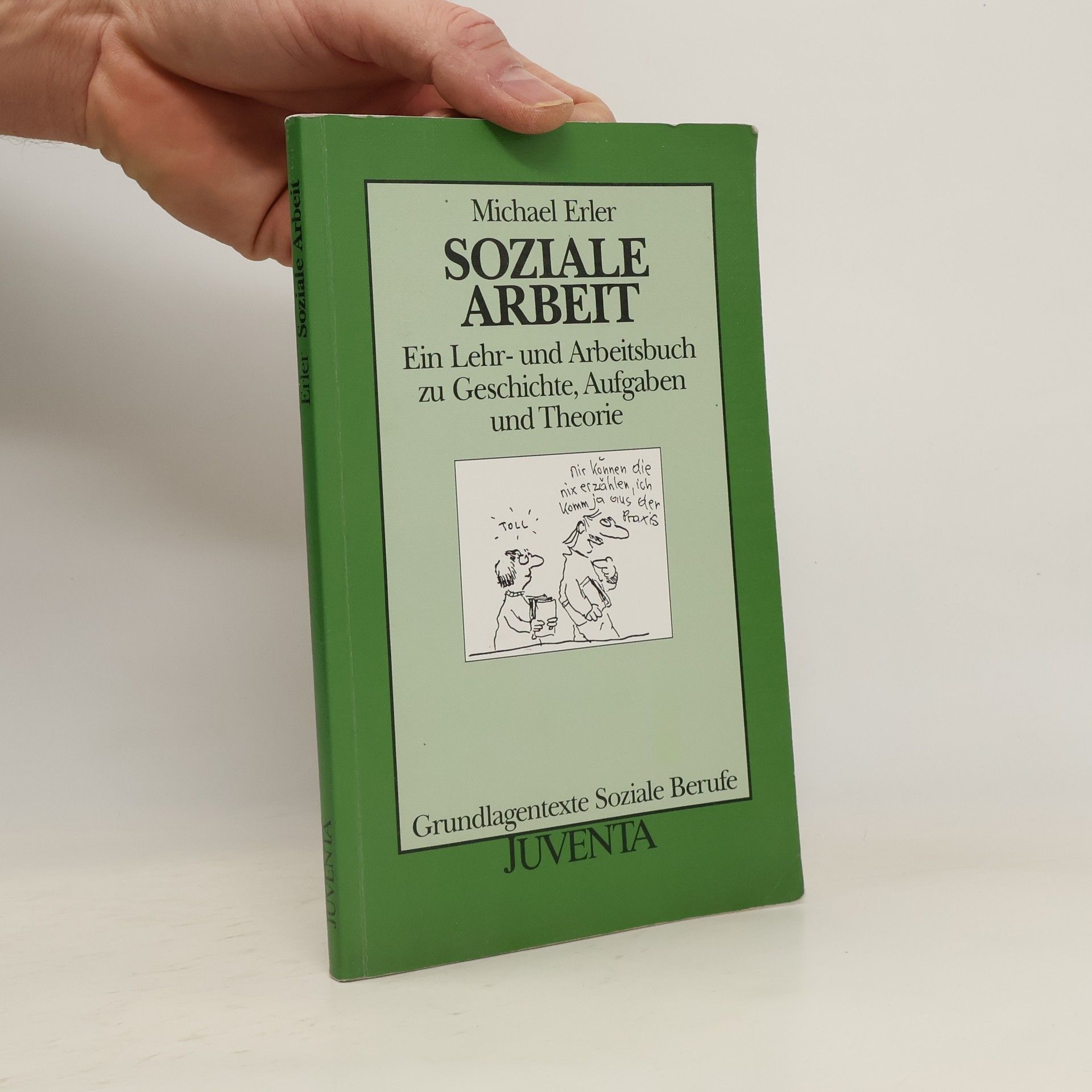Sokrates in der Höhle
Aspekte praktischer Ethik im Platonismus der Kaiserzeit
Sokrates hat als Figur in der kaiserzeitlichen Philosophie nicht zuletzt auch bei der Auseinandersetzung mit dem Christentum eine Rolle gespielt. Dass dies auch fur Aspekte der praktischen Ethik gilt, die mit seinem Namen verbunden werden, ist mit Blick auf die wachsende Jenseitsorientierung der kaiserzeitlichen, platonisch dominierten Philosophie bestritten worden. Michael Erler zeigt, dass die von Sokrates im Gorgias als 'wahre Politik' bezeichnete praktische Anwendung philosophischer Methoden gleichwohl auch im spateren Platonismus eine Rolle spielte und als Hilfestellung fur das Leben im Diesseits letztlich der Befreiung der Seele fur das Jenseits diente.