Heinrich Rickert Bücher
25. Mai 1863 – 25. Juli 1936



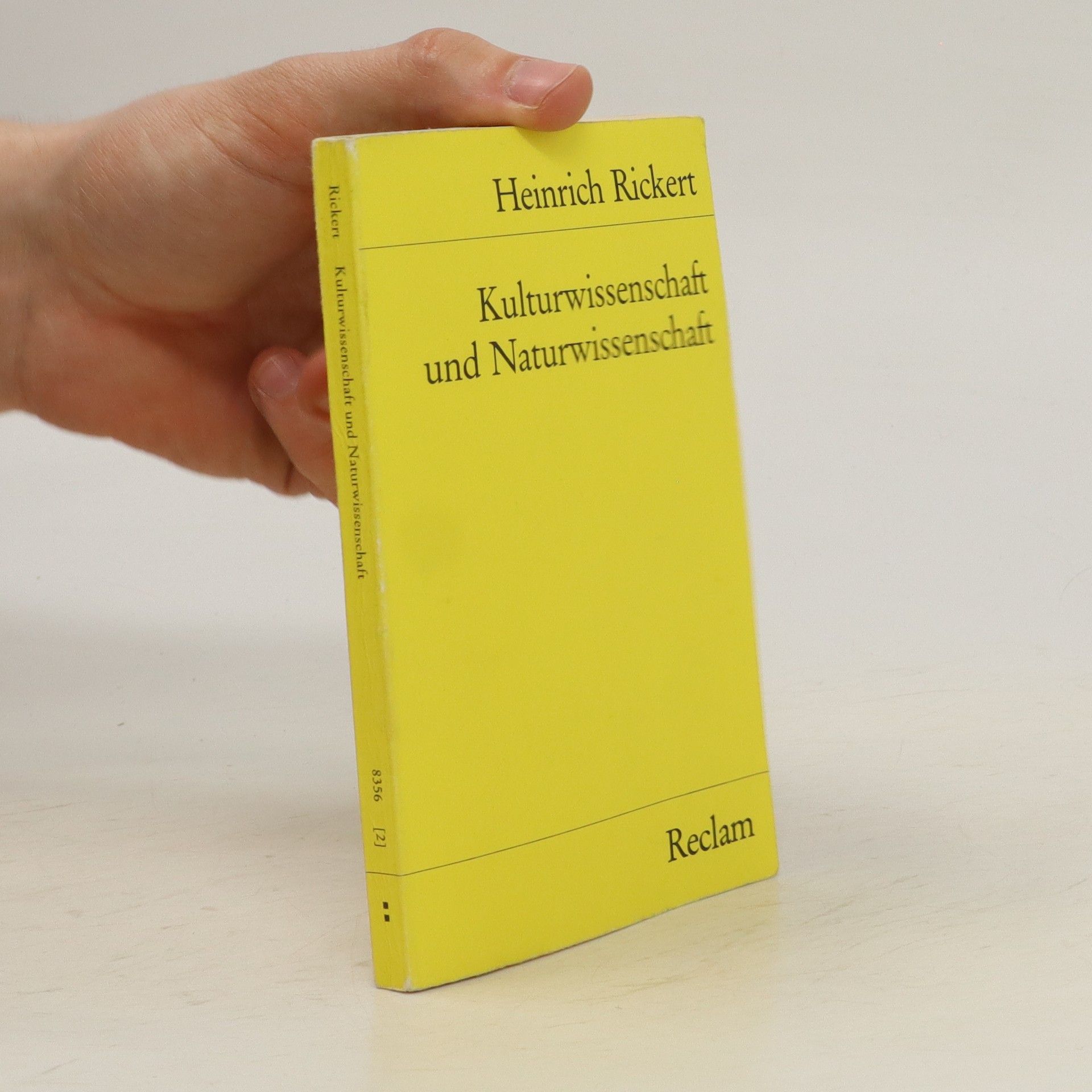
Der Band vereint drei Schriften von Rickert, die zentrale Themen seiner Philosophie behandeln: die Neugestaltung der Begriffslehre, das Verhältnis von Logik und Mathematik sowie eine Gegentheorie zu Heideggers Ontologie des Seins.
Rickerts „Grenzen" gehört zu den Monumenten der Philosophie vor den beiden Weltkriegen. Mit Scharfsinn, Übersicht und ebenso tiefgreifender wie umfassender Argumentation gibt Rickert eine begriffslogische Begründung der umstrittenen Wissenschaftlichkeit der Historie (als Kulturwissenschaft). Das Werk hatte großen interdisziplinären Einfluss, wenngleich die breite Rezeption nicht selten an seinen denkerischen Ansprüchen ihre Grenzen fand.