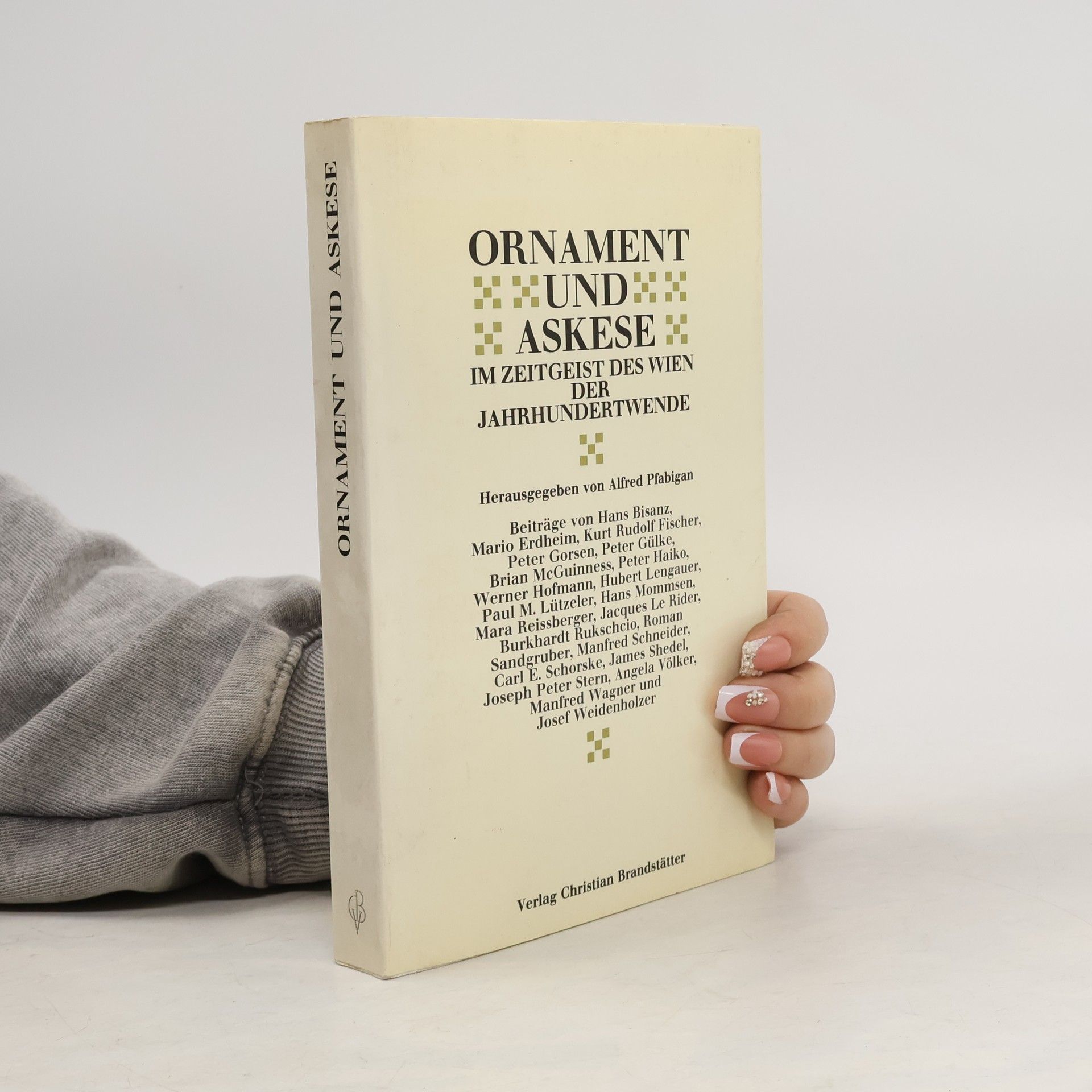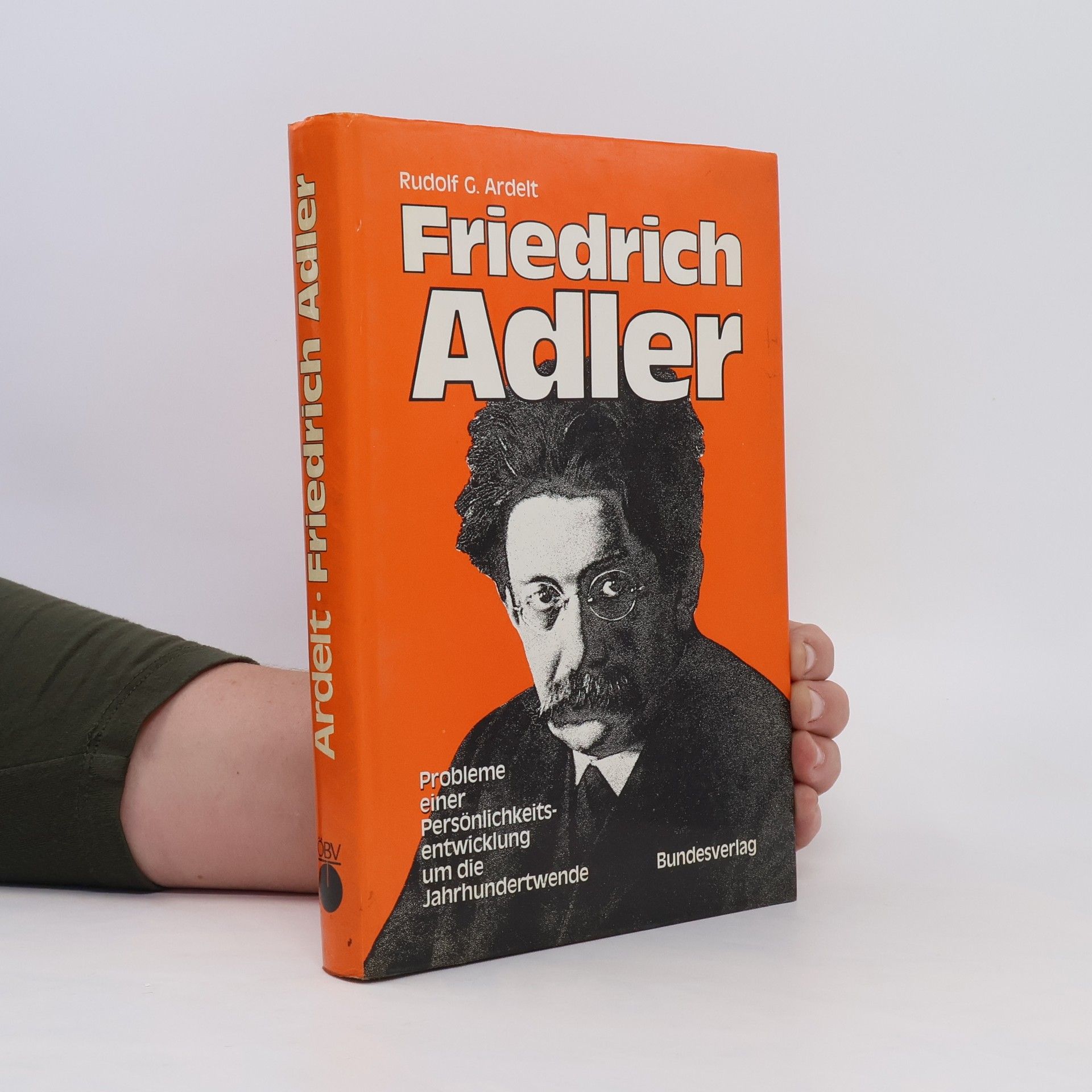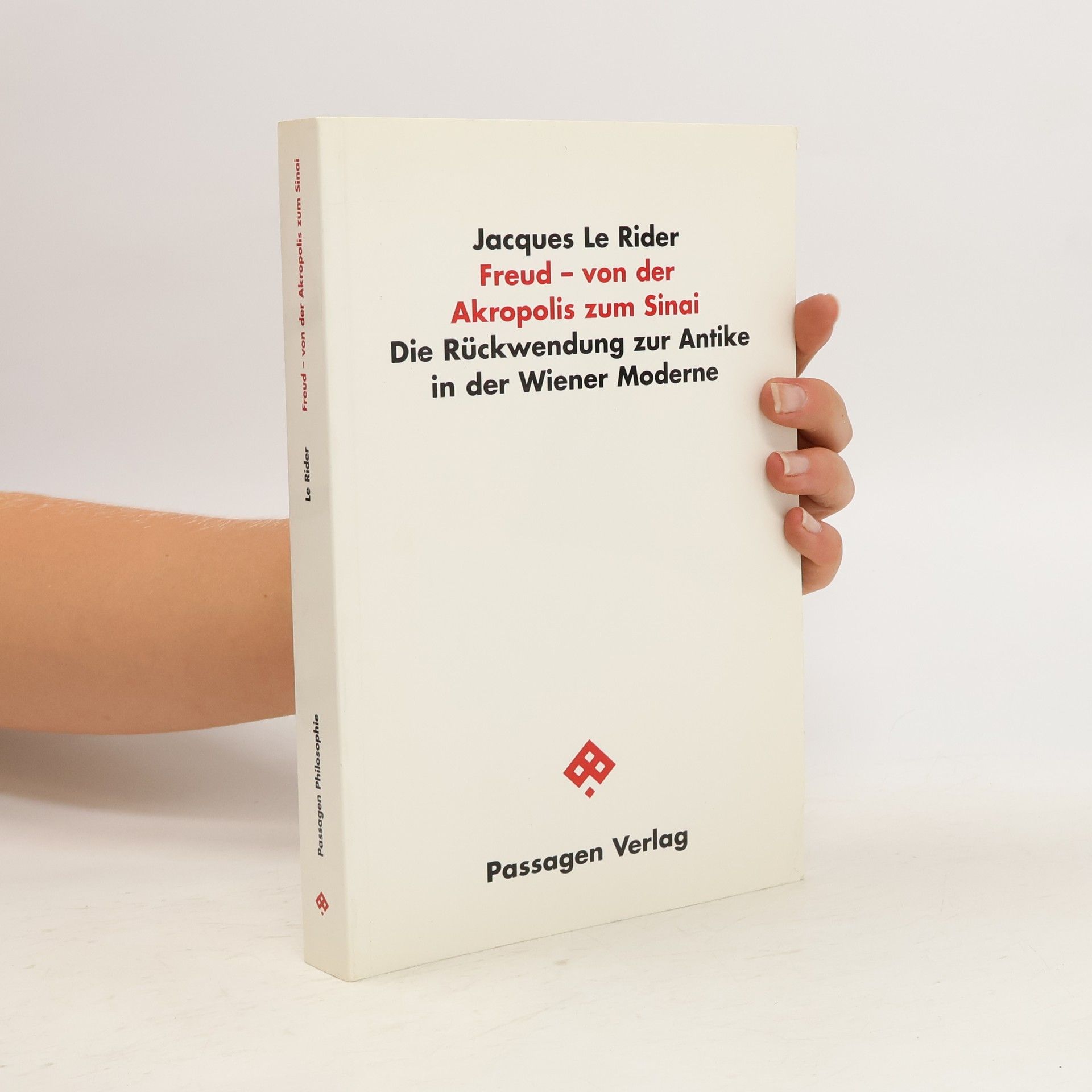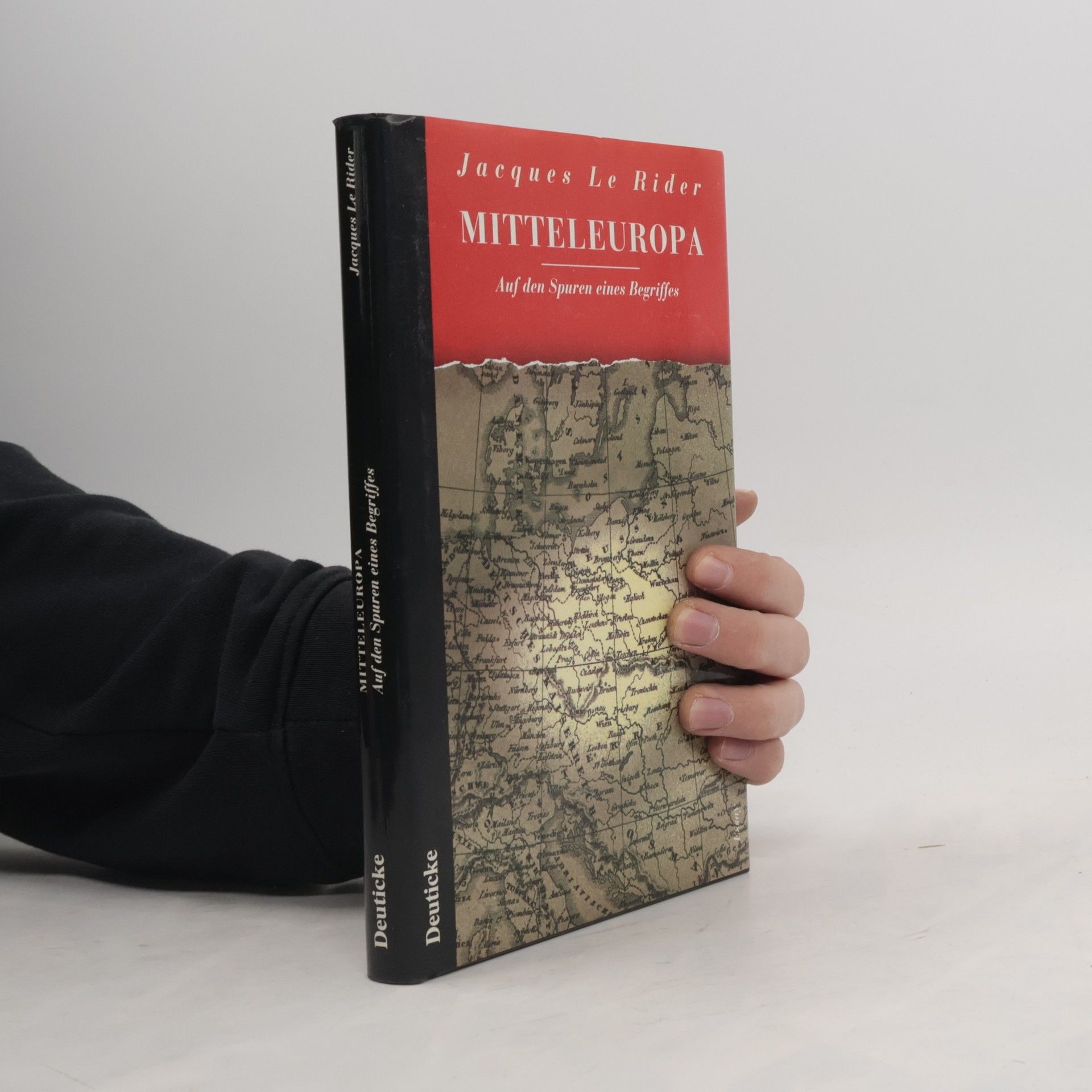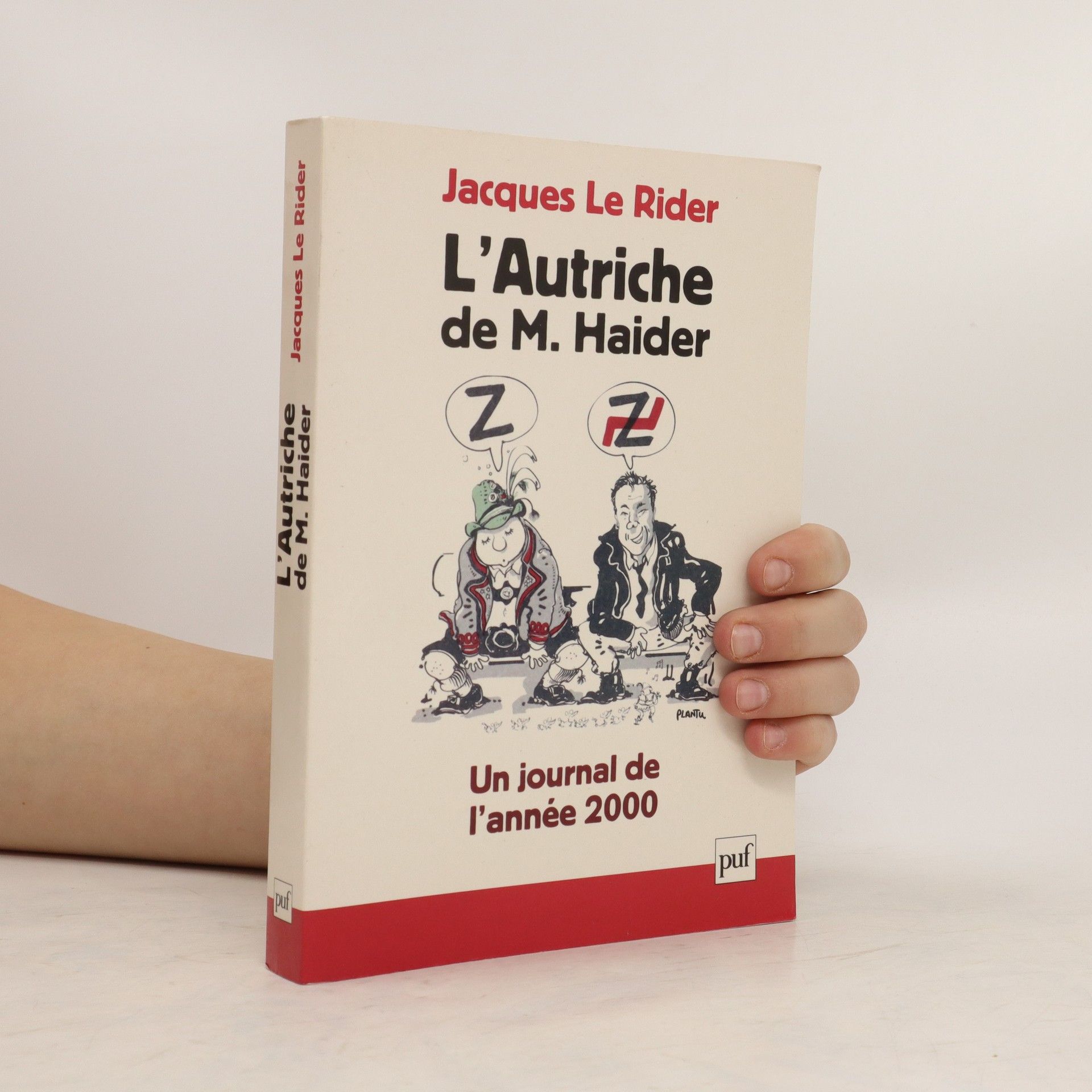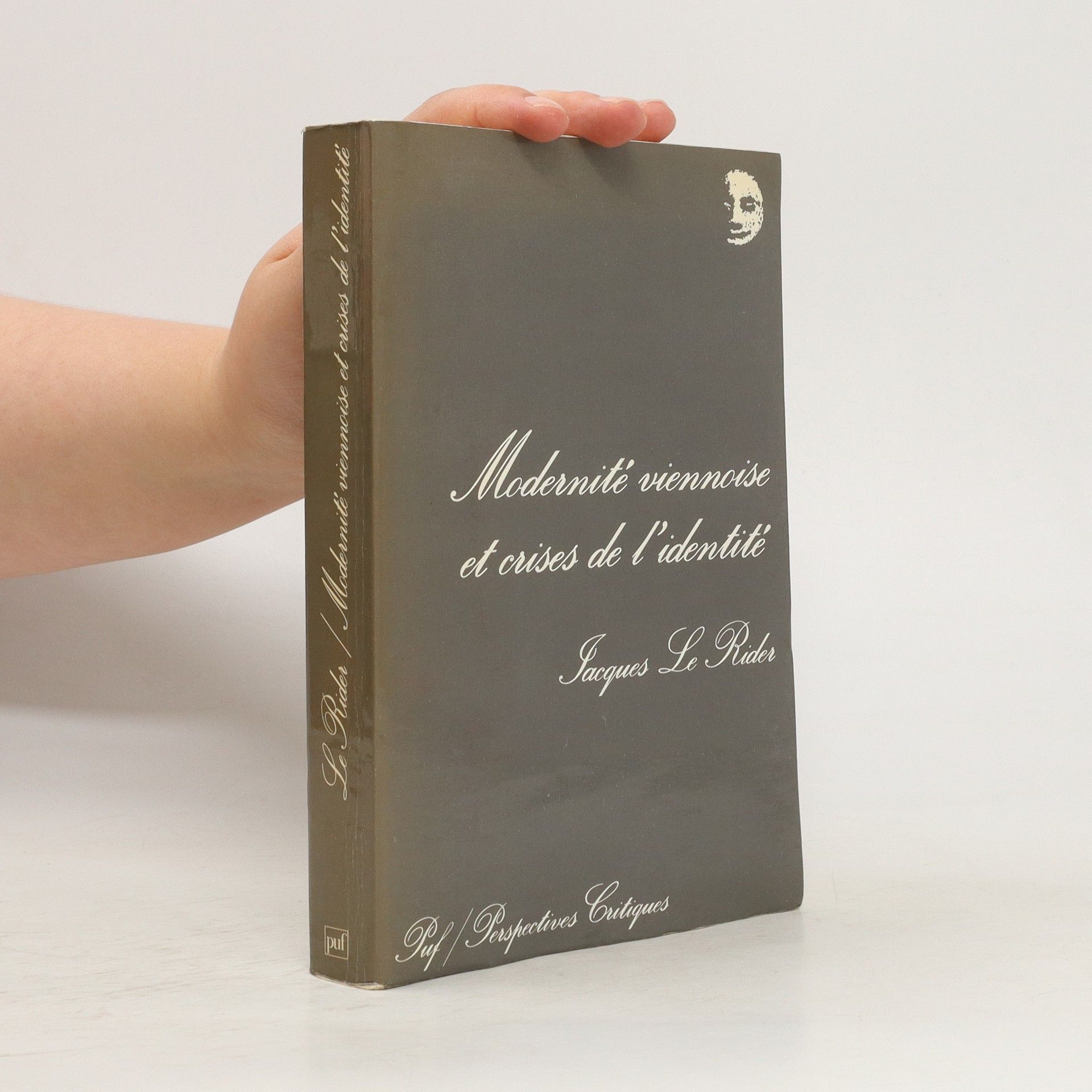Warum Krieg?
Zur Aktualität des Briefwechsels von Einstein und Freud
Im Juli 1932 fragt Einstein in einem offenen Brief an Freud, wie man die Menschheit »den Psychosen des Hasses und des Vernichtens gegenüber widerstandsfähiger« machen könnte. In seiner Antwort zieht Freud die Bilanz seiner Kulturanalyse. Nur durch Hemmung des Aggressions- und Destruktionstriebs könne Friede gestiftet werden, kein »ewiger« allerdings, da die erreichte Triebumbildung so leicht außer Kraft gesetzt werden könne. In diesem Dialog zwischen Freud und Einstein werden Fragen gestellt, die heute aktueller denn je sind. Kann der Pazifismus in Krisenzeiten den Krieg verhüten? Freud geht davon aus, dass der Kulturprozess »gegen den Krieg arbeitet«. Galt aber die Kriegstüchtigkeit nicht immer wieder als hoher Kulturwert? Und warum gehen Einstein und Freud über die Frage des »gerechten« Verteidigungskriegs so rasch hinweg?