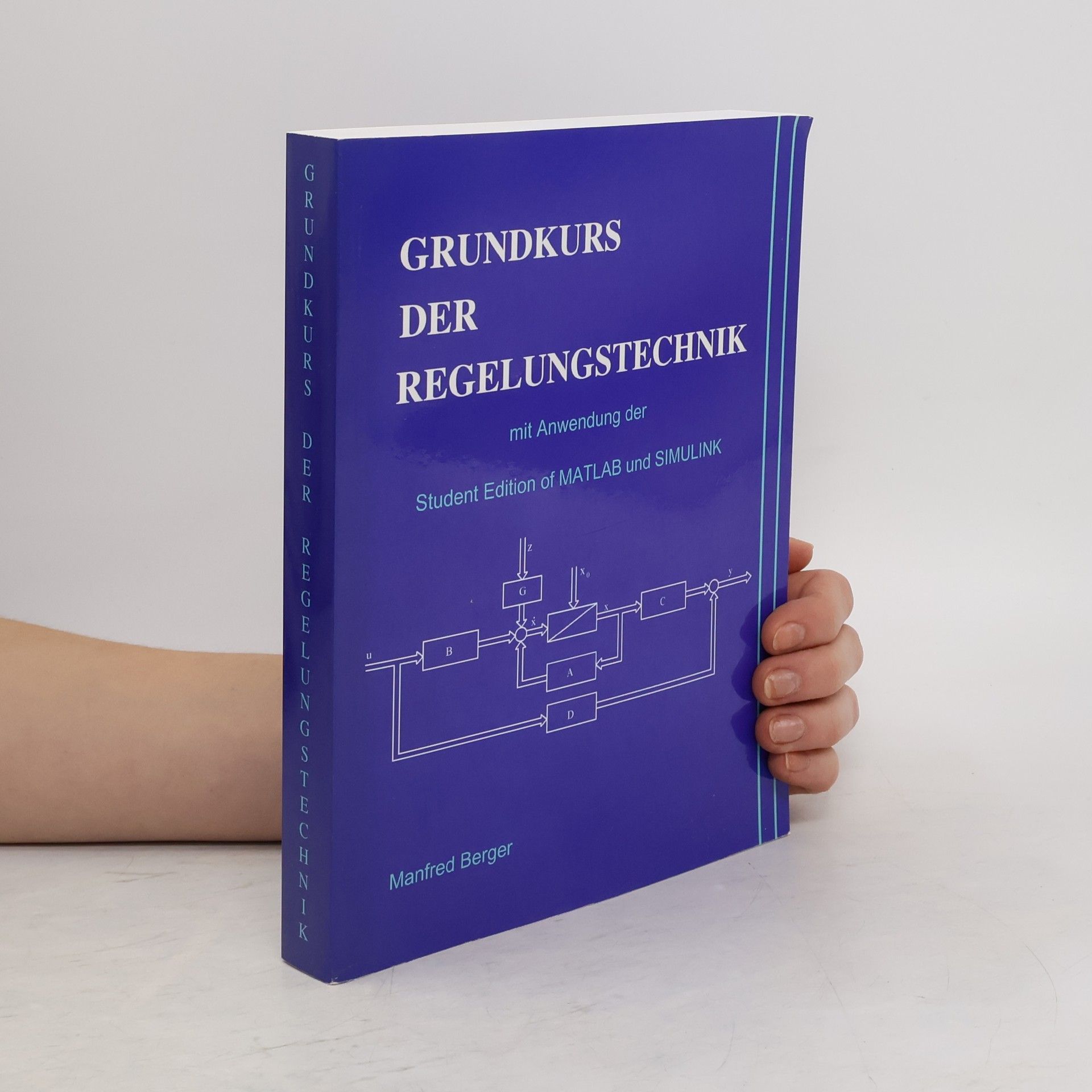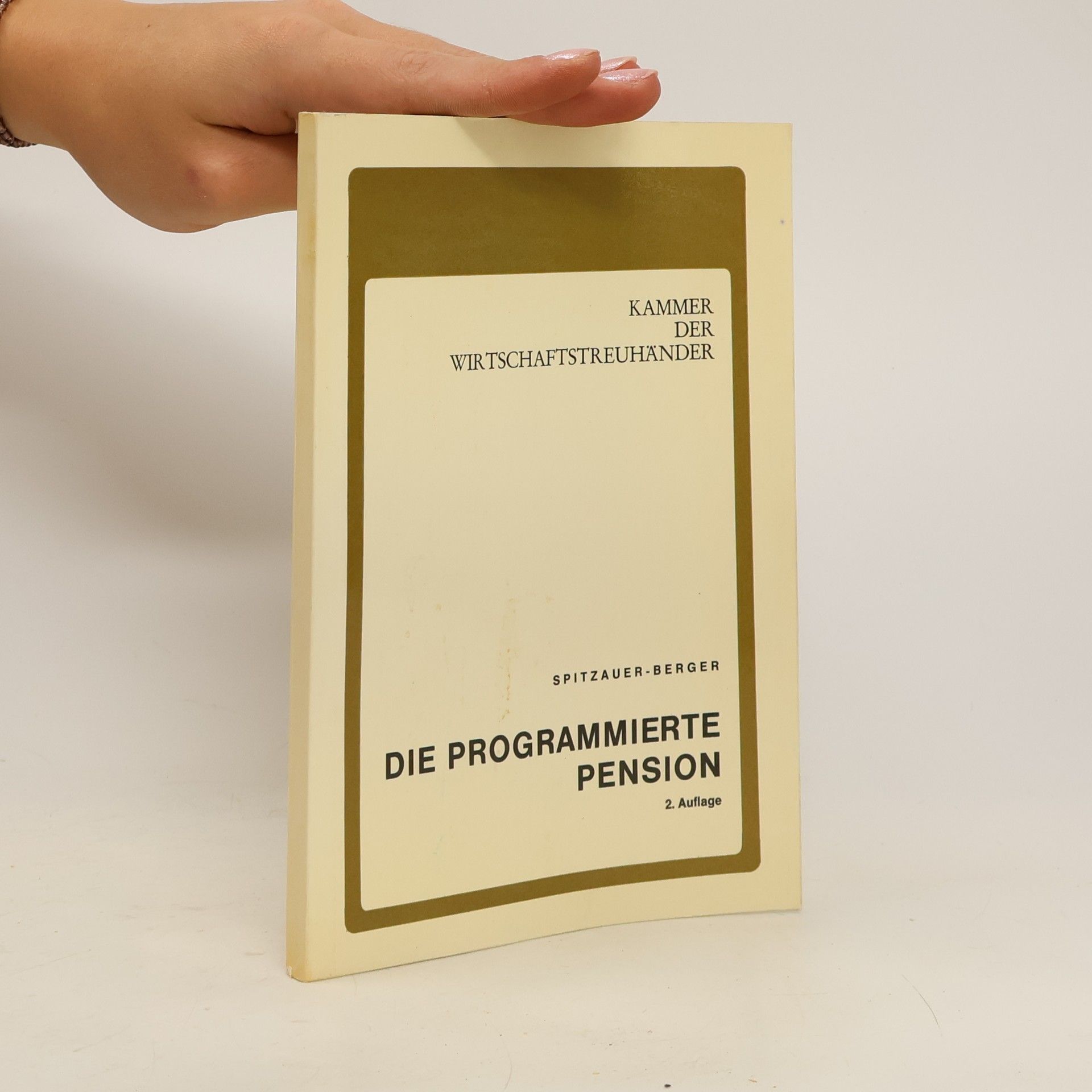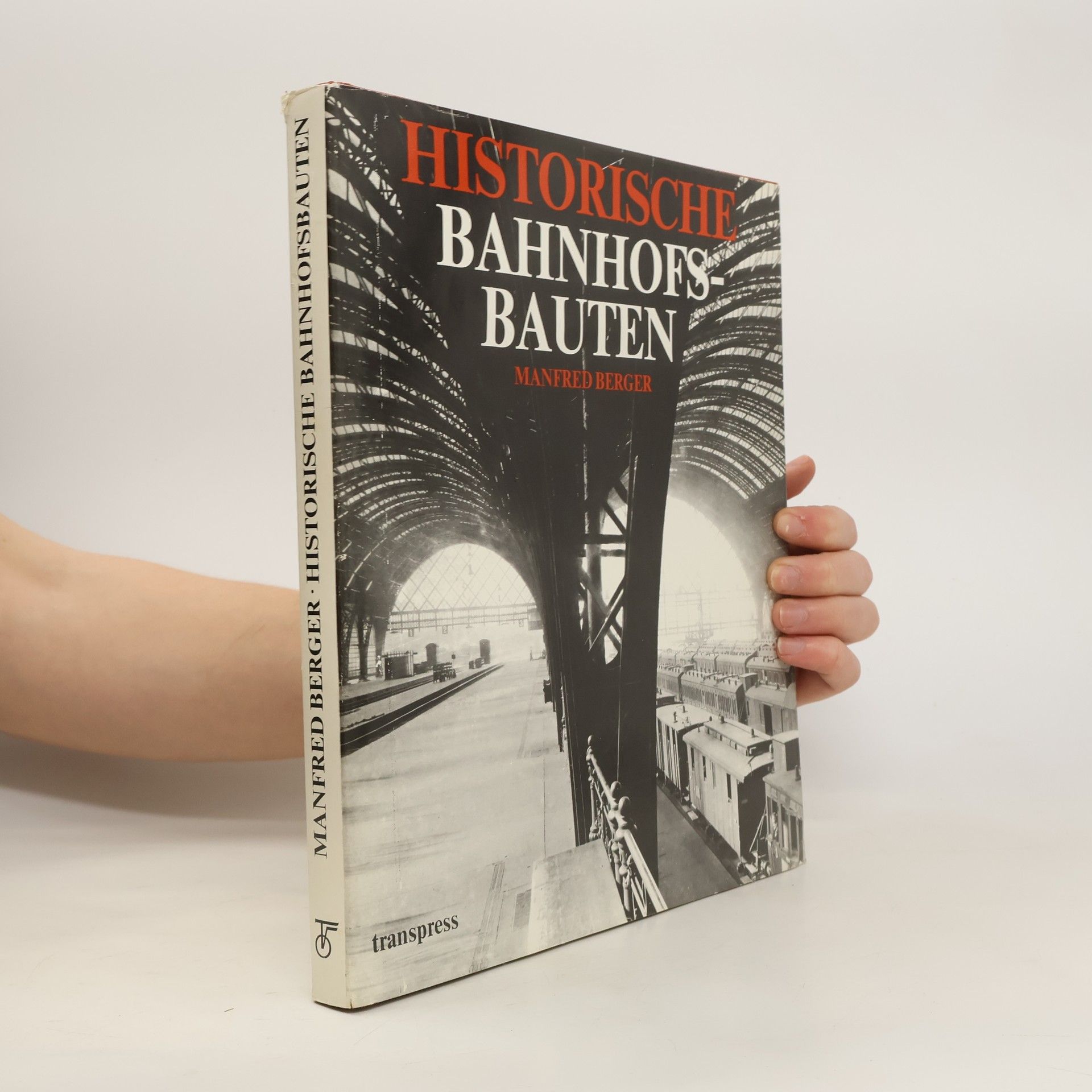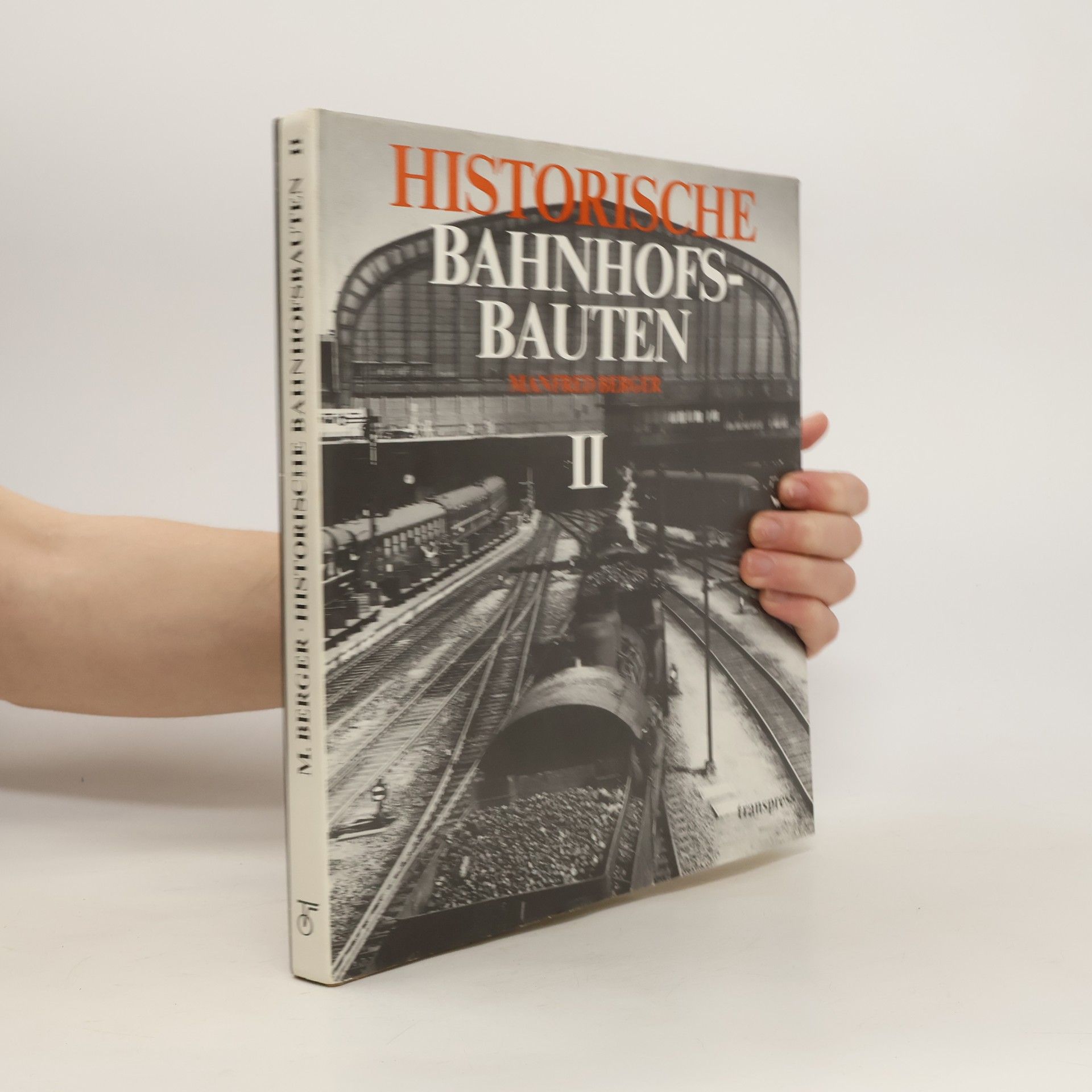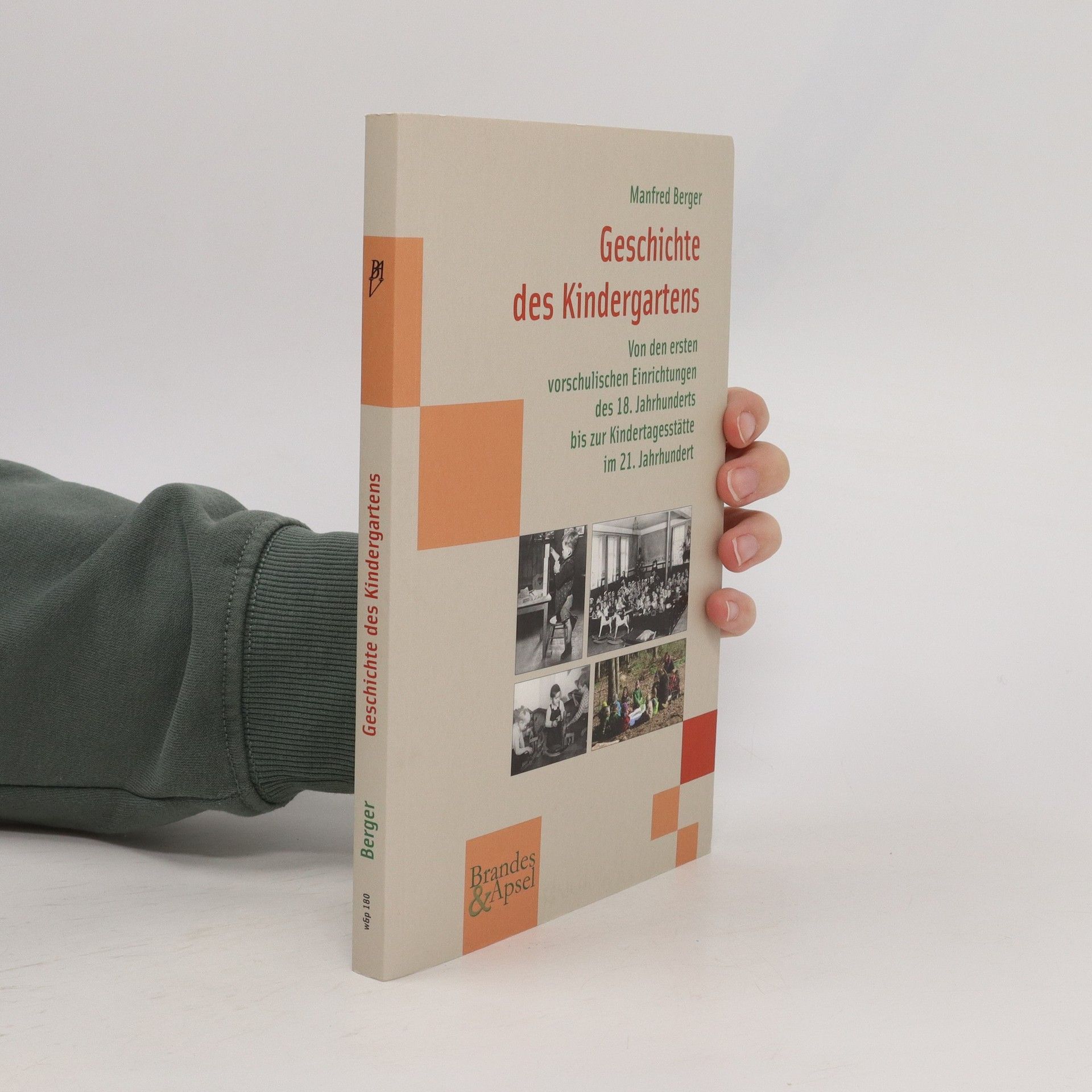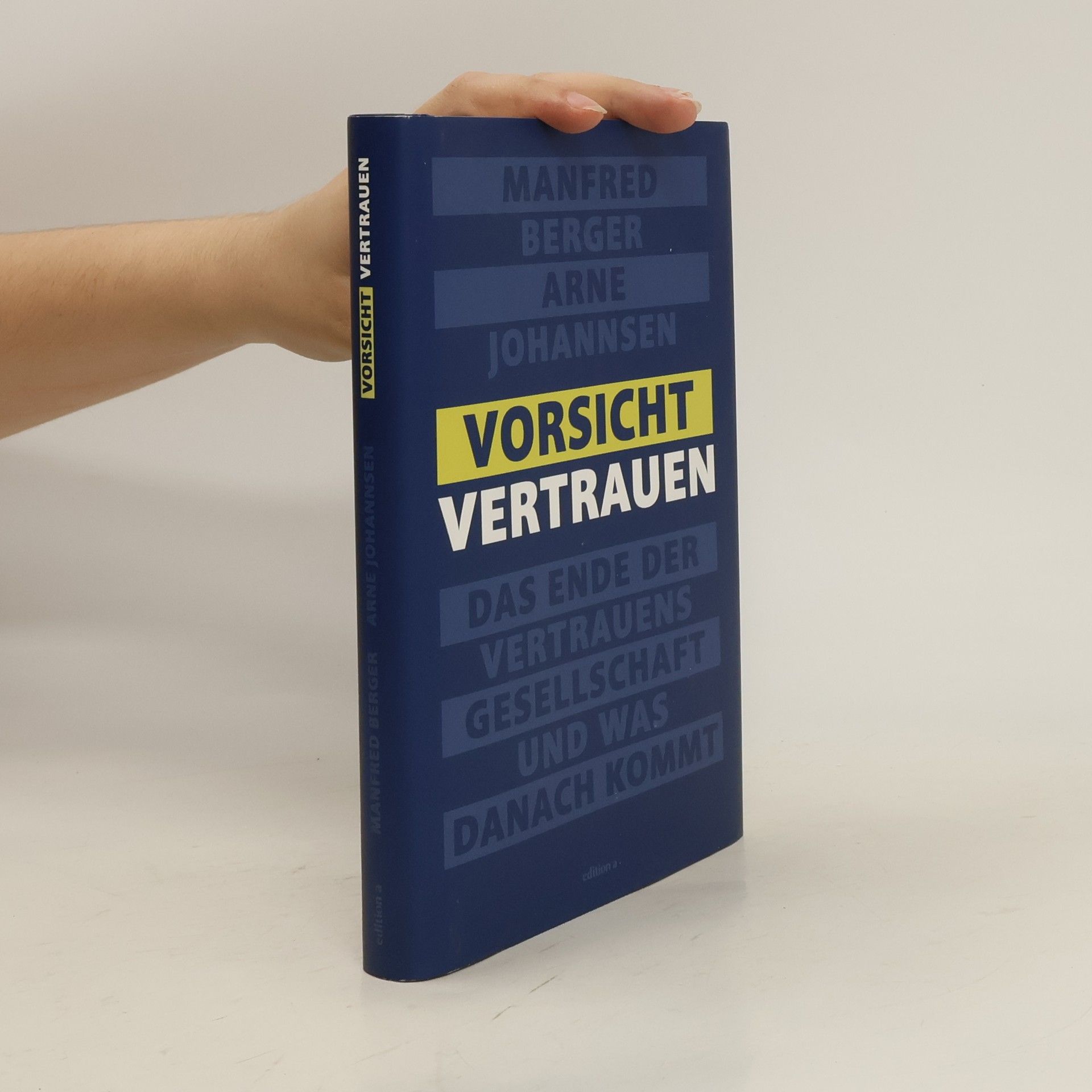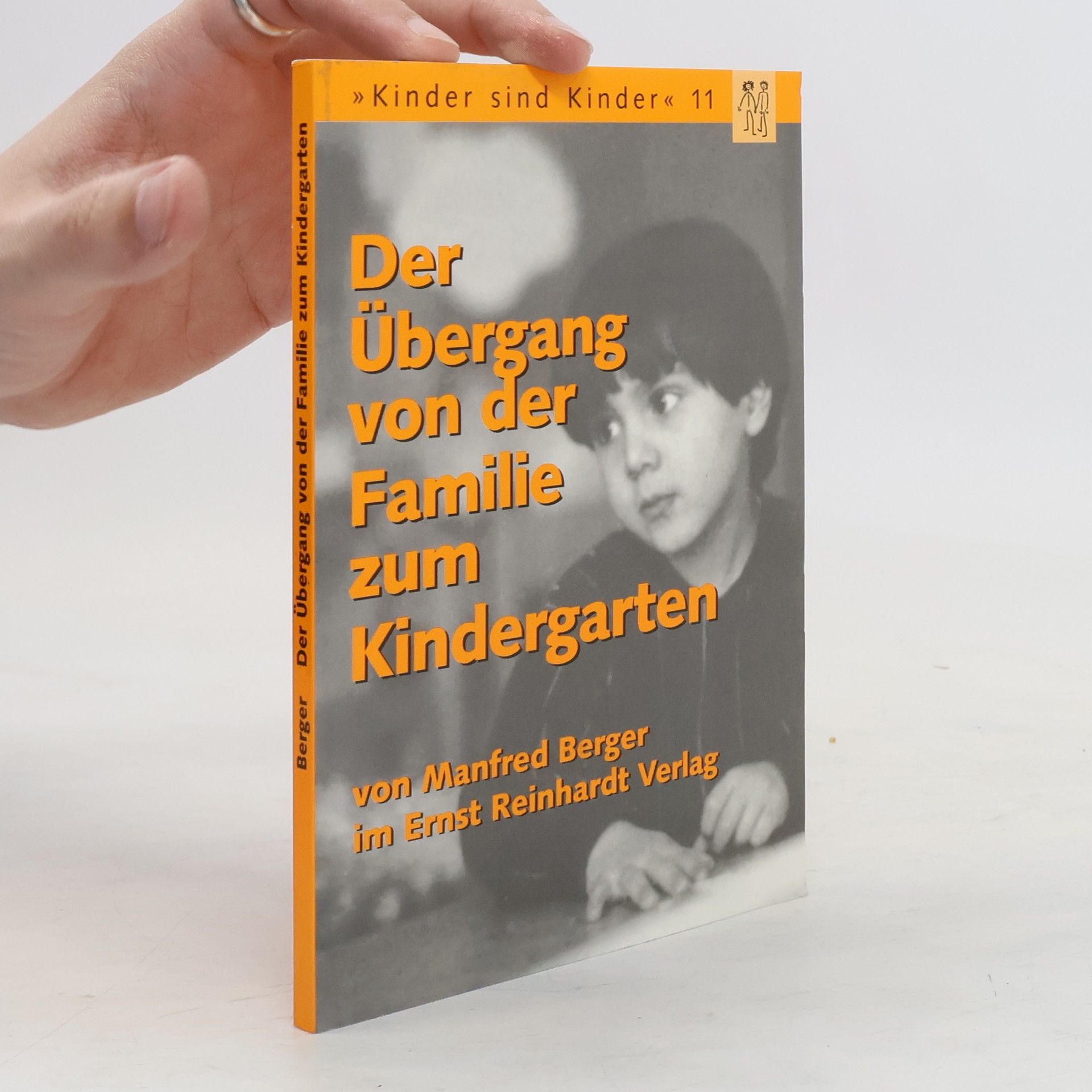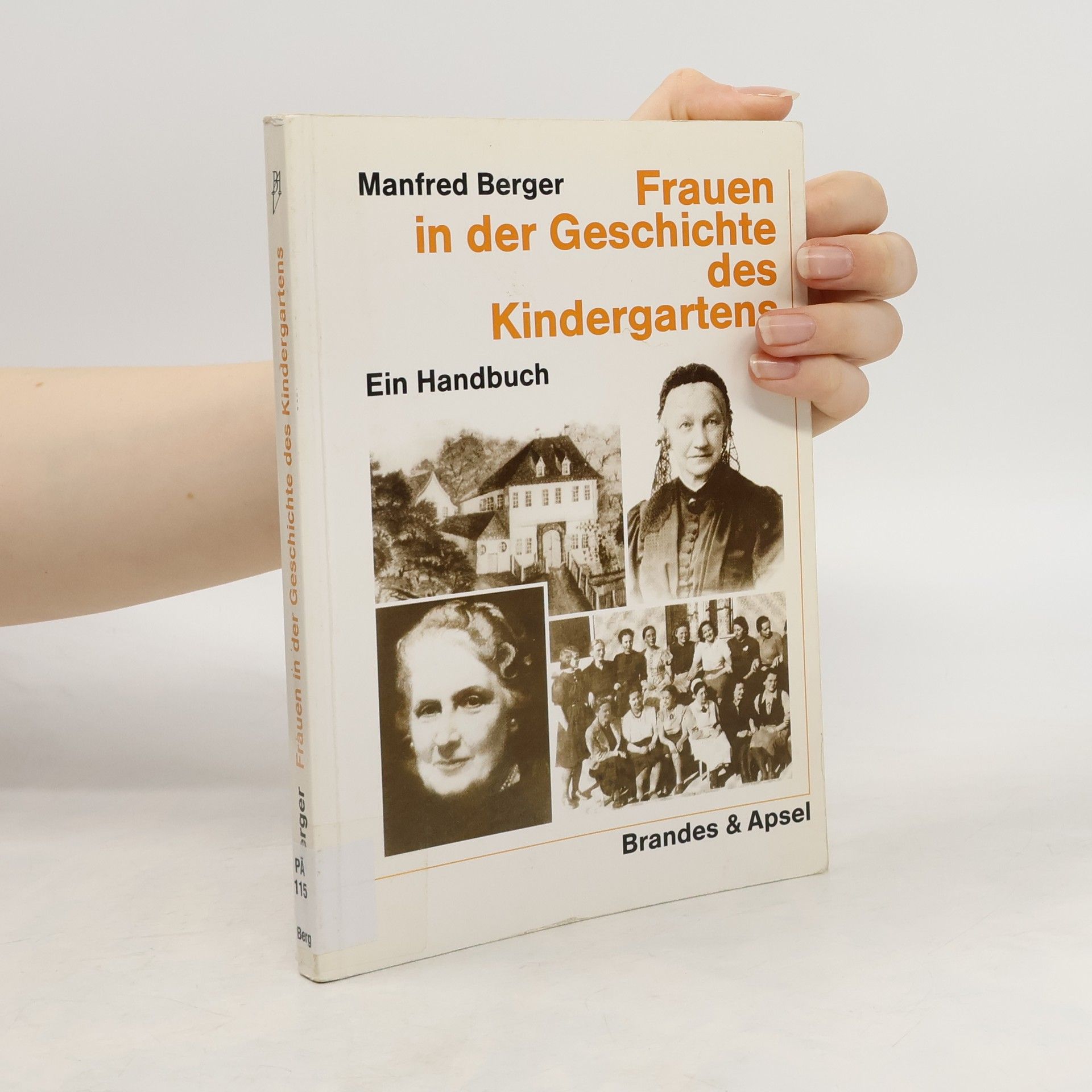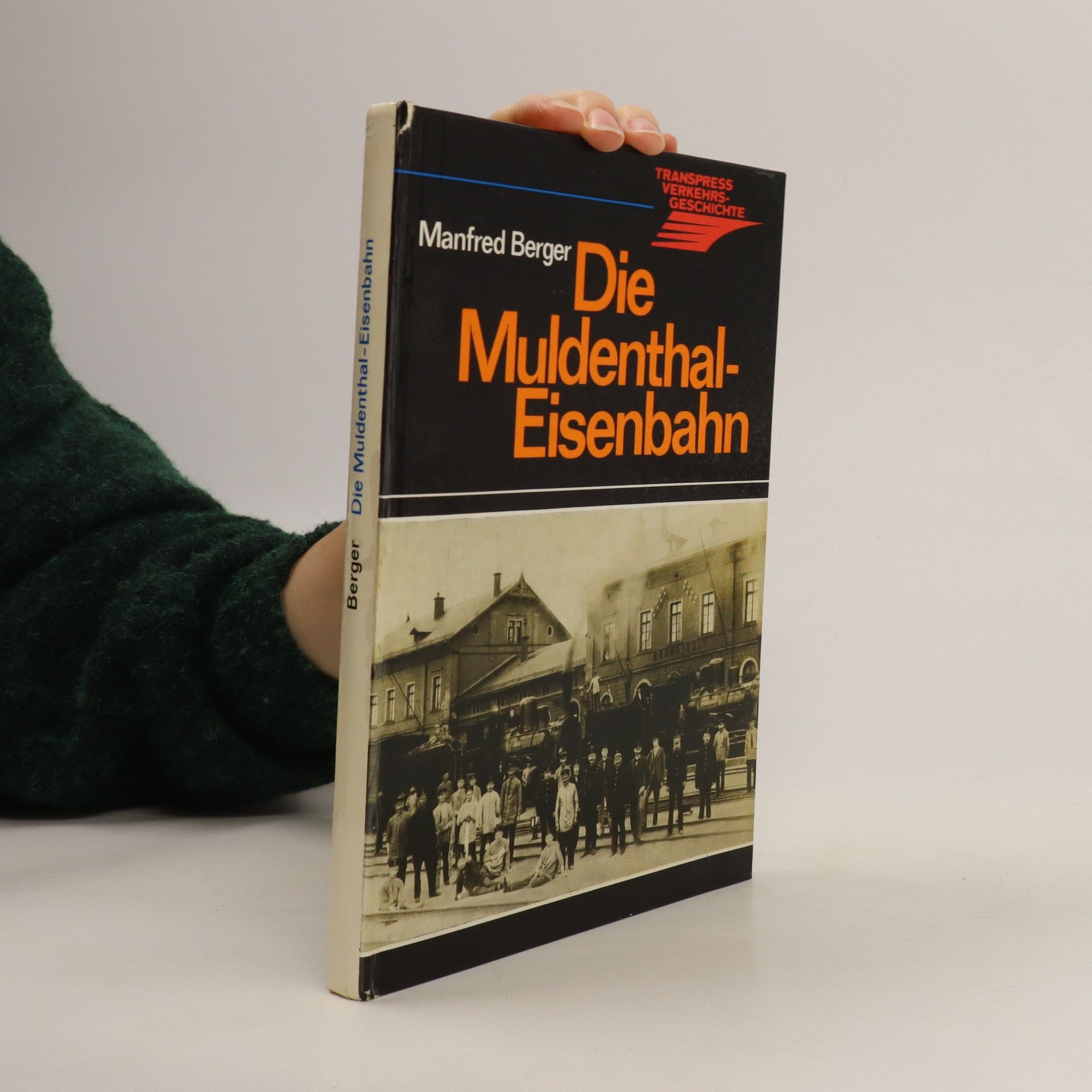Gertrud Feiertag und das Jüdische Landschulheim Caputh
Eine Dokumentation zur Bildungs- und Erziehungsgeschichte in den Jahren 1931 bis 1938
- 124 Seiten
- 5 Lesestunden
Die Geschichte beleuchtet die dramatischen Veränderungen, die Gertrud Feiertag und ihr Kinder-Landheim in Caputh erlebten, nachdem Hitler an die Macht kam. Die einst überkonfessionelle Einrichtung verwandelte sich 1936 in das Jüdische Landschulheim Caputh, um den neuen politischen Realitäten zu entsprechen. Die Verfolgung jüdischer Menschen führte schließlich zur Zerstörung der Einrichtung am 10. November 1938 durch eine aufgebrachte Menschenmenge, die ein judenfreies Caputh forderte. Die Erzählung thematisiert die Auswirkungen des Nationalsozialismus auf Bildung und Gemeinschaft.