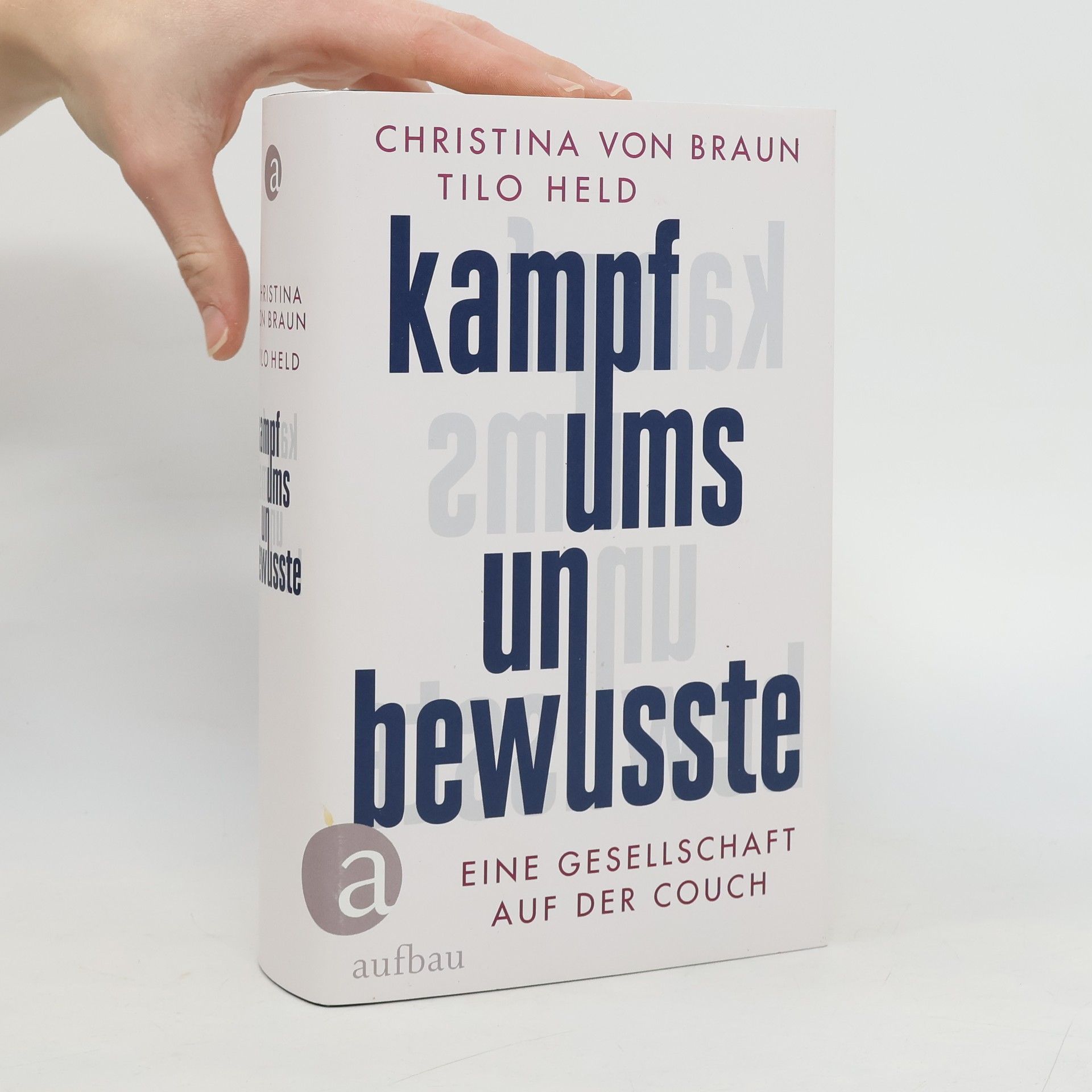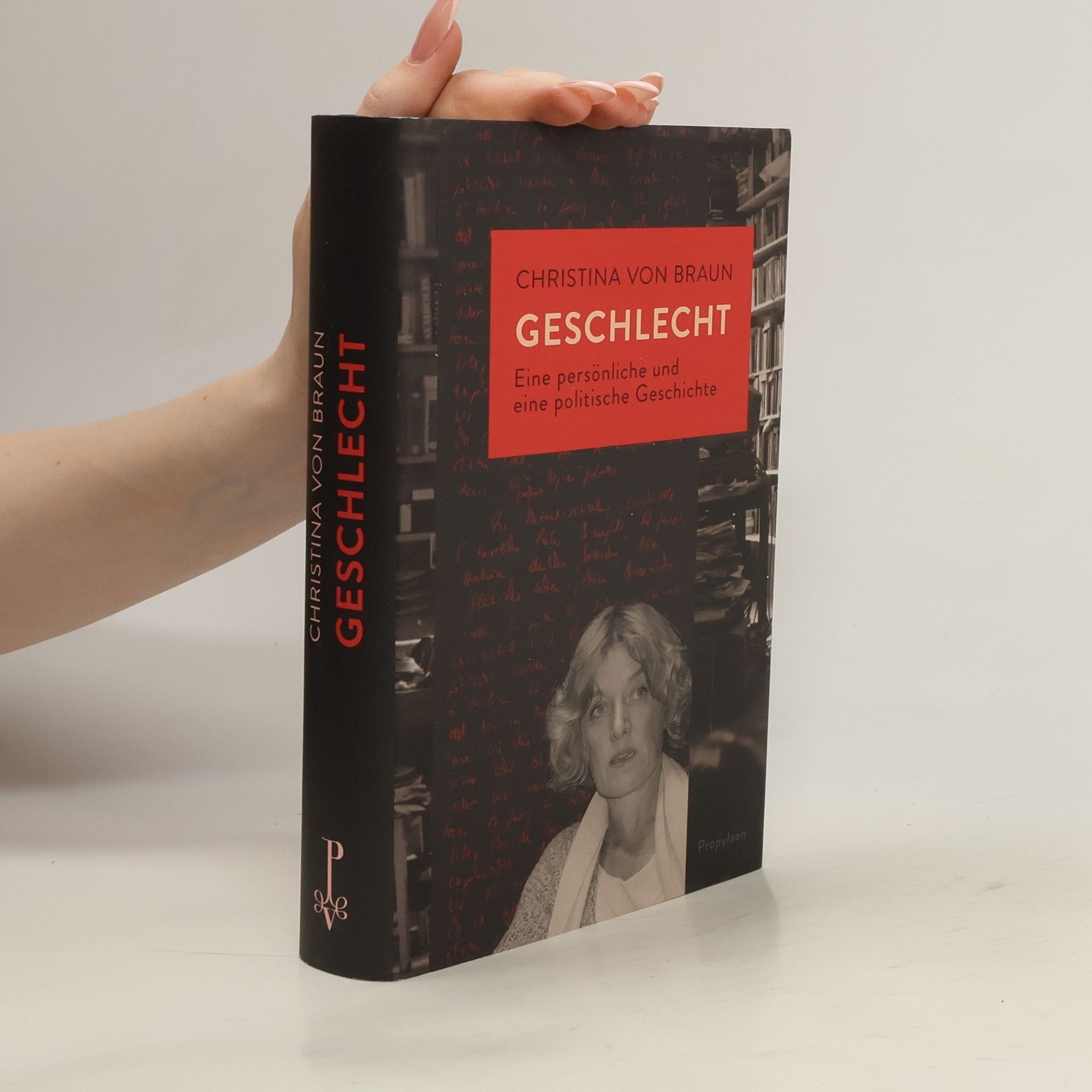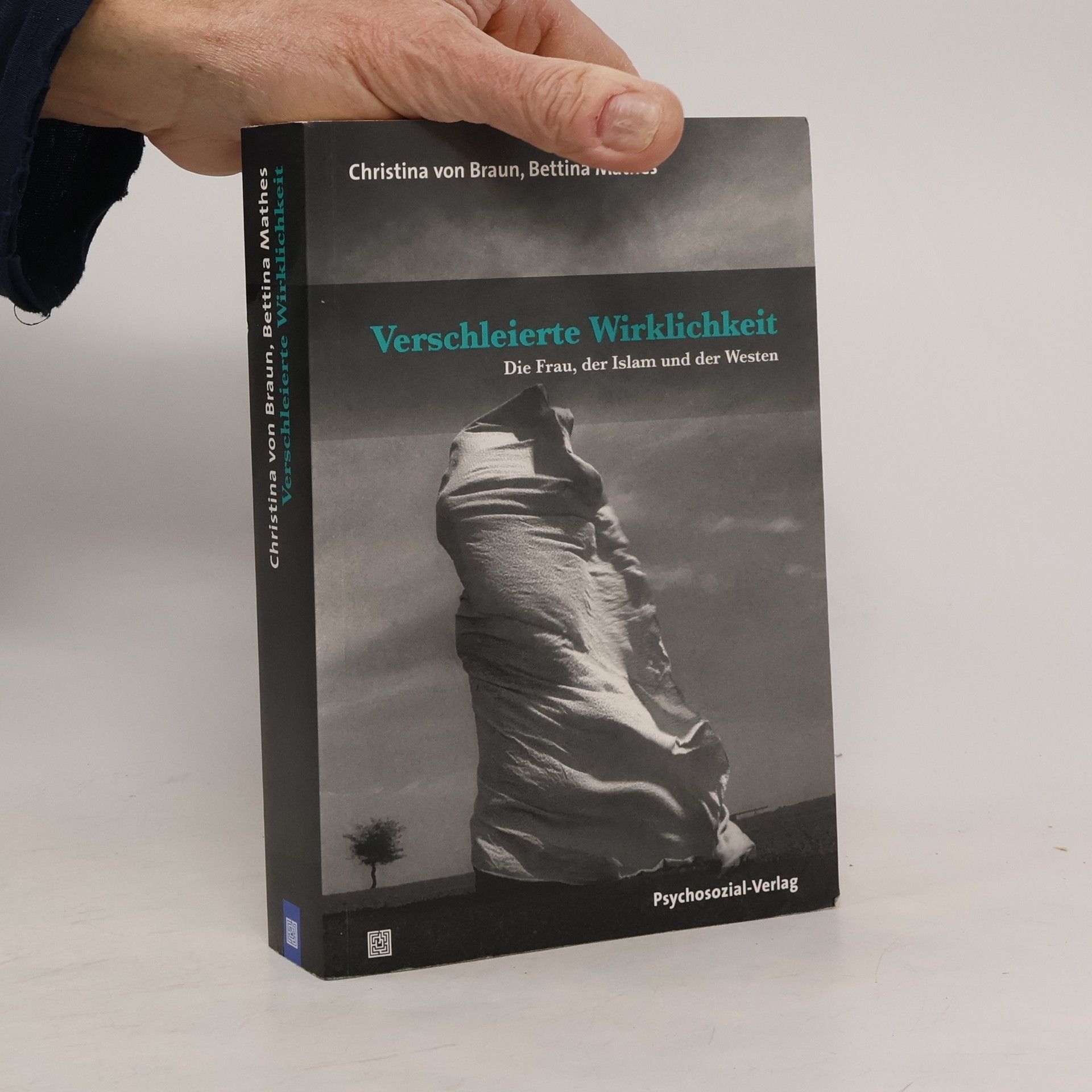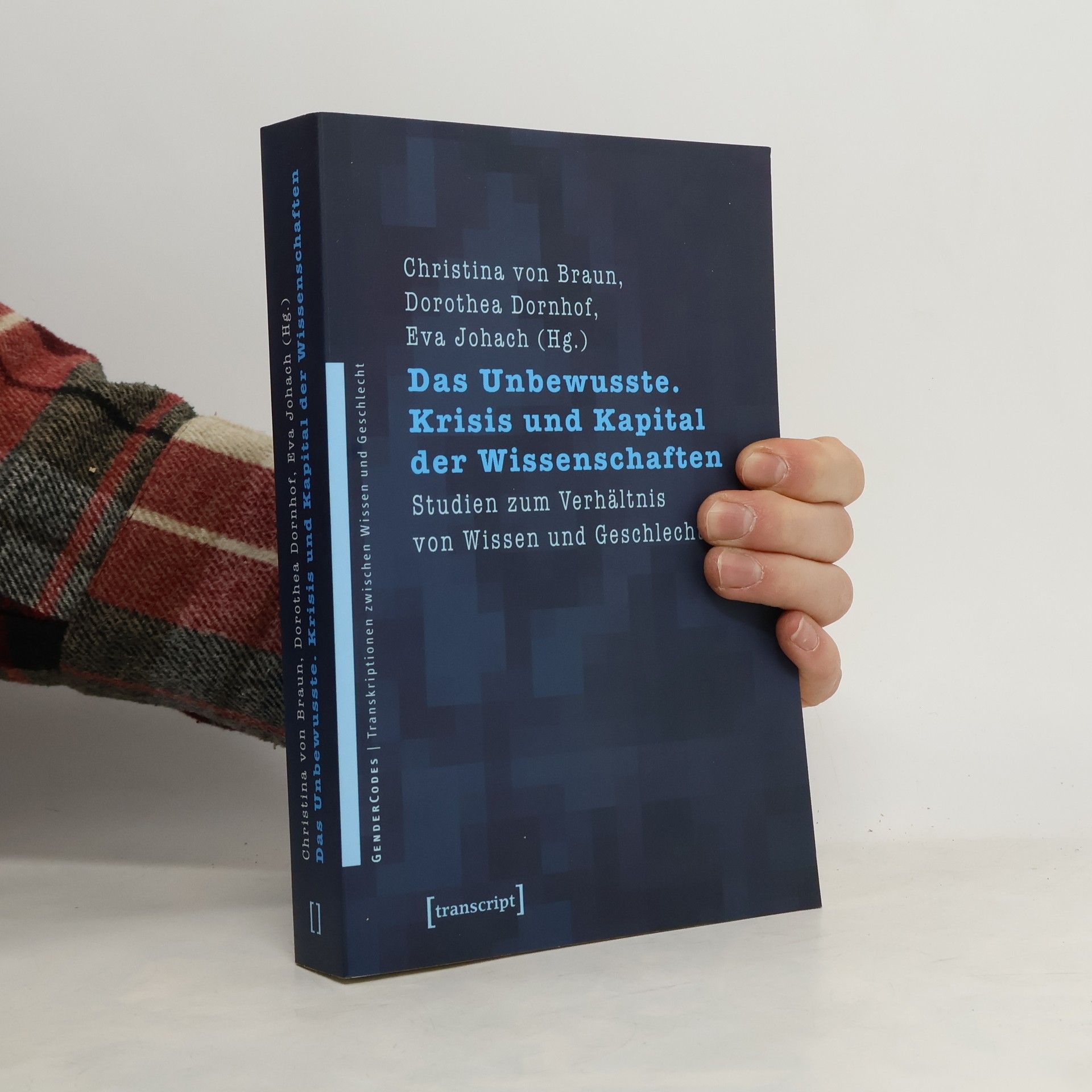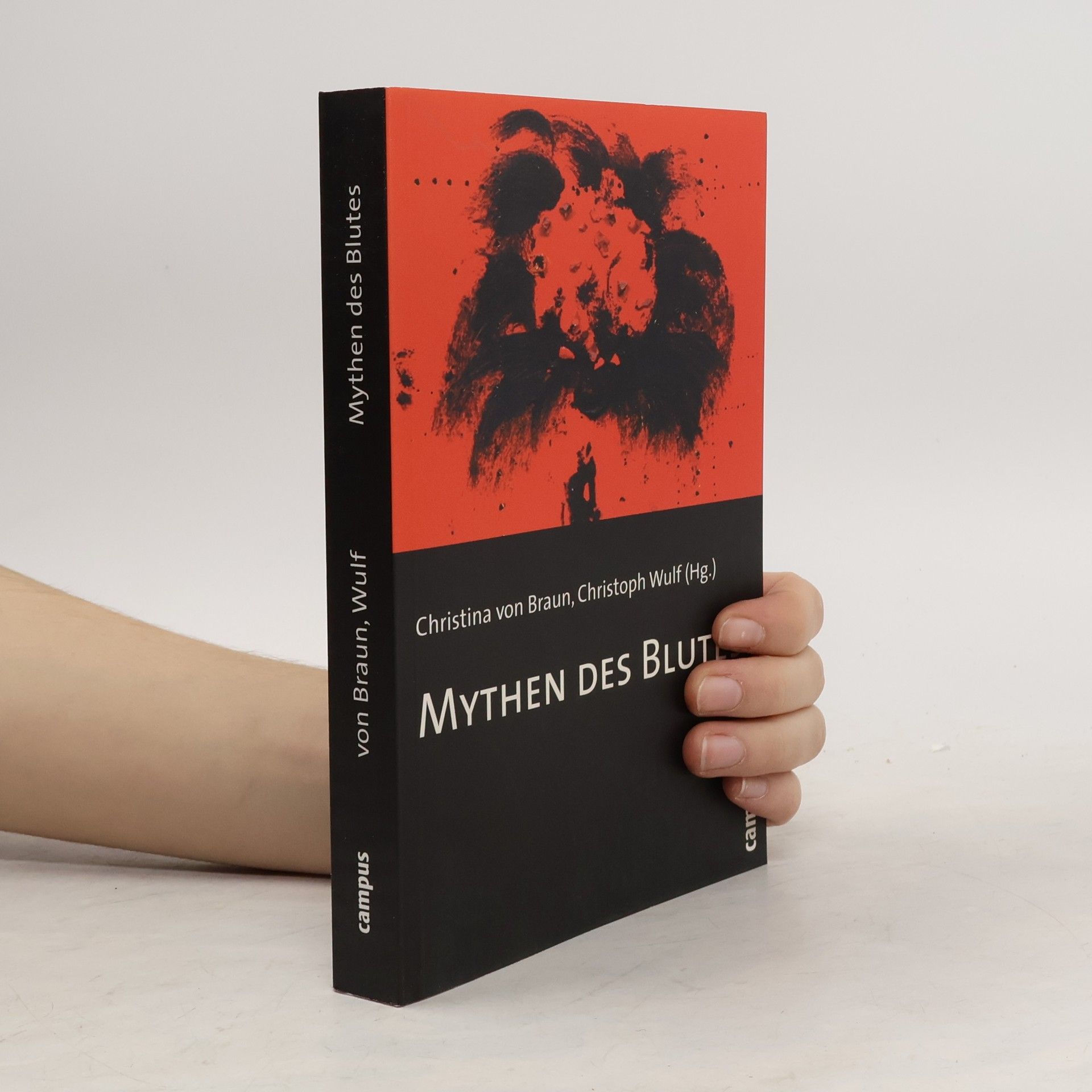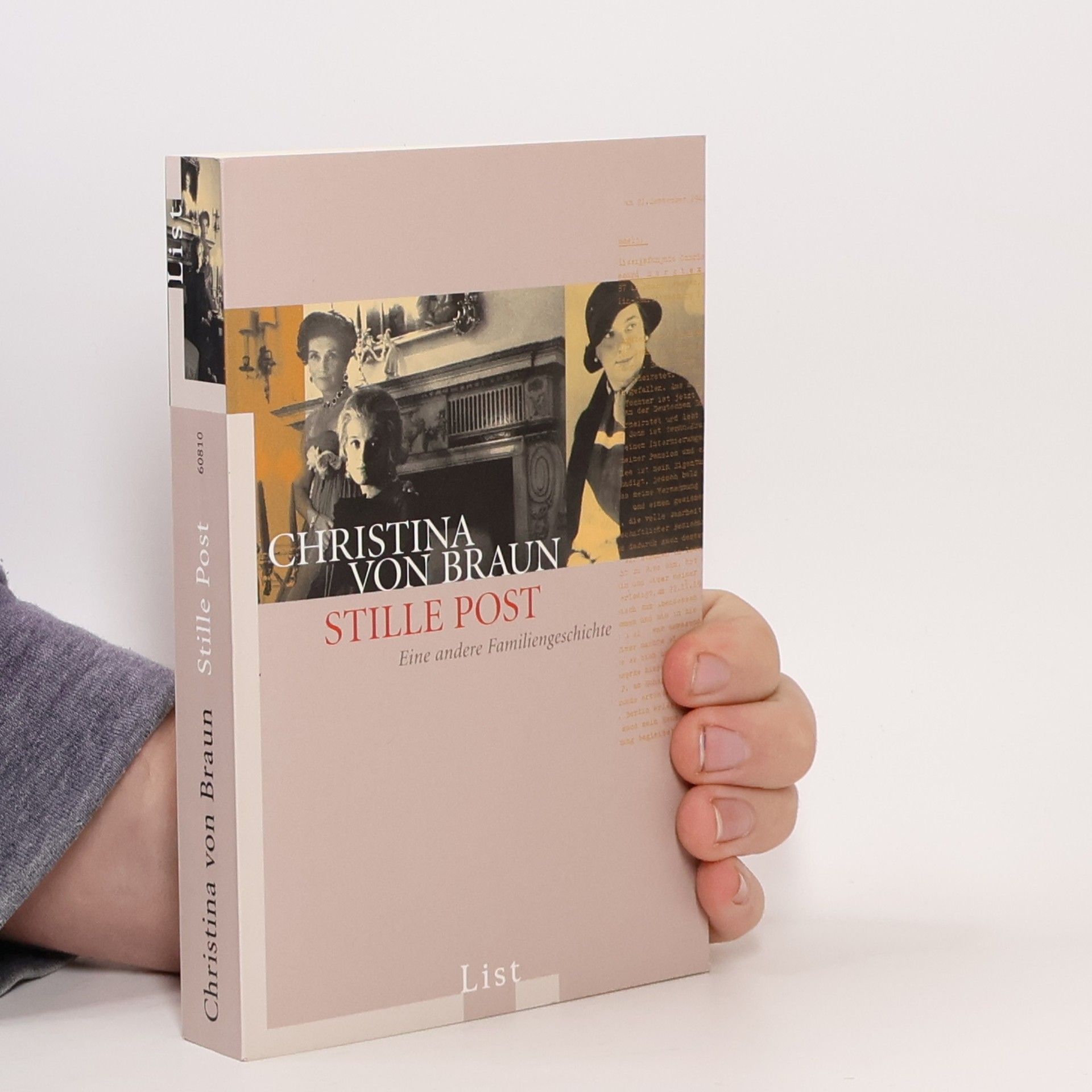Das Unbewusste als Territorium kultureller und politischer Konflikte und wie die Psychoanalyse heute helfen kann, sie zu lösen Die Rede vom Unbewussten begann mit dem Niedergang der Religion um 1800. Hundert Jahre später entstand die Psychoanalyse, die von Anfang an nicht nur Therapieform, sondern auch Instrument des Erkenntnisgewinns und der Kulturkritik war. Die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun und der Psychoanalytiker Tilo Held beleuchten die Bedeutung des Unbewussten für gesellschaftliche Phänomene und Entwicklungen. Von Antisemitismus und Totalitarismus über sich wandelnde Geschlechterrollen bis hin zu Fake News und Verschwörungserzählungen. Eine scharfsinnige Darstellung des »Kampfs ums Unbewusste« der letzten zweihundert Jahre bis heute und Vorschläge, wie eine von anderen Disziplinen bereicherte Psychoanalyse zur Überwindung gegenwärtiger Krisen beitragen könnte.
Christina von Braun Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)





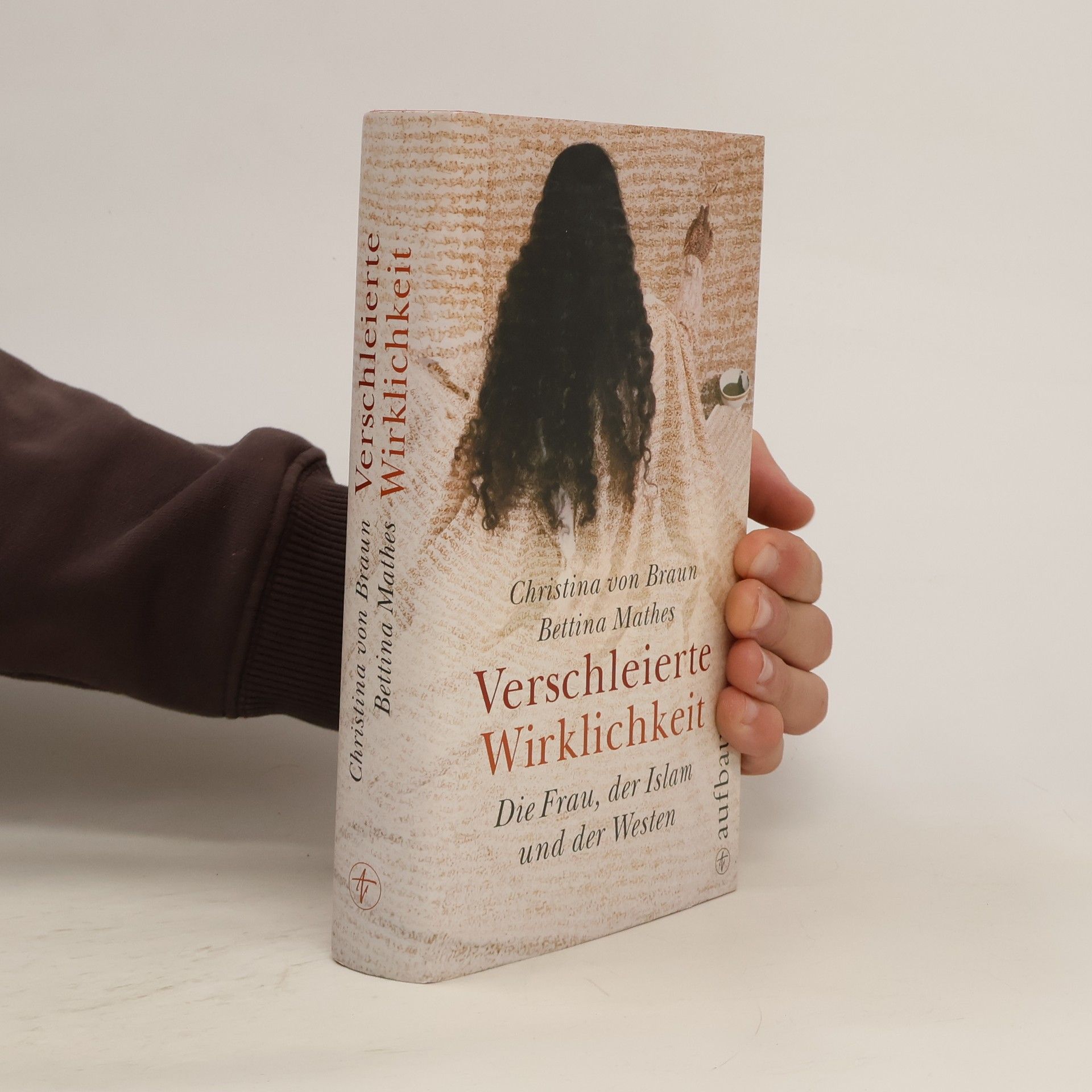
Es war eine ganze Generation von Frauen, die in der jungen Bundesrepublik plötzlich neue Rollen und Lebensentwürfe erprobte und gegen die patriarchalen Strukturen rebellierte. Was trieb sie an? Christina von Braun zeigt am Konfliktfeld „Geschlecht“, wie politische und persönliche Geschichte ineinandergreifen. Und sie erzählt vom unbändigen Drang nach Erkenntnis. Christina von Braun begibt sich auf eine innere Reise, die sie aus dem Deutschland der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart, von Rom, London und New York bis nach Paris und Berlin führt. Wann beginnt eine wohlerzogene Tochter aus liberalem Elternhaus über die Frauenrolle nachzudenken? Welchen Einfluss übt die nie gekannte Großmutter aus? Offen und persönlich erkundet Christina von Braun ihre Geschichte und zugleich die ihrer Generation: Sie erzählt vom feministischen Aufbruch im 20. Jahrhundert, an dem sie als Autorin, Denkerin und Filmemacherin federführend und an entscheidender Stelle beteiligt war. Zugleich erzählt sie von ihrem individuellen Ringen, den Feminismus in alltägliches Leben zu übersetzen: Wie gelingt eine Ehe, in der beide Partner selbstbestimmt entscheiden und ihre Ziele gleichberechtigt verfolgen? Wie schafft man es, Mutter zu sein, ohne auf ein eigenständiges Leben zu verzichten?
Stille Post. Eine andere Familiengeschichte
- 432 Seiten
- 16 Lesestunden
Christina von Brauns Familiengeschichte beleuchtet die Lebensgeschichten ihrer Vorfahrinnen und deren Kämpfe in einem von Männern dominierten Umfeld. Sie thematisiert die Herausforderungen, die Frauen wie ihre Großmutter und Mutter erlebten, und reflektiert über die Auswirkungen patriarchalischer Strukturen bis heute.
Verschleierte Wirklichkeit
- 480 Seiten
- 17 Lesestunden
Mit Beispielen aus Kultur, Religion, Geschichte, Literatur und Ökonomie beleuchten Christina von Braun und Bettina Mathes die Beziehung zwischen den kulturellen Vorstellungen von Weiblichkeit und Männlichkeit im Islam und in den Traditionen der anderen monotheistischen Weltreligionen. Die mit Geschlechtervorstellungen aufgeladenen Bilder und Stereotype des "Orients" erweisen sich bei genauer Analyse als Projektionen des westlichen Subjekts. Der Schleier der muslimischen Frau dient dabei oft als "Leinwand", auf der diese Wunsch- und Angstvorstellungen sichtbar gemacht und verhandelt werden. Die Forderung nach der Rückkehr zu einer traditionellen Geschlechterordnung gibt es heute in allen drei Weltreligionen; sie sind ein Charakteristikum des Fundamentalismus moderner Glaubensrichtungen. Die Analyse dieses Phänomens eröffnet neue Perspektiven auf den nach wie vor stattfindenden Dialog zwischen den Kulturen. Die Autorinnen wechseln die herkömmliche Perspektive und lenken den Blick auf die gegenseitigen Verstrickungen von Orient und Okzident, deren gemeinsame Geschichte von Anpassungen wie von Abgrenzungen gekennzeichnet ist. Ein Wissen um diese Geschichte eröffnet den Weg für ein gesellschaftliches und kulturelles Miteinander, in dem das Fremde nicht als unvereinbar mit dem Eigenen verstanden wird
Der Preis des Geldes
- 510 Seiten
- 18 Lesestunden
Das unverzichtbare Grundlagenwerk: In ihrer brillanten Analyse der Geschichte des Geldes stellt Christina von Braun die Frage in den Mittelpunkt, warum wir an die Macht eines Systems glauben, das kaum jemand mehr versteht. Seit seiner Entstehung hat das Geld einen immer höheren Abstraktionsgrad erreicht: von der Münze über Schuldverschreibungen, Papiergeld bis zum elektronischen Geld. Inzwischen ist der größte Teil des Geldes Kreditgeld, basierend auf Hoffnung, Glauben, Versprechen. In der Ökonomie gibt es einen breiten Konsens darüber, dass das Geld keiner Deckung bedarf. Christina von Braun vertritt die Gegenthese: Das moderne Geld, das keinen materiellen Gegenwert hat, wird durch den menschlichen Körper ‚gedeckt’. Das erklärt nicht nur die extrem unterschiedlichen Einkommensverhältnisse im Finanzkapitalismus, sondern auch die Monetarisierung des menschlichen Körpers, etwa im Söldnerwesen, in der Prostitution, dem Organhandel oder der Reproduktionsmedizin. Die moderne Beglaubigung des Geldes ist schon in seinem Ursprung angelegt und fand in der christlichen Religion den idealen kulturellen Nährboden.
GenderCodes: Das Unbewusste. Krisis und Kapital der Wissenschaften
Studien zum Verhältnis von Wissen und Geschlecht
- 444 Seiten
- 16 Lesestunden
Die Wissenschaft hat eine heilige Scheu vor dem Unbewussten. Für die wissenschaftliche Rationalität stellt es Bedrohung und Faszination zugleich dar - und aus dieser Ambivalenz speist sich auch die geschlechtliche Codierung des Unbewussten durch die Wissenschaften. Doch so sehr sich die wissenschaftliche Logik durch dieses »Andere« gefährdet sieht - sie ist auf diese Störungen angewiesen. Ähnlich wie das Weibliche als Katalysator für die künstlerische Einbildungskraft fungiert, wirkt das Unbewusste als Motor wissenschaftlicher Wissensproduktion.Den vielfältigen Dynamiken des Unbewussten in der Wissens- und Geschlechterordnung will der Band auf die Spur kommen. Die Beiträge befassen sich sowohl mit der Wissensgeschichte des Unbewussten, den unbewussten Gendercodes der Wissensordnung als auch mit dem visuellen und politischen Unbewussten.
Mythen des Blutes
- 369 Seiten
- 13 Lesestunden
Blut ist seit den Anfängen der Kultur Symbol für Leben und Tod und für die körperliche Bedingtheit des Seins. Seine oft als bedrohlich erfahrene Macht ist in zahllosen Mythen und Erzählungen, Bildern und Riten festgehalten – und spielt selbst in den modernen Wissenschaften noch eine Rolle. In diesem Band werden die Metaphorik des Blutes in Judentum, Christentum und Islam sowie die Funktion des Opfers im Hinduismus und im Mittelmeerraum untersucht. Thematisiert wird darüber hinaus die Rolle des Blutes in der Geschichte der Rechtsprechung und der Medizin sowie in den modernen Sozial- und Medienwissenschaften. Mit Beiträgen unter anderem von Micha Brumlik, Walter Burkert, Ute Frevert,William K. Gilders, Brigitta Hauser-Schäublin, Eva Labouvie, Axel Michaels, Angelika Neuwirth, Philipp Sarasin, Gabriele Sorgo und Inge Stephan.
Verschleierte Wirklichkeit : die Frau, der Islam und der Westen
- 476 Seiten
- 17 Lesestunden
Familiengeschichten haben offene und verborgene Gesichter, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Die Kulturwissenschaftlerin Christina von Braun entschlüsselt die Botschaften, die sie vor allem durch die Frauen ihrer Familie im Stil der »Stillen Post« erhielt. Sie verknüpft eigene Erinnerungen, innere Zwiesprache mit Verstorbenen und die reichen Quellen ihres Familienarchivs, darunter Briefe, Tagebücher und unveröffentlichte Memoiren. Im Mittelpunkt steht ihre Großmutter Hildegard Margis, die 1944 wegen ihrer Kontakte zum kommunistischen Widerstand von der Gestapo verhaftet und im Gefängnis starb. Die Autorin möchte dieser politisch engagierten, beruflich erfolgreichen und eigenständigen Frau ein Denkmal setzen. Zudem erzählt sie von ihren Eltern, Hilde und Sigismund von Braun, die während des Krieges nach Afrika und später in den Vatikan gingen, wo ihr Vater an der deutschen Botschaft arbeitete. Auch der Onkel Wernher von Braun, der in Peenemünde Raketen für Hitler baute und nach dem Krieg in die USA ging, sowie die Großeltern von Braun, die aus Niederschlesien vertrieben wurden, und der Onkel Hans, den die Mutter in die Sicherheit Englands schickte, werden thematisiert. Diese turbulenten Lebenswege fügen sich zu einem faszinierenden Gesamtbild deutscher Geschichte im 20. Jahrhundert.
Säkularisierung : Bilanz und Perspektiven einer umstrittenen These
- 204 Seiten
- 8 Lesestunden
In den vergangenen Jahren hat die Frage nach der Rolle der Religion in der modernen Gesellschaft neu an Aktualität gewonnen. Angesichts einer globalen „Rückkehr der Religion“ sind traditionellen Annahmen, nach denen zunehmende Modernisierung zwangsläufig zur Säkularisierung führt, fragwürdig geworden. Dabei muss die Vielfältigkeit dieser Entwicklungen, in Russland und den USA, im Nahen Osten und in Westeuropa, für ihr Verständnis berücksichtigt werden. Zu einer solchen differenzierten Weiterführung der Diskussion über Säkularisierung leistet dieses Buch einen Beitrag. Es enthält Texte von Christina von Braun, Ulrich Dehn, Wilhelm Gräb, Peter Heine, Hermann Lübbe, Heinz Ohme, Rolf Schieder, Richard Schröder, Cornelia Wilhelm und Johannes Zachhuber.