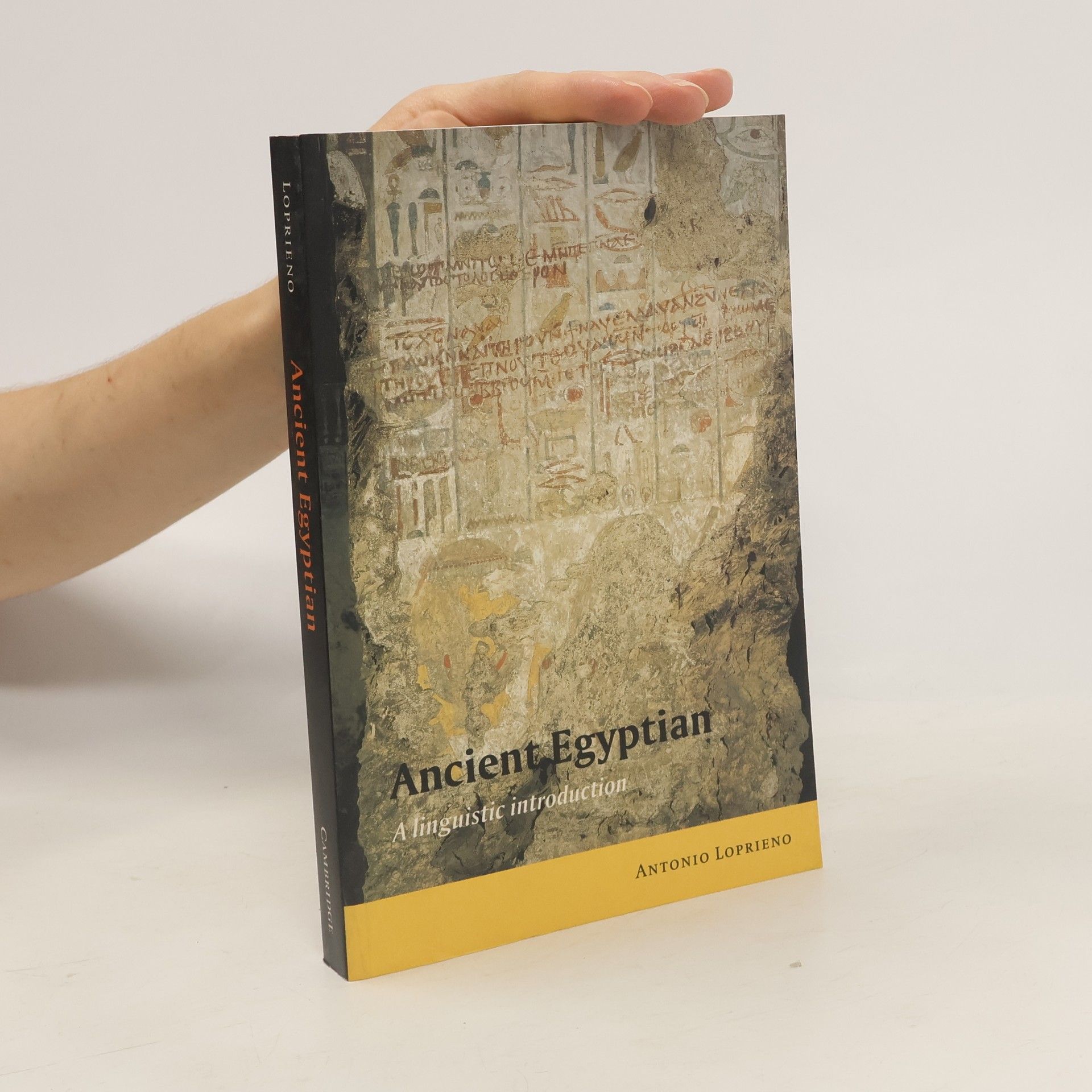Die entzauberte Universität
Europäische Hochschulen zwischen lokaler Trägerschaft und globaler Wissenschaft
Europäische Universitäten sind in der Defensive. Politik und Wirtschaft setzen sie unter Druck. Sind Professoren und Studierende zu leise – oder Rektoren zu mächtig geworden? In den letzten fünfzehn Jahren haben europäische Hochschulen einen Wandel erfahren, der sie von Ordinarien-Universitäten zu autonomen Institutionen geführt hat. Dieser Wandel betrifft einerseits die betriebliche Sphäre mit der Entwicklung einer engmaschigen Verwaltung, andererseits aber auch die Kernaufgaben Lehre und Forschung: Vermehrt wird die Qualität einer Universität in der wissenschaftlichen Exzellenz und nicht in der Erfüllung eines Bildungsideals gesehen. Die Strategie hat das Leitbild ersetzt. Vor allem im deutschsprachigen Raum hat dieser epochale Wandel zu einer ‚Entzauberung‘ des traditionellen Modells von Universität und zur Erwartung einer klaren Profilierung geführt. Aber die Erwartung ist widersprüchlich: Politische und ökonomische Akteure versprechen sich von der Universität regionale Standortvorteile, wohingegen sich die Wissenschaft immer mehr international ausrichtet. Was tun?