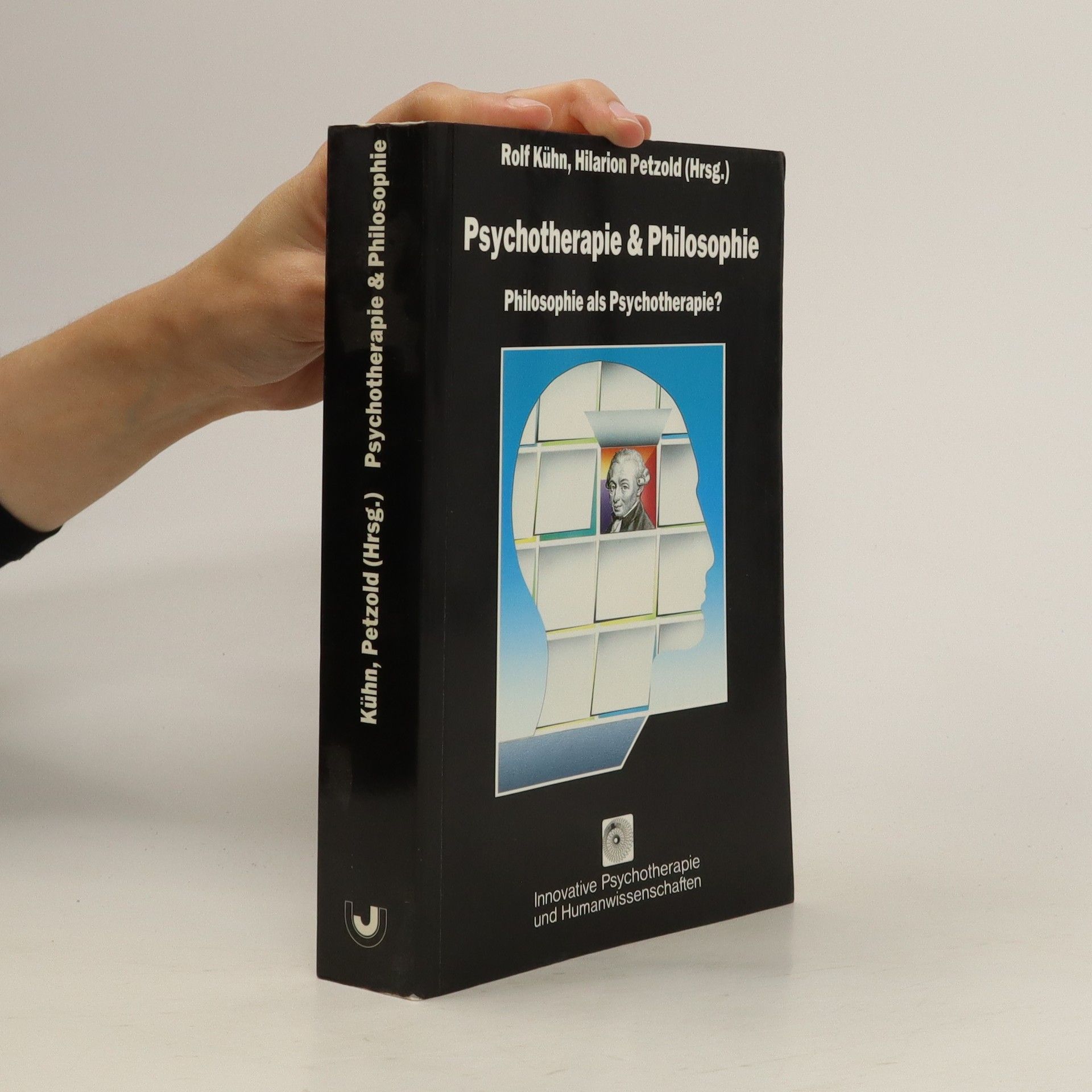Kultur als Unmittelbarkeit des Lebens
- 624 Seiten
- 22 Lesestunden
Bestimmt man radikal phänomenologisch die Kultur als Subjekt wie Objekt ihrer selbst, dann beinhaltet dies eine jeweils gegebene Unmittelbarkeit des Lebens als Originarität aller subjektiv kulturellen Vollzüge. Dies wird methodisch in Auseinandersetzung mit empirischen wie transzendentalen Kulturanalysen wie bei Freud, Husserl, Henry und Derrida aufgegriffen, um sich danach inhaltlichen Manifestationen der Kultur wie Religion, Wissenschaft und Ästhetik zuzuwenden. Leitend bleibt dabei für die Zukunftsbestimmung unserer Kultur eine notwendige ko-pathische Aufmerksamkeit für das Leben, welche die Singularität aller kulturellen Vollzüge über die diskursive Begrenztheit eines rein objektivierenden Verständnisses hinaus am Werk sieht. Dabei wird auch dem Imaginären wie Fiktionalen ihr unumgehbares Recht eingeräumt, wie es besonders in der Kunst als Meta-Genealogie des Individuums und der Gemeinschaftlichkeit zum Ausdruck kommt. Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung.- Einleitung: Kulturverständnis und Methodenpluralität.- Teil 1: Genetisch-phänomenologische Kulturtheorien.- Freudsche Kulturkritik.- Empirisch-transzendentale Kulturanalyse.- Kultur als originäre Lebenserprobung.- Teil 2: Ursprünge der Kulturmanifestation.- Religion und Kultur.- Globale Technik-Wissenschaft und Kulturkrise.- Zukunft der Kulturbestimmung.- Ausblick: Aufmerksamkeit für das Leben.- Glossar.- Bibliographie.- Personenregister.- Sachverzeichnis.- Zum Verfasser.