Homo cerebralis
- 380 Seiten
- 14 Lesestunden
German



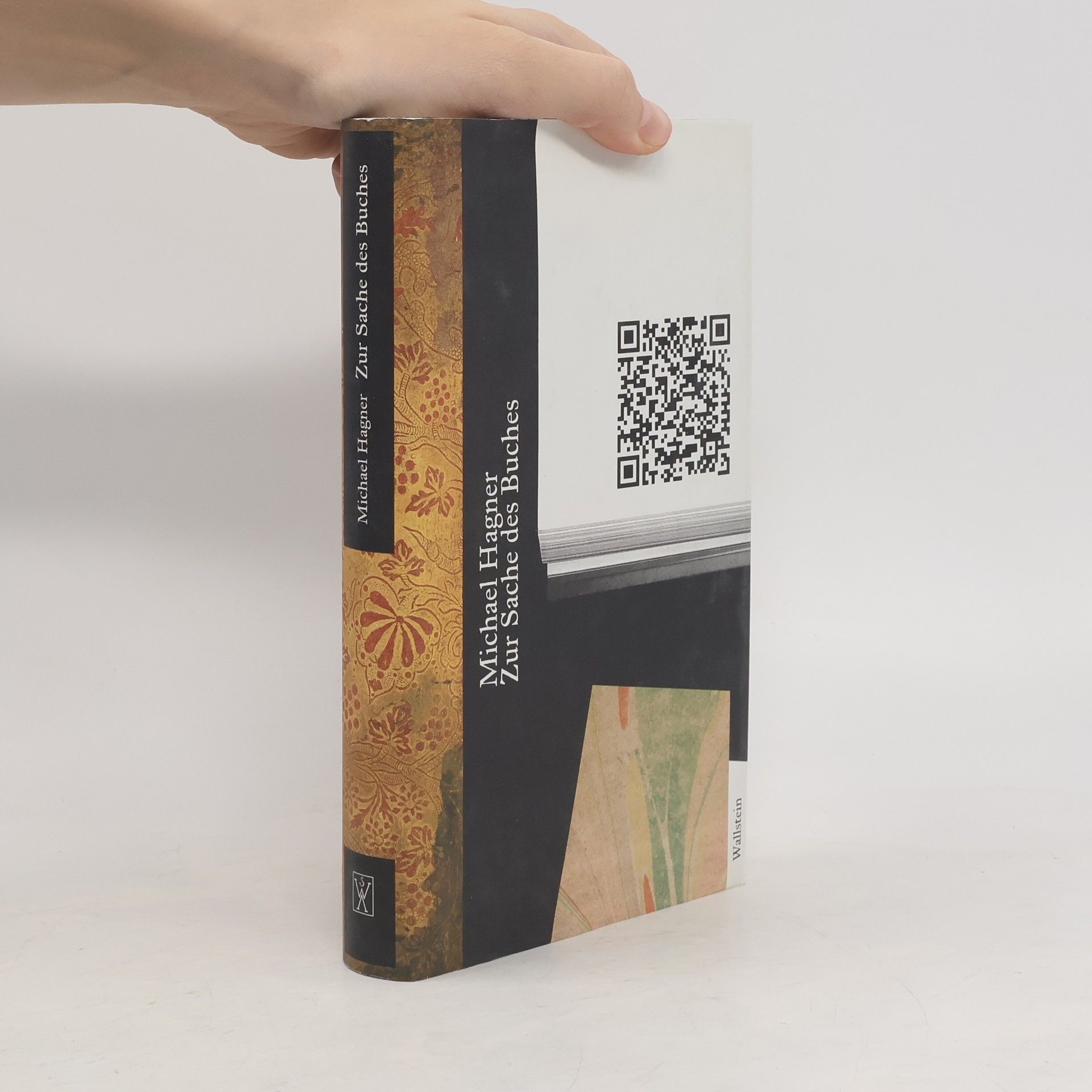
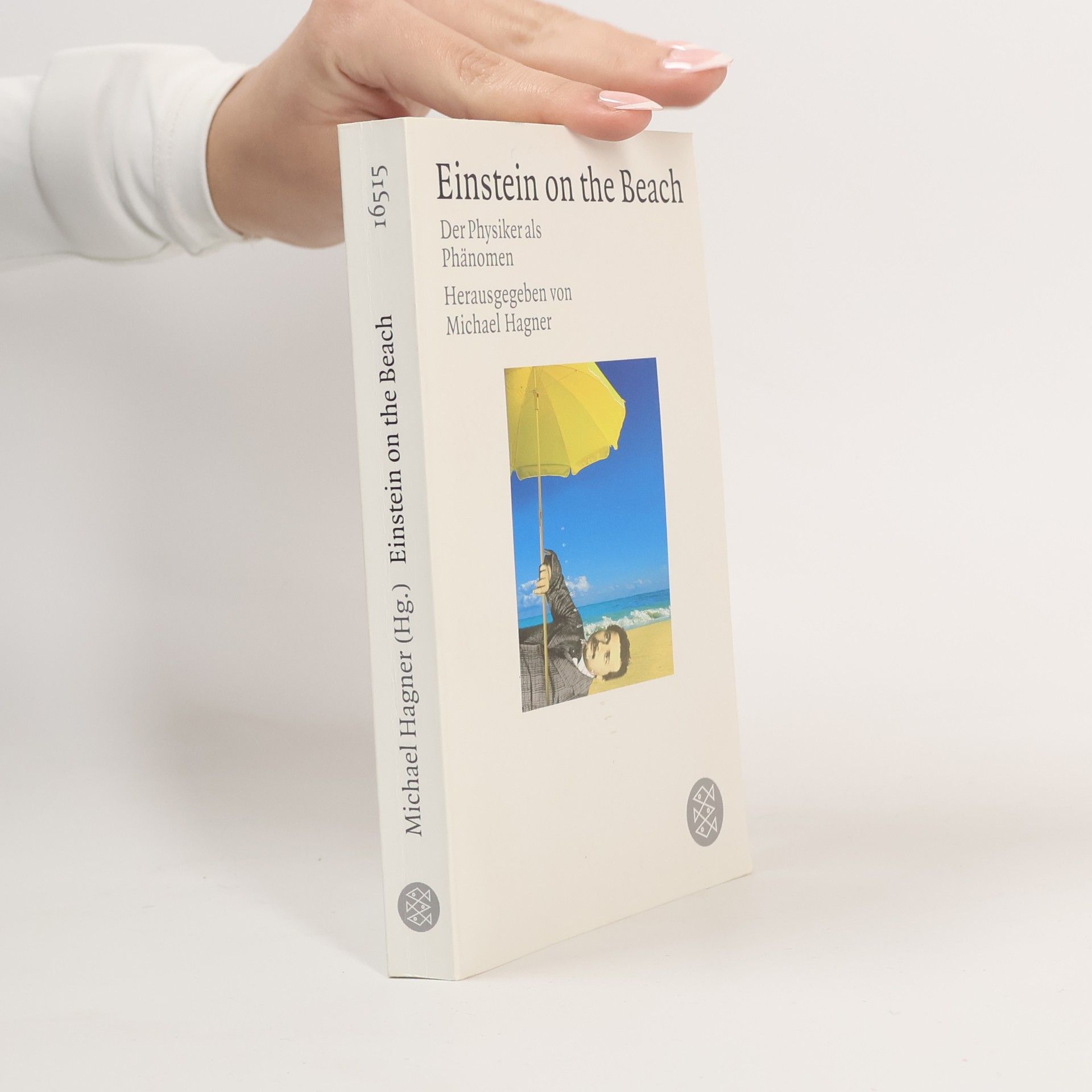

German
Das gedruckte Buch galt lange Zeit unangefochten als das wichtigste Organ geisteswissenschaftlicher Forschung. Doch in den letzten Jahren ist ein ganzes Gefüge von Medien, Werten und Praktiken in Bewegung geraten. Mit den Möglichkeiten digitaler Forschung und Kommunikation sowie Forderungen nach einer Standardisierung von Publikationen wirkt das Schreiben und Drucken von Büchern bisweilen fast wie ein Anachronismus mit begrenzter Lebensdauer. Die Kritik am gedruckten Buch offenbart ein Stück Kulturkritik, die ihr Unbehagen an der Gegenwart mit einer übertriebenen Erwartung an die technischen Möglichkeiten des Digitalen verbindet. Anstatt die unterschiedlichen Stärken von Papier und Digitalisat hervorzuheben und zu fragen, wo mögliche Synergien liegen könnten, wird ein rivalisierender Gegensatz zwischen beiden postuliert, der eine Entscheidung verlangt. In seinem neuen Buch verbindet Michael Hagner seine Analyse der digitalen Kulturkritik am Buch mit einer gründlichen Betrachtung von Open Access. Dabei durchleuchtet er auch jenes Phänomen, das für die gegenwärtige Krise des Buches mit verantwortlich ist: das unübersehbare Angebot an wissenschaftlicher Literatur.
Im Oktober 1903 findet in Bayreuth ein aufsehenerregender Kriminalprozeß statt, in dem der 23jährige Jurastudent Andreas Dippold angeklagt ist, als Hauslehrer seine beiden Schüler so schwer misshandelt zu haben, dass einer von ihnen stirbt. Dippold beruft sich auf die Rechtmäßigkeit seines Handelns, da die Jungen sich der Onanie hingegeben hätten. Die wohlhabenden Eltern, darunter der Vater, der an der Spitze der Deutschen Bank steht, setzen alles daran, Dippold als gefährlichen Sexualstraftäter darzustellen. Das Gericht verurteilt ihn zu acht Jahren Zuchthaus, was einen Aufschrei der Empörung auslöst, da viele das Urteil als zu mild empfinden. Eine hitzige Debatte entfaltet sich in den Zeitungen des Kaiserreichs, an der auch prominente Publizisten wie Maximilian Harden teilnehmen. Michael Hagner erzählt die Geschichte des Hauslehrers, der Jungen und der Eltern bis zum Prozeß und untersucht anschließend die Praktiken von Justiz, Medizin und Medien, die aus den komplexen Ereignissen einen Skandal konstruieren. Dieser führt zu intensiven Diskussionen in Pädagogik, Kriminologie und Sexualwissenschaft und wird als Beispiel für Erziehersadismus in Lehrbüchern festgehalten. Hagner überschreitet souverän die Grenze zwischen Erzählung und Wissenschaft und zeichnet ein düsteres Bild von der Kompromißlosigkeit der Erziehung und den Ansichten der gebildeten Kreise Deutschlands über Bildung, Sexualität und Bestrafung.
Das Buch bietet eine faszinierende Sammlung von 99 Einzelbildern aus österreichischen Filmen seit 1945, die durch die Perspektiven von 100 internationalen Schriftstellern und Publizisten kommentiert werden. Es spielt mit der Idee, die filmische Zeit anzuhalten und beleuchtet die Geschichten und die Bedeutung hinter den Bildern. Die Vielfalt der Stimmen aus den Bereichen Kritik, Filmtheorie und Wissenschaft schafft einen einzigartigen Dialog zwischen Bild und Text und eröffnet neue Einsichten in die österreichische Filmgeschichte.
Die Lust am Text – die Veröffentlichung von Roland Barthes war in den 1970er Jahren ein erfolgreicher Weckruf an die Theorie und Praxis der Leser. Die Lust am Buch von Michael Hagner ist ein Weckruf zur Demonstration der unhintergehbaren Rolle des Buches im digitalen Zeitalter. Hier vermischen sich Liebeserklärungen an das Ding Buch mit Einsprüchen gegen Fehlentwicklungen. Auf engstem Raum, in der kurzen Form prallen aufeinander Mikroessays, Lesebilder, Lustschilder und Warnschilder, Buchgeschichten und Anekdoten, die die Lust am Buch auf den eigenen Lebenswegen in Erinnerung rufen. Ein Buch der Lust also, bestehend aus Miniaturen in alphabetischer Unordnung – wie Bücher einer imaginären Bibliothek.
Dieser Band informiert über die zentralen Werke der Naturwissenschaften von der Antike bis zur Gegenwart z. B. von Euklid, Kopernikus, Galilei, Newton, Linné, Lavoisier, Darwin, Mendel, Hertz, Einstein, Schrödinger und Latour. - Die Einleitung bietet einen Überblick über die allgemeine Entwicklung der Naturwissenschaften und eine Einordnung der Werke in die Kulturgeschichte.
Zur Geschichte der Elitegehirnforschung
Michael Hagner beschreibt die Sammlung und Erforschung der Gehirne bedeutender Persönlichkeiten als eine Geschichte, in der sich wissenschaftliche und kulturelle Aspekte miteinander verweben. Die Vorstellung, dass Schädel und Gehirne außergewöhnlicher Menschen besondere Eigenschaften besitzen, hat ihre Wurzeln im 18. Jahrhundert. Die Trias von Genie, Kriminalität und Geisteskrankheit bildete eine Grundlage für die menschliche Erkenntnis. Was als kuriose Schädelbetrachtung begann, entwickelte sich zu einem umfassenden wissenschaftlichen Programm. Hagner argumentiert, dass die Gehirne bedeutender Gelehrter und Künstler nicht nur wissenschaftliche, sondern auch kulturelle Objekte sind, die eine säkularisierte Erinnerungskultur repräsentieren. Anhand zahlreicher Beispiele wird die Forschung an außergewöhnlichen Gehirnen von der Kraniologie bis zum modernen Neuroimaging beleuchtet. Geniale Gehirne wurden in verschiedenen historischen Kontexten bedeutend, von der Genieverehrung um 1800 bis zu den politischen Umbrüchen der Weimarer Republik und der frühen Nationalsozialismus. Hagner zeigt, dass die neurophilosophische Idee einer Eins-zu-eins-Korrespondenz zwischen Gehirn und geistigen Zuständen bereits vor 200 Jahren faszinierte. Die Wissenschaftsgeschichte sucht heute ihren Platz in der Kulturgeschichte und strebt danach, Brücken zwischen Natur- und Geisteswissenschaften zu bauen, was neue Formen der Reflexion und Präsentation erfor
Die Geschichte der Monstrositäten und Mißbildungen reicht bis zu den Anfängen der Menschheit zurück. Monster waren von mythologischen Figuren der Antike bis zu anatomischen Sammlungen und den Kreaturen Frankensteins sowohl Gegenstand von Abscheu als auch Faszination. Der Fokus liegt jedoch nicht auf einem voyeuristischen Rundgang durch das Horror-Kabinett, sondern auf den historischen Kontexten, in denen von Monstern gesprochen wird und was sie repräsentieren. Themen wie politische Propaganda, Nationalismus, Religion, Medizin, Sexualität, Biologie, Ästhetik, Kriminalistik und Psychiatrie sind eng mit Monstrositäten verknüpft. Oft wird übersehen, dass die Wissenschaft des 19. Jahrhunderts zur Schaffung neuer Monstrositäten mit ähnlichen Attributen wie in der Antike beitrug. Die neun Beiträge des Bandes zielen darauf ab, diese Zusammenhänge darzustellen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die Diskussion über Abweichung und Andersartigkeit in einem systematisierenden Kontext niemals neutral ist. Die Beiträge umfassen Themen wie die Geschichte der Monstrositäten, den mißgebildeten Menschen, Darstellungen in der Kunst, den Übergang von Naturalienkabinette zur Embryologie und die Wahrnehmung von Monstern und Verrückten im 18. Jahrhundert in Frankreich.
Nach »Homo cerebralis« und »Geniale Gehirne« nun der abschließende Teil einer Trilogie zur Geschichte des modernen Gehirns. »Geist und Bewußtsein sind nicht vom Himmel gefallen, sondern haben sich in der Evolution der Nervensysteme allmählich herausgebildet« - dies manifestierten Hirnforscher im Jahr 2004. Auch diese Erkenntnis ist nicht vom Himmel gefallen, sondern das Ergebnis einer 200jährigen Geschichte. Dabei waren die Theorien der Hirnforscher, mit denen sie versuchten, Sprache, Denken, Einbildungskraft, Moral und Gefühle im Gehirn zu lokalisieren, zu keinem Zeitpunkt unabhängig von den kulturellen, sozialen und politischen Umständen, unter denen sie ihre Forschungen betrieben. Die Cerebralisierung des Menschen ist ein unvollendetes und möglicherweise unvollendbares Projekt der Moderne. Neben faszinierenden Einsichten birgt es stets auch die Gefahr in sich, »Gehirn« mit Symbolen, Deutungen und Werten zu überfrachten und dadurch überzogene Erwartungen zu wecken, die nicht zu erfüllen sind oder zu heiklen biopolitischen Forderungen führen. Anthropologische Ansprüche an die Hirnforschung bewegen sich eher an der Grenze zwischen Science und Fiction. Vor dem Hintergrund dieser Debatten plädiert Michael Hagner für einen gelassenen und (selbst-)kritischen Umgang mit ihren Ergebnissen.