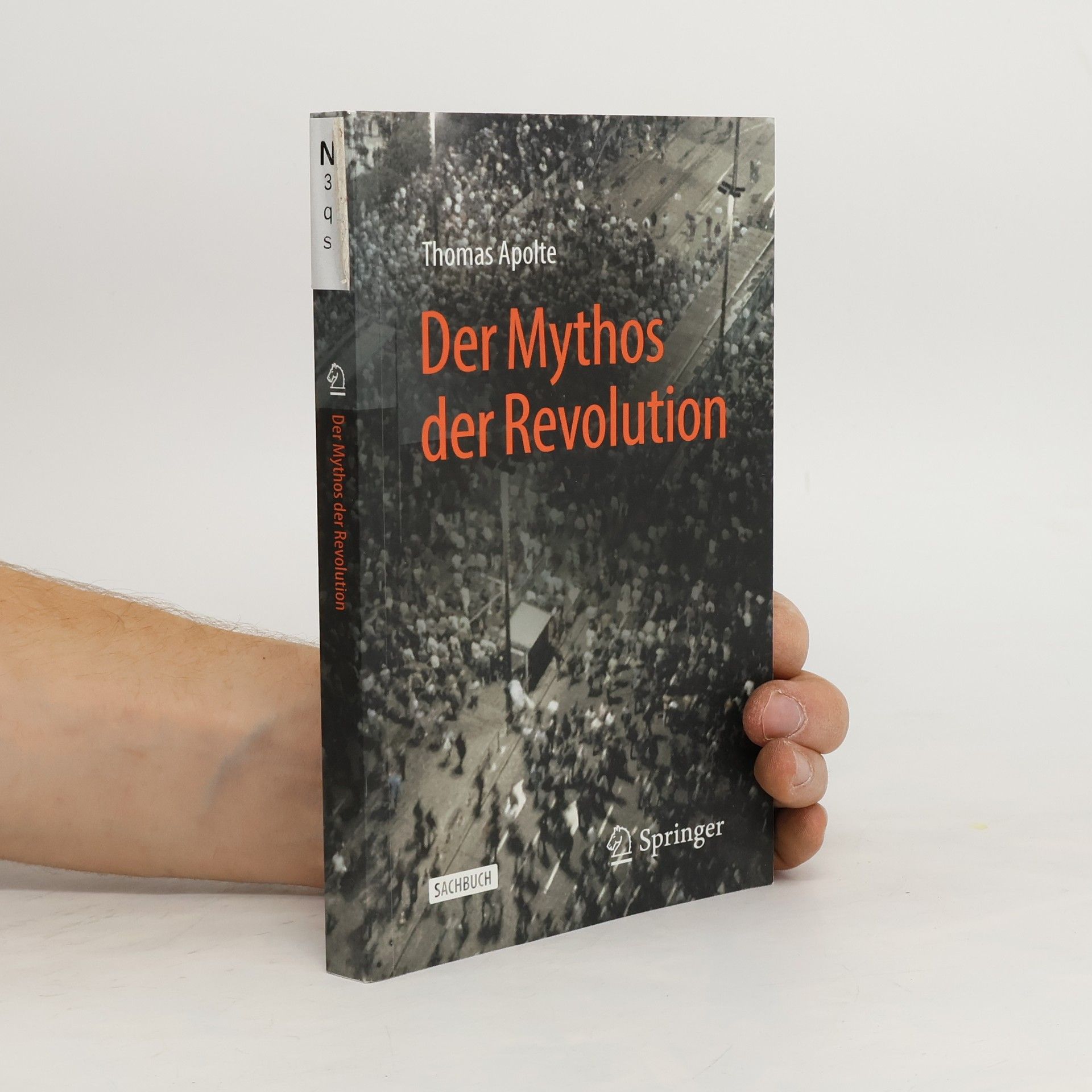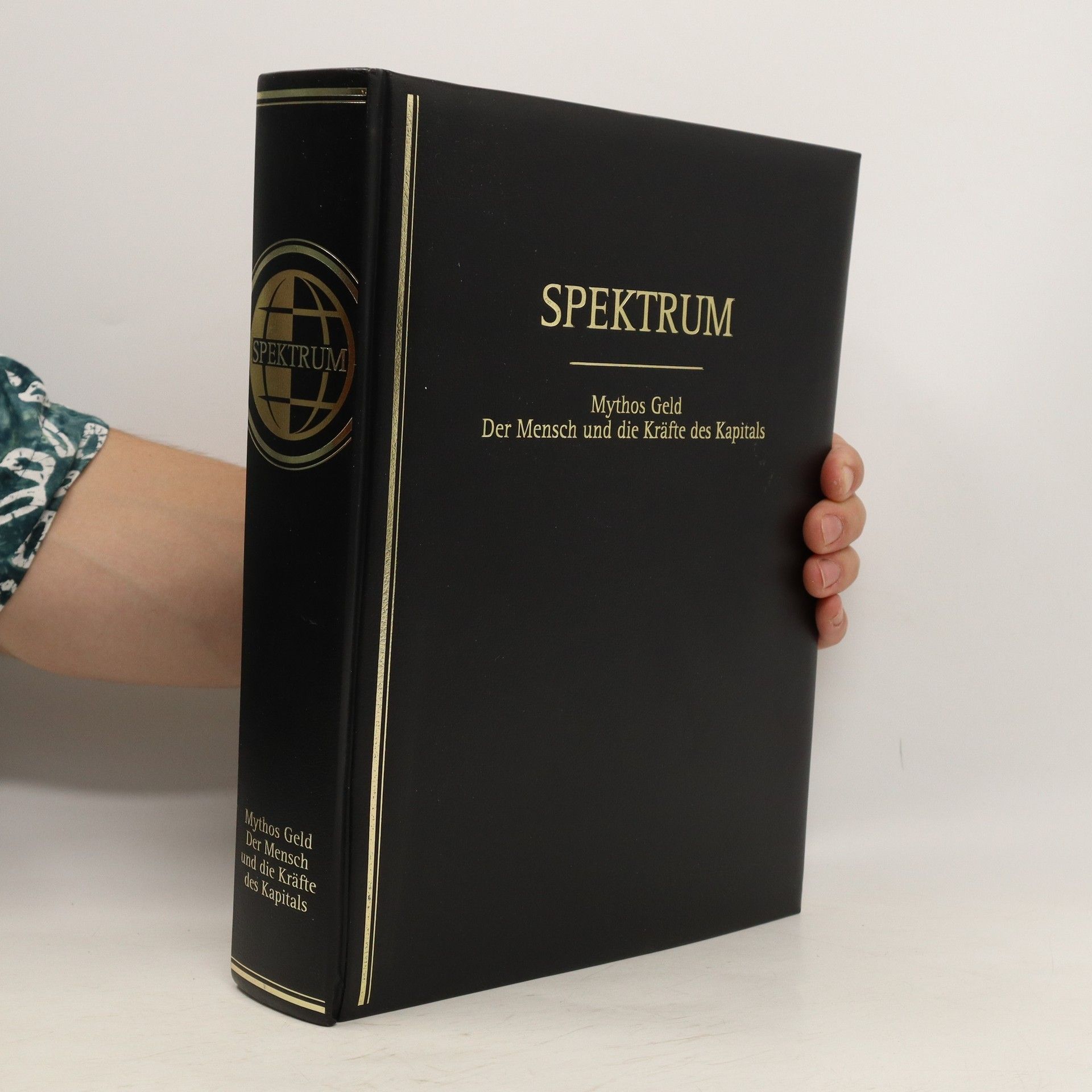Demokratie - Gerechtigkeit - Partizipation
- 198 Seiten
- 7 Lesestunden
Im 21. Jahrhundert steht die Demokratie in Deutschland und weltweit vor ganz neuen, bislang ungekannten Herausforderungen. Die Schere zwischen Arm und Reich weitet sich, demokratiefeindliche Tendenzen wachsen in virtuellen Halböffentlichkeiten und die Corona-Pandemie verstärkt zudem soziale Ungleichheiten und schwächt die Wirtschaftskraft. Wie kann eine gerechte Gestaltung der demokratischen Grundordnung vor diesem Hintergrund aussehen? Wie können die Partizipation aller Bürgerinnen und Bürger gestärkt, ein fairer Zugang zu Bildung gesichert und Solidarität in Wirtschaft und Gesellschaft garantiert werden? Antworten zu diesem herausfordernden und aktuellen Themenkomplex geben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Fachdisziplinen.