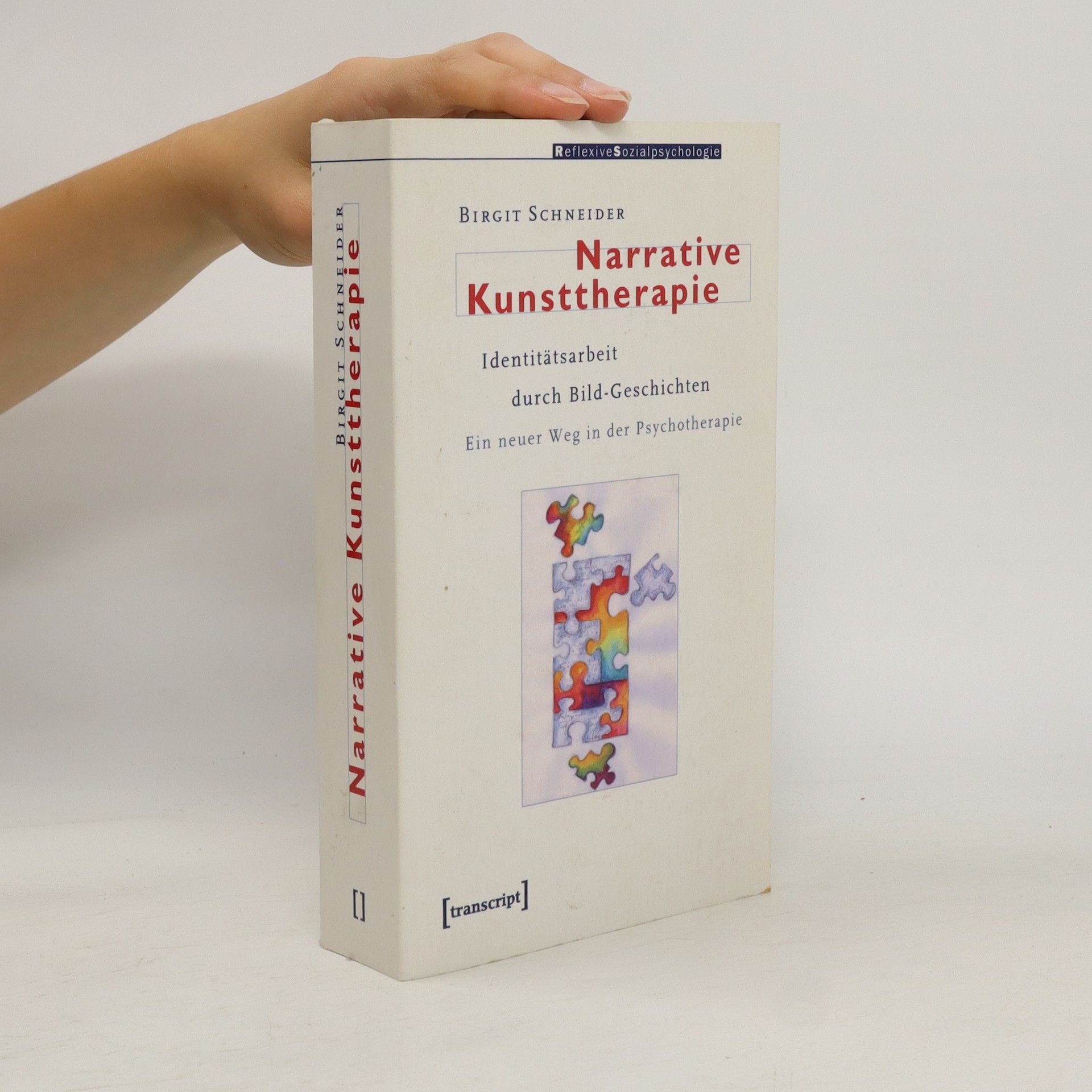Das zentrale Prinzip der frühen Informationsverarbeitung mittels Lochkarten entstand aus einem Kunsthandwerk, nämlich aus der Seidenweberei. »Die ersten Bilder, die von ihrem Bildkörper abgelöst wurden, um als Bildcode verarbeitet zu werden, waren Gewebe. Der Bildcode bestand aus einem Stapel gelochter Karten für die Verwendung im Steuerungsmechanismus eines Webstuhls und war hier noch begreifbar: das Bild, wenn es aus dem Stapel dieser Karten gewoben wurde, war ein textil-taktiles Produkt.« Im Nachzeichnen einer Historiographie der Lochkarte gelangt die Autorin an einen Quellpunkt der Digitalisierung: Im Kontext der Höfe und insbesondere des absolutistischen französischen Hofes begann die Geschichte von Automatenbau, Kybernetik und Steuerung, zu deren Hauptprotagonisten die Musterweberei zählte. Weshalb gerade diesem Handwerk diese Rolle zukam, ist bislang noch nicht zum Gegenstand systematischer Erforschung geworden. Der reich bebilderte Band zeigt sowohl die technokulturellen Kontexte wie auch die ideengeschichtlichen Bedingungen elektronischer Bilder.
Birgit Schneider Bücher
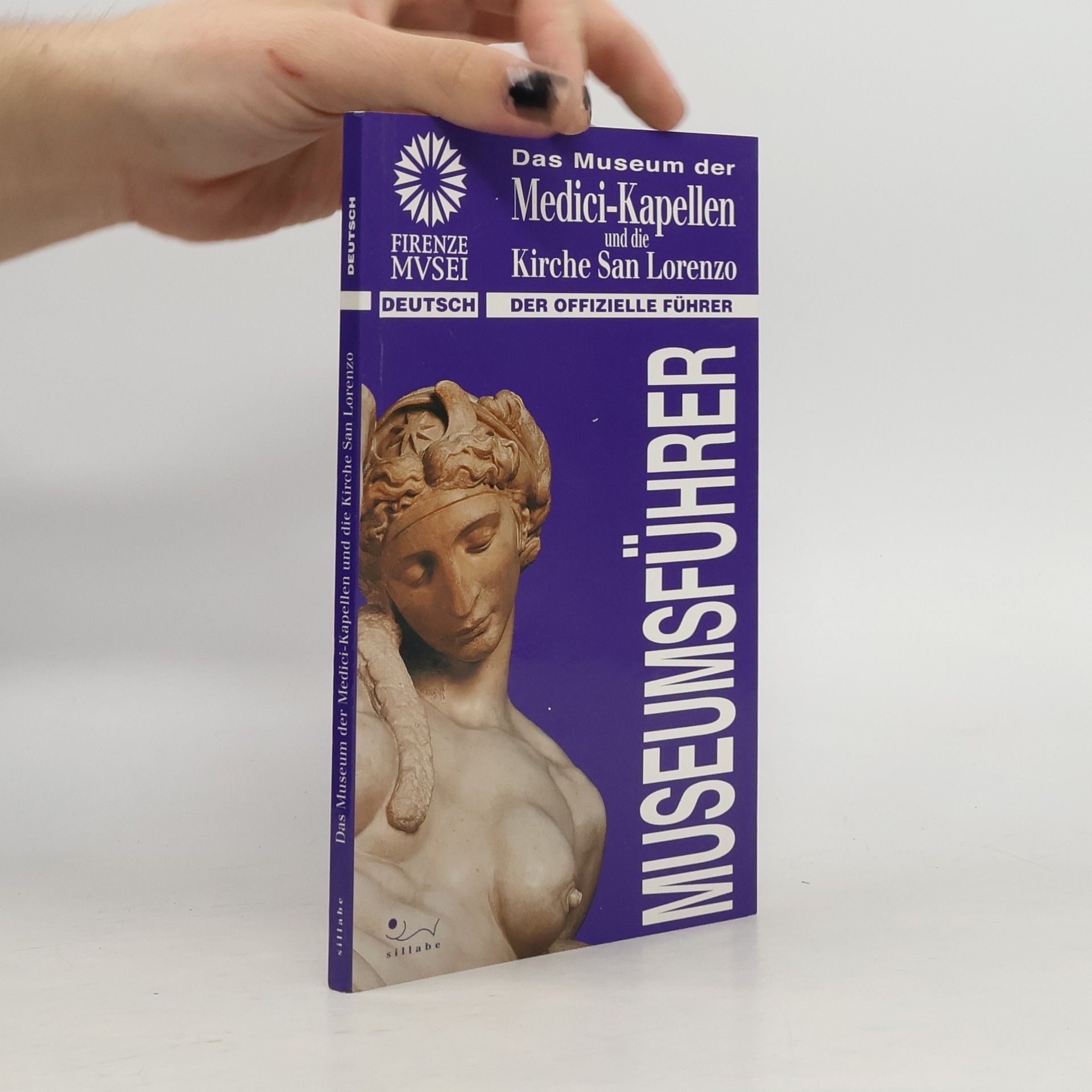



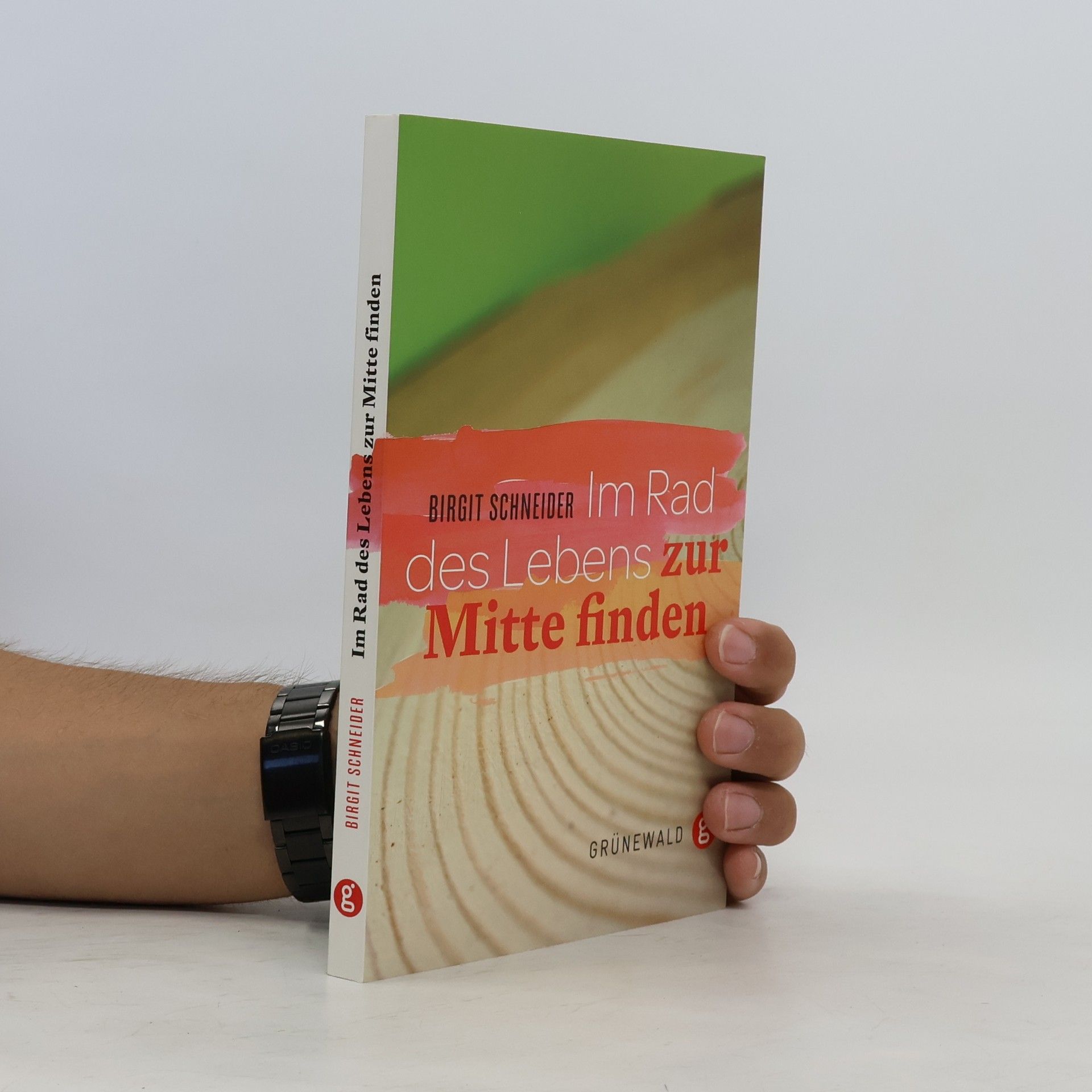

Im Rad des Lebens zur Mitte finden
- 147 Seiten
- 6 Lesestunden
Akribie und Obsession
- 120 Seiten
- 5 Lesestunden
In den 1960er und 1970er Jahren führte die Automatisierung der Datenverarbeitung zur Aufwertung des Verwaltungsapparats: Mess- und Regulierbarkeit wurden zur gesellschaftlichen Utopie. Akribie und Obsession erforscht die Resonanzen des kybernetischen Denkens in künstlerischen und sozialen Praktiken, Architekturen und Technologien. Von der Schreibmaschinenkunst Ruth Wolf-Rehfeldts über die Datenspeicherung des Ministeriums für Staatssicherheit hin zu den kybernetischen Kompositionen von Roland Kayn versammelt der Band Formen der Datenverarbeitung und -visualisierung sowie die kybernetischen Utopien der Science-Fiction-Literatur in der DDR, der geplanten, selbstregulierenden Stadt Etarea und der Akademie der marxistisch-leninistischen Organisationswissenschaft. Der Verein Zentrum für Netzkunst (gegründet 2019 in Berlin) rekonstruiert, erhält und bewahrt Netzkunst und Netzkultur und ist angesiedelt am Haus der Statistik in Berlin. Mitglieder des Vereins sind !Mediengruppe Bitnik, Tereza Havlíková, Paloma Oliveira, Anneliese Ostertag, Tabea Rossol, Robert Sakrowski und Cornelia Sollfrank.
Klausurenkurs im Bürgerlichen Recht II
Ein Fall- und Repetitionsbuch für Fortgeschrittene
- 261 Seiten
- 10 Lesestunden
Der Klausurenkurs bietet eine strukturierte Vorbereitung auf zivilrechtliche Examensklausuren und enthält 16 praxisnahe Fälle, die typische Problemstellungen abdecken. Diese Fälle sind bereits in realen Prüfungen erprobt, und die Lösungen orientieren sich streng am Anspruchssystem. Durch detaillierte taktische Hinweise wird dem Leser verdeutlicht, an welchen Stellen der Klausur entscheidende Entscheidungen getroffen werden müssen. Der Fokus liegt auf zentralen Themen des BGB und des allgemeinen Schuldrechts, die häufig in Examensfragen eine Schlüsselrolle spielen.
Exekutionsordnung - EO
- 1082 Seiten
- 38 Lesestunden
Das Exekutionsrecht wird in diesem Buch umfassend behandelt und bietet eine detaillierte Analyse der aktuellen Rechtslage sowie der praktischen Herausforderungen, die sich aus der Vollstreckung von Urteilen ergeben. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Änderungen und Entwicklungen im Rechtssystem, die die Durchsetzung von Ansprüchen beeinflussen. Zudem werden relevante Fallbeispiele und rechtliche Strategien vorgestellt, um den Lesern ein besseres Verständnis für die komplexen Abläufe im Exekutionsrecht zu vermitteln. Ideal für Juristen und Studierende, die sich mit diesem Fachgebiet auseinandersetzen möchten.
Das Museum der Medici-Kapellen und die Kirche San Lorenzo
- 96 Seiten
- 4 Lesestunden
Der Anfang einer neuen Welt
Wie wir uns den Klimawandel erzählen, ohne zu verstummen
Die Folgen der Erderwärmung rücken uns zu Leibe. Sie sind inzwischen auch in Deutschland zu spüren. Bestätigt werden sie von immer neuen Messrekorden. In der Veränderung des Klimas scheint eine destabilisierte Welt auf, die wir nicht mehr als unsere erkennen. Beim Sprechen über den Klimawandel geraten deshalb viele in eine Abwärtsspirale, an deren Ende ihnen die Worte ausgehen. Dass die Sprache fehlt, erscheint zunächst widersprüchlich, denn seit ein paar Jahren gibt es wenige Themen, über die so viel geredet wird. Doch Worte allein erreichen nicht unsere Vorstellungskraft, wir können das Wissen nicht verarbeiten. Es ist zu angsteinflößend und hoffnungslos. Birgit Schneider versucht Antworten auf die Frage zu finden, wie sich Menschen in den gemäßigten Breiten den Klimawandel vorstellen, welche Imaginationen und Geschichten sie dabei leiten. Sie stellt Perspektivwechsel, Widersprüche und auch ungewöhnliche Sichtweisen heraus, die unsere begrenzte Vorstellungskraft zu weiten vermögen. Denn um die Lücke zwischen Wissen und Handeln zu überwinden, macht es einen großen Unterschied, wie wir uns den Klimawandel erzählen.
Klimabilder
Eine Genealogie globaler Bildpolitiken von Klima und Klimawandel
Unsere Vorstellungen von Klima und Klimawandel stammen aus Bildern – Bildern, mit denen Wissenschaften ihre Erkenntnisse sichtbar machen. Diese Bilder müssen gedeutet und kritisiert werden, um ihre Aussagekraft und Intentionen offenzulegen. Genau dies unternimmt Birgit Schneider in dieser politisch brisanten medienkritischen Untersuchung, die sie ausgehend von Alexander von Humboldts Wetterwissen zum heutigen Begriff des Klimas führt. Sie untersucht, wie die mit wissenschaftlichen Methoden erhobenen Daten um ihrer Operationalisierbarkeit willen vor allem in Kurven-Grafiken visuell aufbereitet werden. Die Kenntnis dieser und anderer Darstellungsmittel ist nicht zuletzt wichtig, um die Argumentationen derjenigen zu entkräften, die Klimawandel vorsätzlich und fälschlich noch immer als »offene Frage« inszenieren.
Privatinsolvenz
- 286 Seiten
- 11 Lesestunden
Das Handbuch bietet einen umfassenden Überblick über das Schuldenregulierungsverfahren, einschließlich der aktuellen Neuerungen durch das RIRUG und die Änderungen der GREx. Es richtet sich an alle, die sich mit der Insolvenz von natürlichen Personen beschäftigen, und vermittelt praxisnahe Informationen und wertvolle Einblicke in die Thematik.
Narrative Kunsttherapie
Identitätsarbeit durch Bild-Geschichten. Ein neuer Weg in der Psychotherapie
Narrative Kunsttherapie stellt eine innovative therapeutische Variante dar, die über Bild-Geschichten Identitätsarbeit und Salutogenese fördert. Im Kontext komplexer spätmoderner Lebensanforderungen ist Kohärenz nicht nur ein Thema bei psychopathologischen Spaltungsphänomenen, sondern bezieht sich auf erforderliche Lebensstrategien der Individuen generell. In Bezug auf aktuelle Diskurse zeigt das Buch die therapeutische Relevanz kreativer und kohärenzfördernder Prozesse in den Ansätzen von Kunst- und Narrativer Therapie auf. Das Modell einer Narrativen Kunsttherapie ermöglicht erweiterte Perspektiven und Spielräume für Therapeuten und Pädagogen sowie Praktiker im Gesundheits- und Sozialwesen.