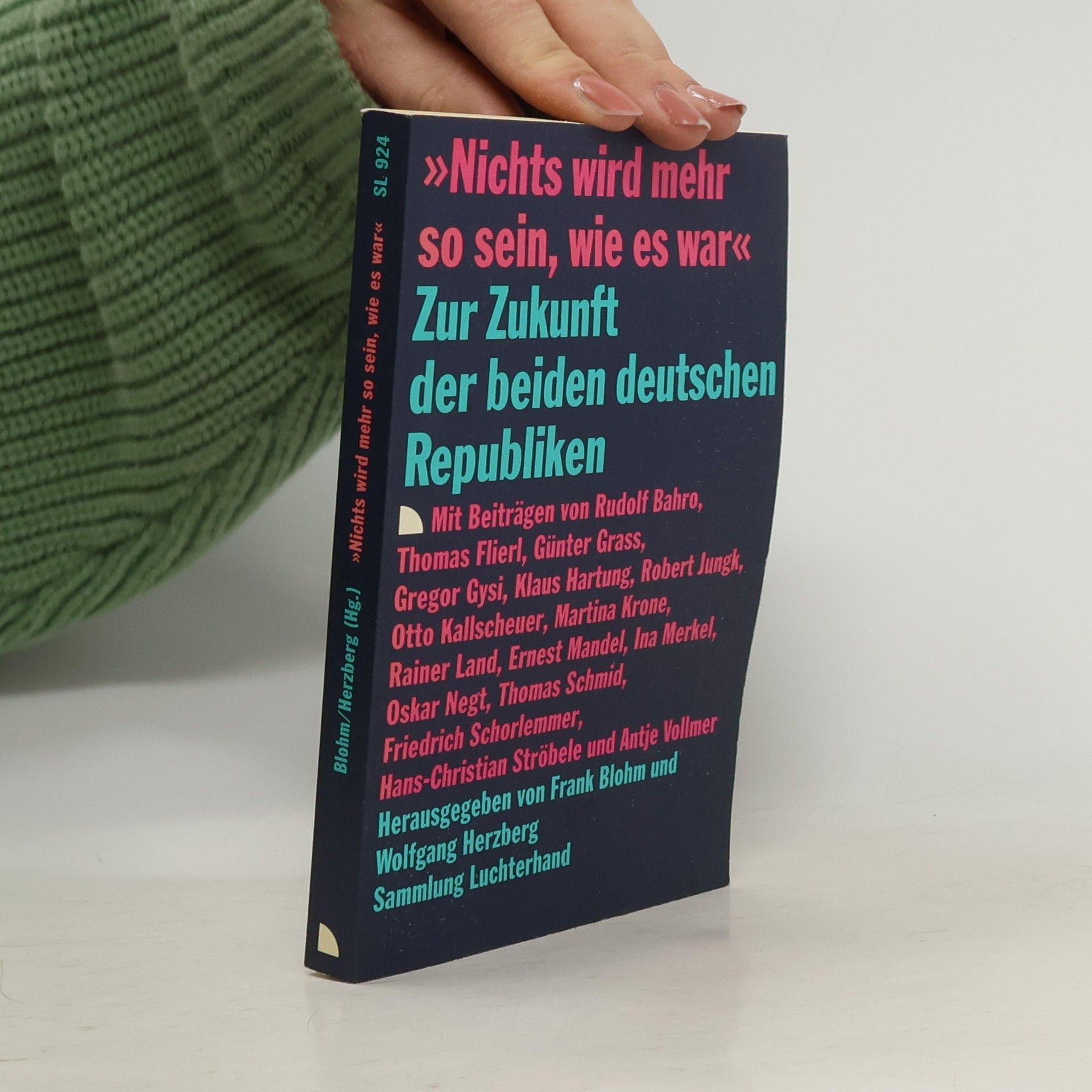Bauhaus - Shanghai - Stalinallee - Ha-Neu
- 264 Seiten
- 10 Lesestunden
Erst mit der Moderne tritt der immanente Widerspruch von Avantgarde und Tradition zutage. Der Lebensweg des Architekten Richard Paulick (1903–1979) folgte einer der Sinuskurven des 20. Jahrhunderts: zwischen dem Bauhaus auf dem einen Pol hin zum Bauen in nationalen Traditionen an der Stalinallee als entgegengesetztem Pol und zurück zur erneuten Hinwendung zur Moderne im industriellen Bauwesen der DDR. Diese Schwingung hatte eine Periodendauer von etwa dreißig Jahren. Das Bauhaus-Jubiläum bot den Anlass, erstmals in Form einer Ausstellung und auf der Grundlage neuerer Forschungen die Arbeitsbiographie Paulicks zusammenhängend nachzuzeichnen. Genauer als bisher können nun seine Lebensstationen am und im Umfeld des Bauhaus, seine Emigration nach China 1933 bis 1949 und seine Zeit in der DDR dargestellt werden. Der von Thomas Flierl herausgegebene Band dokumentiert die Ausstellung im Rahmen der Triennale der Moderne 2019 und umfasst ergänzende Essays von Andreas Butter, Gabi Dolff-Bonekämper, Simone Hain, Ulrich Hartung, Eduard Kögel, Hou Li, Natascha Paulick, Tanja Scheffler, Oliver Sukrow und Wolfgang Thöner.