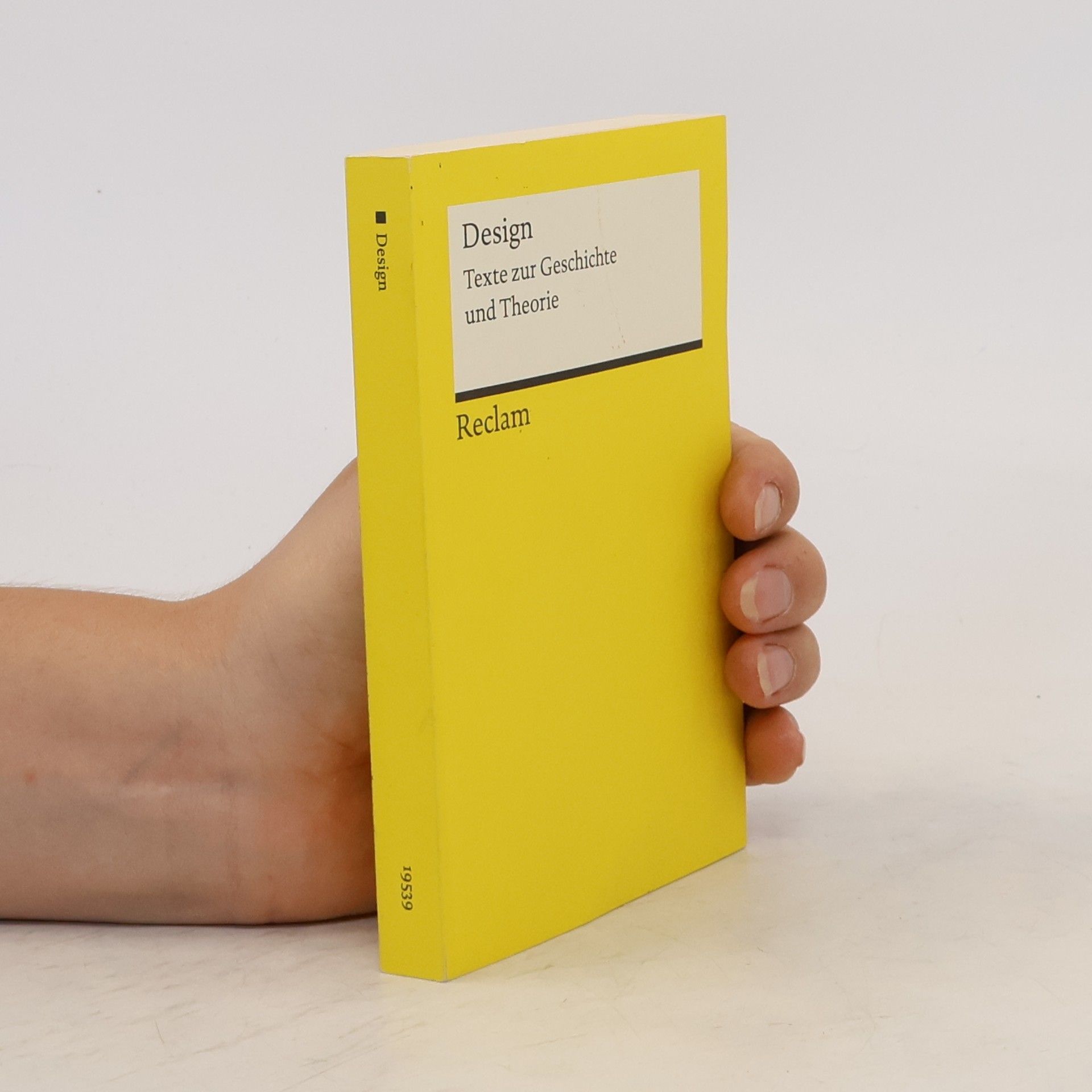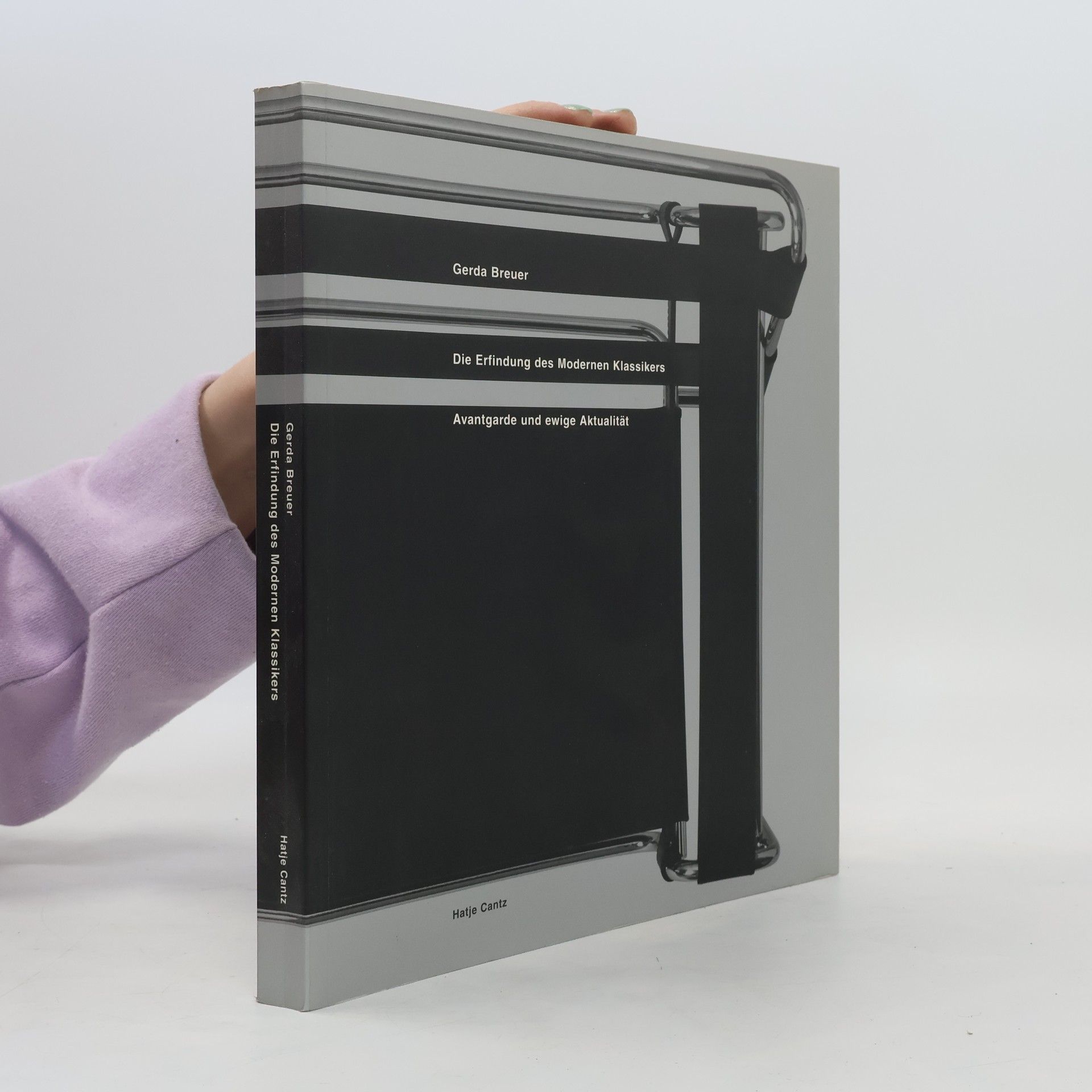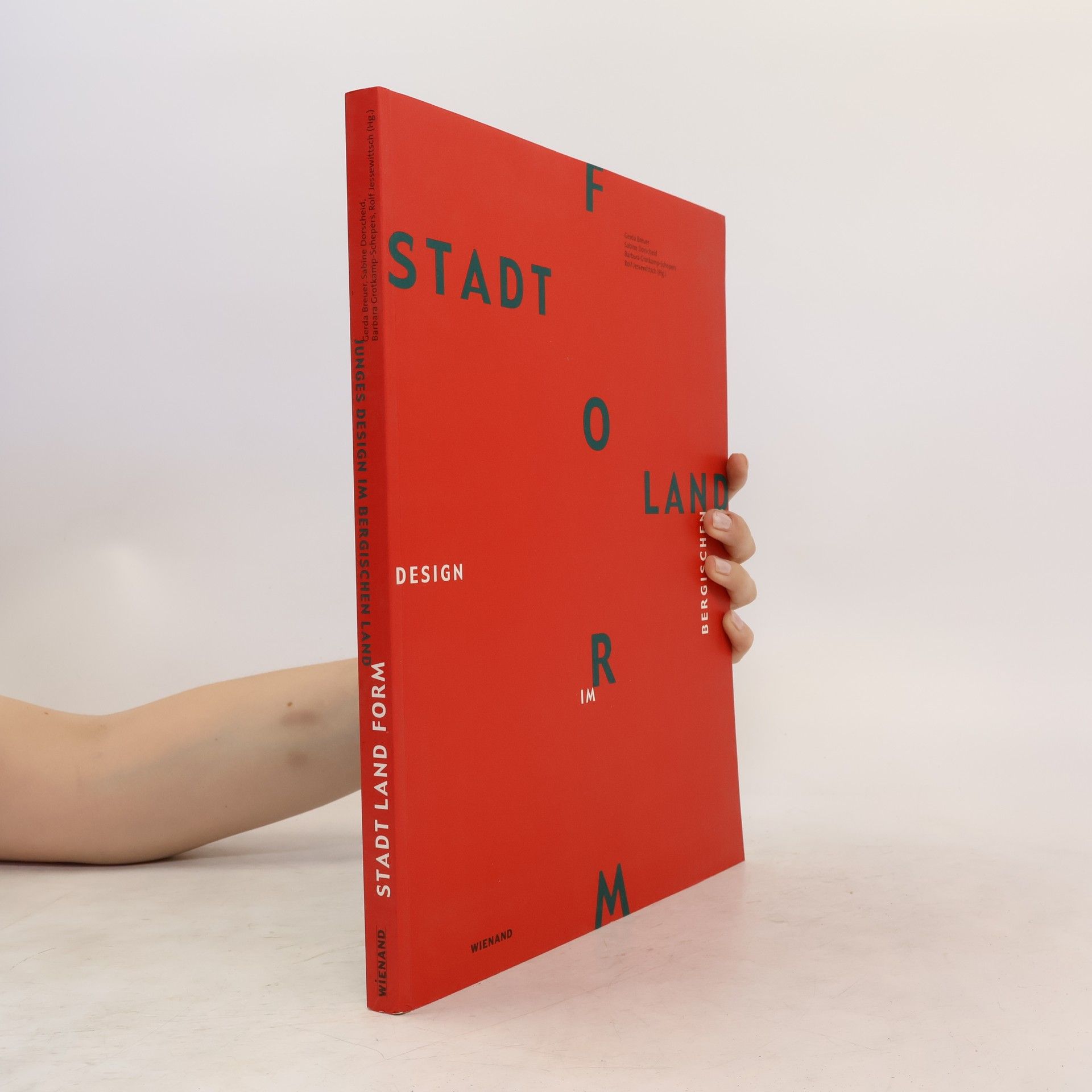HerStories in Graphic Design
Dialoge, Kontinuitäten, Selbstermächtigungen. Grafikdesignerinnen 1880 bis heute / Dialogue, continuity, self-empowerment. Women graphic designers from 1880 until today
- 304 Seiten
- 11 Lesestunden
Zweisprachige Ausgabe (deutsch/englisch) / Bilingual edition (English/German) Die Geschichte des Grafikdesigns ist weitgehend ohne Frauen geschrieben worden. Blickt man jedoch unter die Oberfläche dieser Erzählung, wird der Einfluss sichtbar, den Grafikdesignerinnen auf das Geschehen hatten: Sie bildeten eigene Traditionen, stellten dialogische Bezüge her, wurden Vorbilder, knüpften Netzwerke, erprobten sich in Selbstermächtigung. Gerda Breuer beleuchtet diesen Kampf um Professionalisierung und zeigt, auf welche kollektiven Formate Designerinnen zurückgriffen, um sichtbar zu werden und sich für die Belange von Frauen einzusetzen. Bekannte Grafikdesignerinnen wie Ljubow Popowa, Änne Koken, Ethel Reed oder Sarah Wyman Whitman spielten hierbei ebenso eine Rolle wie völlig unbekannte Kollektive. Breuer zeigt, dass deren bedeutende Beiträge in der Rezeptionsgeschichte verschwunden, abgewertet, ignoriert oder in den Hintergrund gedrängt wurden. Aufgrund der aktuellen Infragestellung des traditionellen Kanons ist die Integration solcher Beiträge in die Designgeschichte längst überfällig. Design von Katja Lis, DBF Designbüro Frankfurt