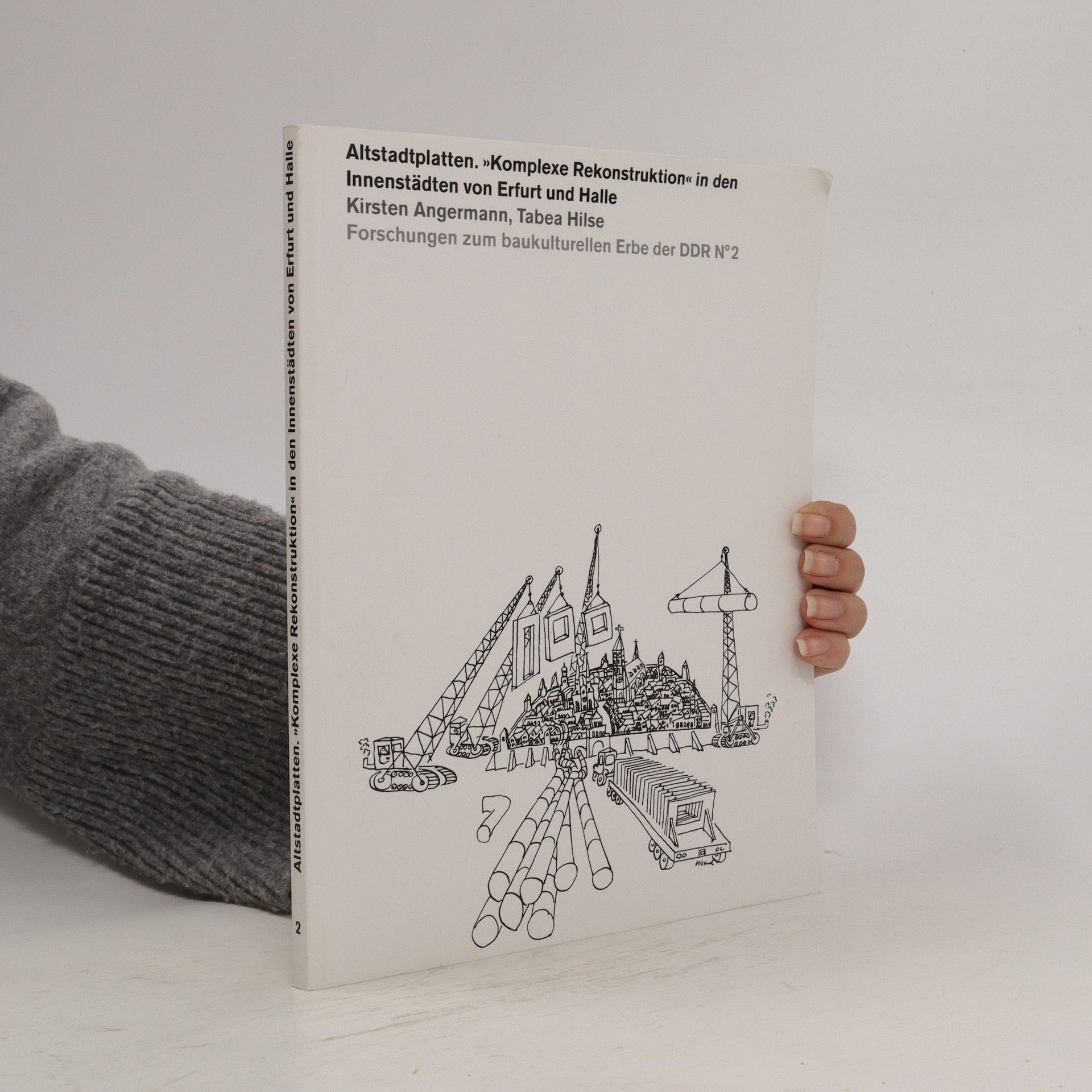Spolien
Phänomene der Wiederverwendung in der Architektur
Spolien sind gezielt und daher in der Regel sichtbar wiederverwendete Bauteile. Im weiten Feld der Wiederverwendung in der Architektur besetzen sie jenen Sektor, der mit besonderen Gestaltungs- und Bedeutungsabsichten verbunden ist. Durch ihre meist sichtbare Differenz zum übrigen Bau regen sie dazu an, diesen mit weiteren Bedeutungen anzureichern. Mit der Rückkehr von Ornament und Geschichte in die zeitgenössische Architektur hat auch die Spolienverwendung wieder zugenommen. Sind Spolien bisher entweder für die spätantike und mittelalterliche Architektur oder - sehr viel seltener - für die der Moderne untersucht worden, werden hier erstmals Phänomene der Spolienverwendung über die Epochen hinweg miteinander in Beziehung gesetzt. Neben kulturwissenschaftlichen Aspekten wird in diesem Band die Rolle von Spolien im Entwurfsprozess beleuchtet.