Instabile Konstruktionen
Interdisziplinäre Forschungen zu »Identität und Erbe«

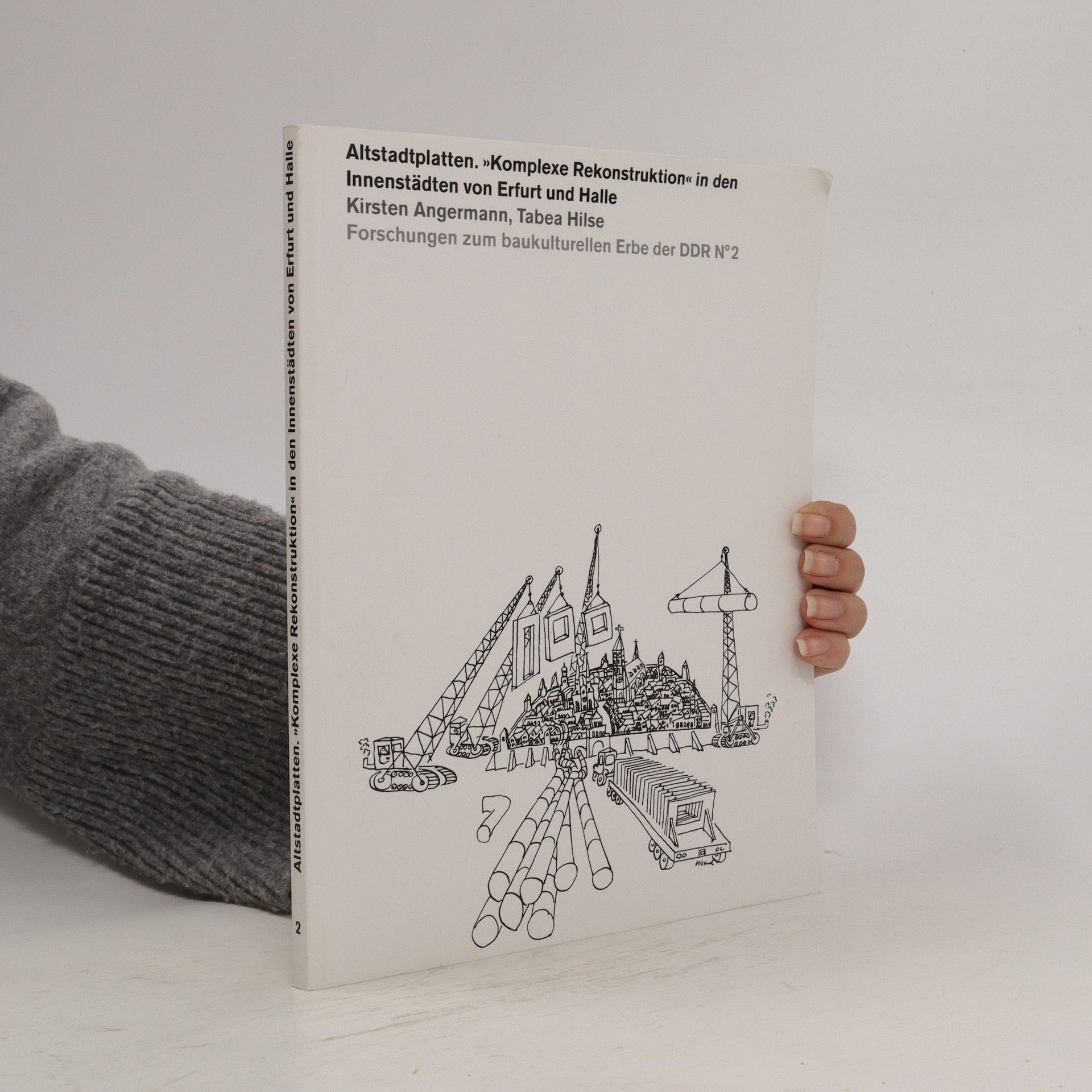


Interdisziplinäre Forschungen zu »Identität und Erbe«
Phänomene der Wiederverwendung in der Architektur
Spolien sind gezielt und daher in der Regel sichtbar wiederverwendete Bauteile. Im weiten Feld der Wiederverwendung in der Architektur besetzen sie jenen Sektor, der mit besonderen Gestaltungs- und Bedeutungsabsichten verbunden ist. Durch ihre meist sichtbare Differenz zum übrigen Bau regen sie dazu an, diesen mit weiteren Bedeutungen anzureichern. Mit der Rückkehr von Ornament und Geschichte in die zeitgenössische Architektur hat auch die Spolienverwendung wieder zugenommen. Sind Spolien bisher entweder für die spätantike und mittelalterliche Architektur oder - sehr viel seltener - für die der Moderne untersucht worden, werden hier erstmals Phänomene der Spolienverwendung über die Epochen hinweg miteinander in Beziehung gesetzt. Neben kulturwissenschaftlichen Aspekten wird in diesem Band die Rolle von Spolien im Entwurfsprozess beleuchtet.
Als sich gegen Ende der 1970er-Jahre Planer und Architekten in der DDR den Stadtzentren zuwandten, waren im Rahmen der 'komplexen Rekonstruktion' neben der Sanierung und Modernisierung des Bestandes auch Neubauten zu planen. Dafür stand jedoch nur die für den Siedlungsbau entwickelte Plattenbauweise zur Verfügung, die nun an den innerstädtischen Kontext angepasst werden musste. Mit diesen modifizierten 'Altstadtplatten' beschäftigt sich der vorliegende Band. Im ersten Teil wird die Entwicklung eines Funktionsmusterbaus für die Stadterneuerung in der Nördlichen Altstadt in Erfurt betrachtet. Der zweite Teil widmet ich einem innerstädtischen Baugebiet in Halle an der Saale. An diesem Beispiel lässt sich auch die Frage nach einer Postmoderne in der DDR diskutieren. Neben der baugeschichtlichen Aufarbeitung verweisen die Arbeiten darüber hinaus auf den heutigen Umgang mit den Ensembles dieser Zeit und betrachten mögliche Denkmalwerte der Gebäude.