Robert Traba Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)
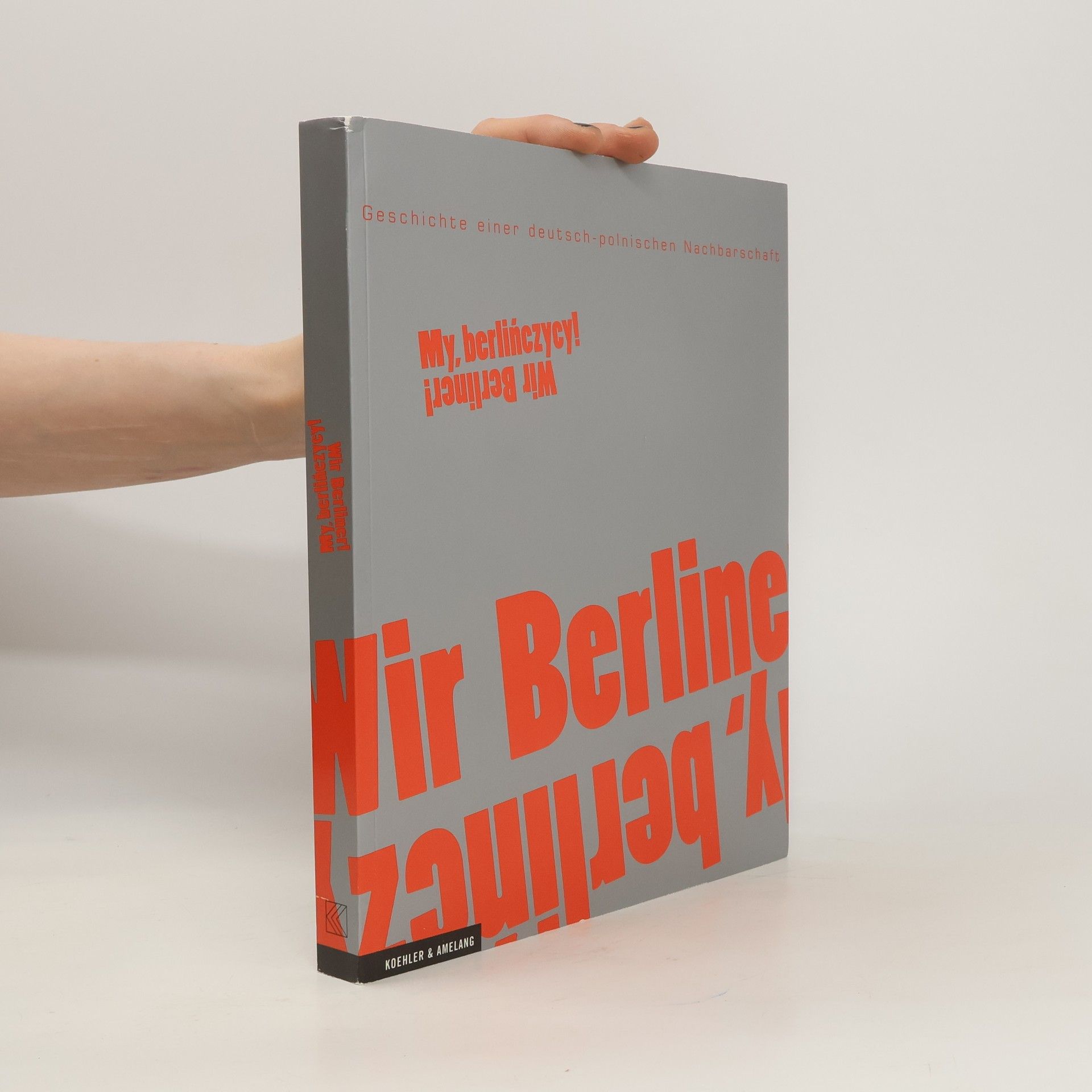
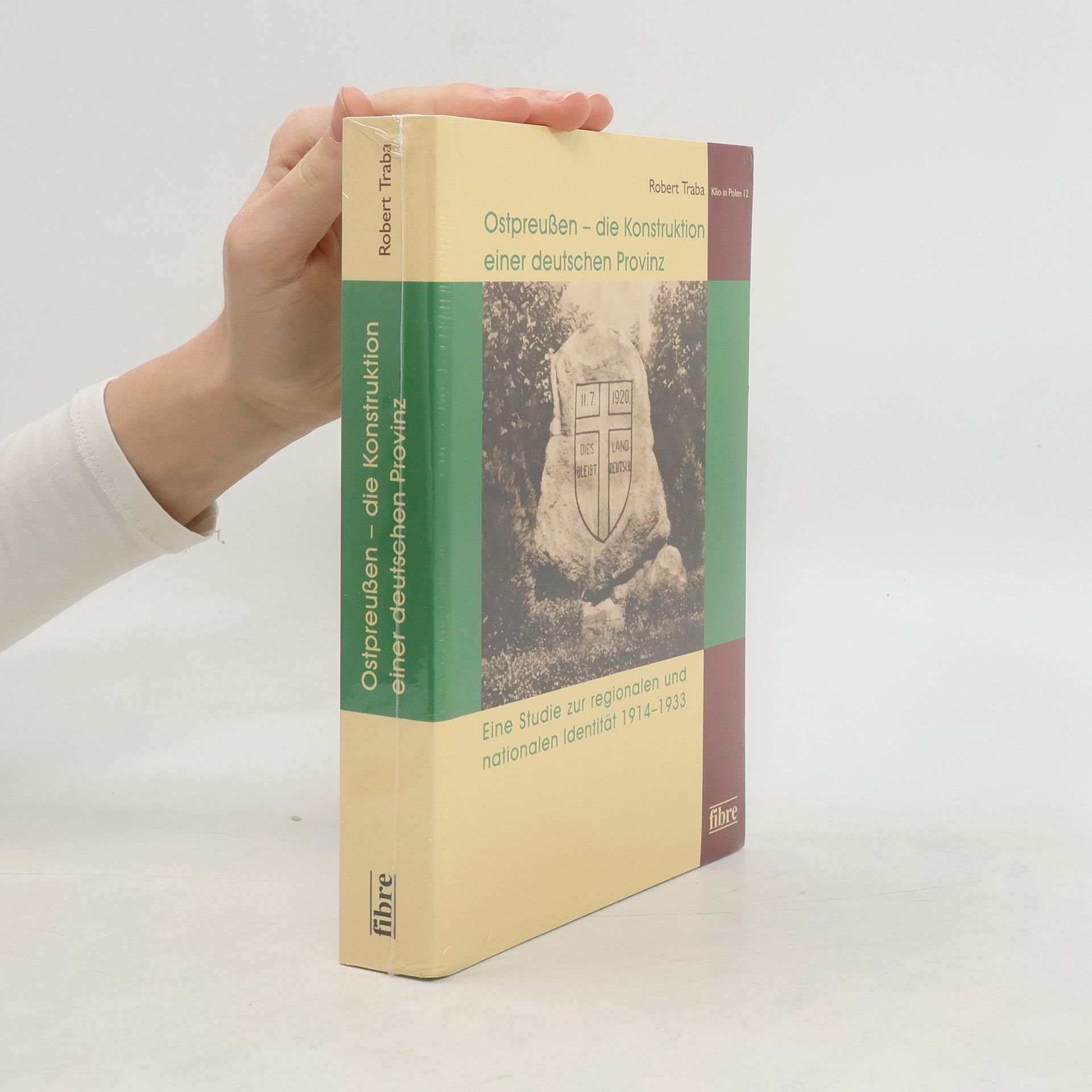
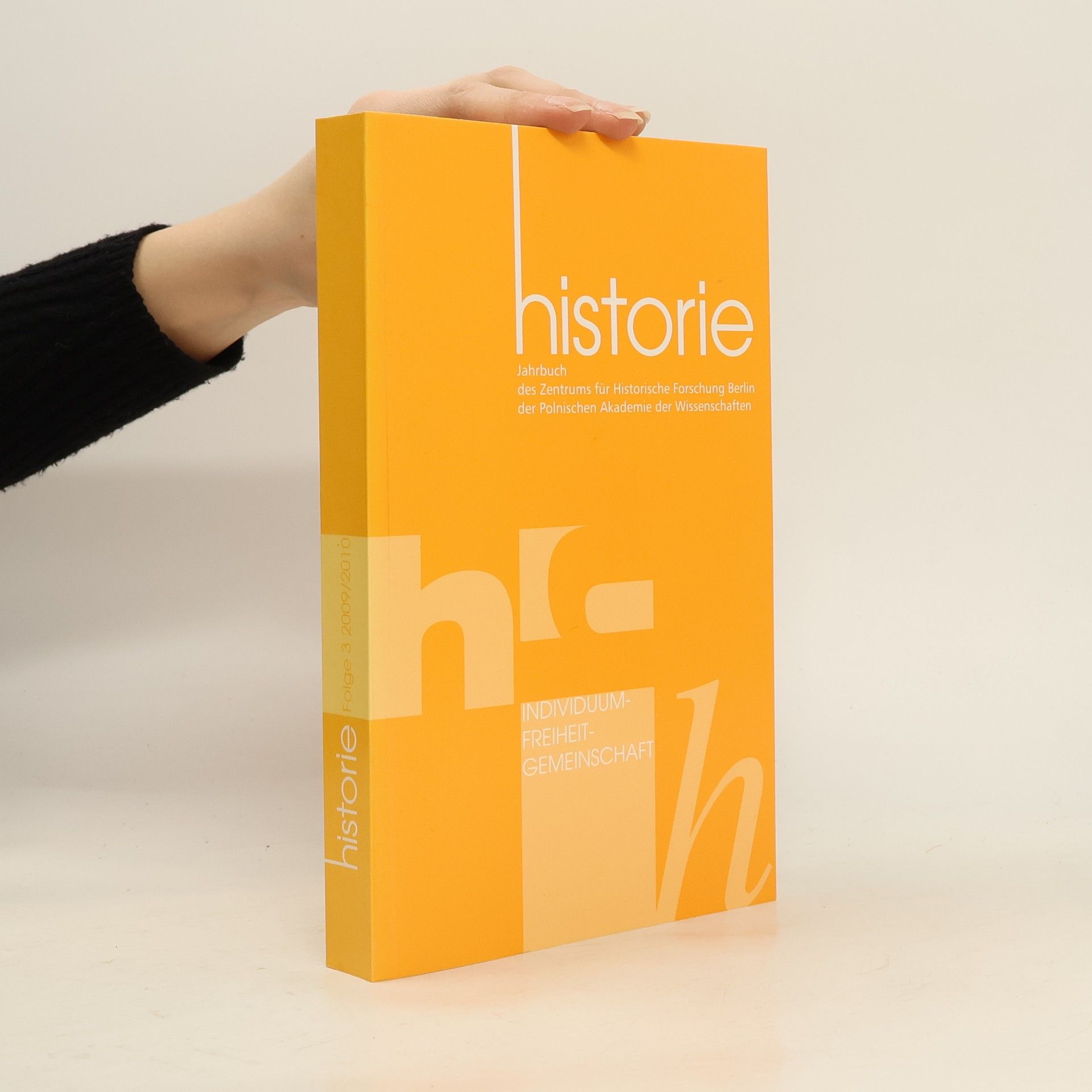
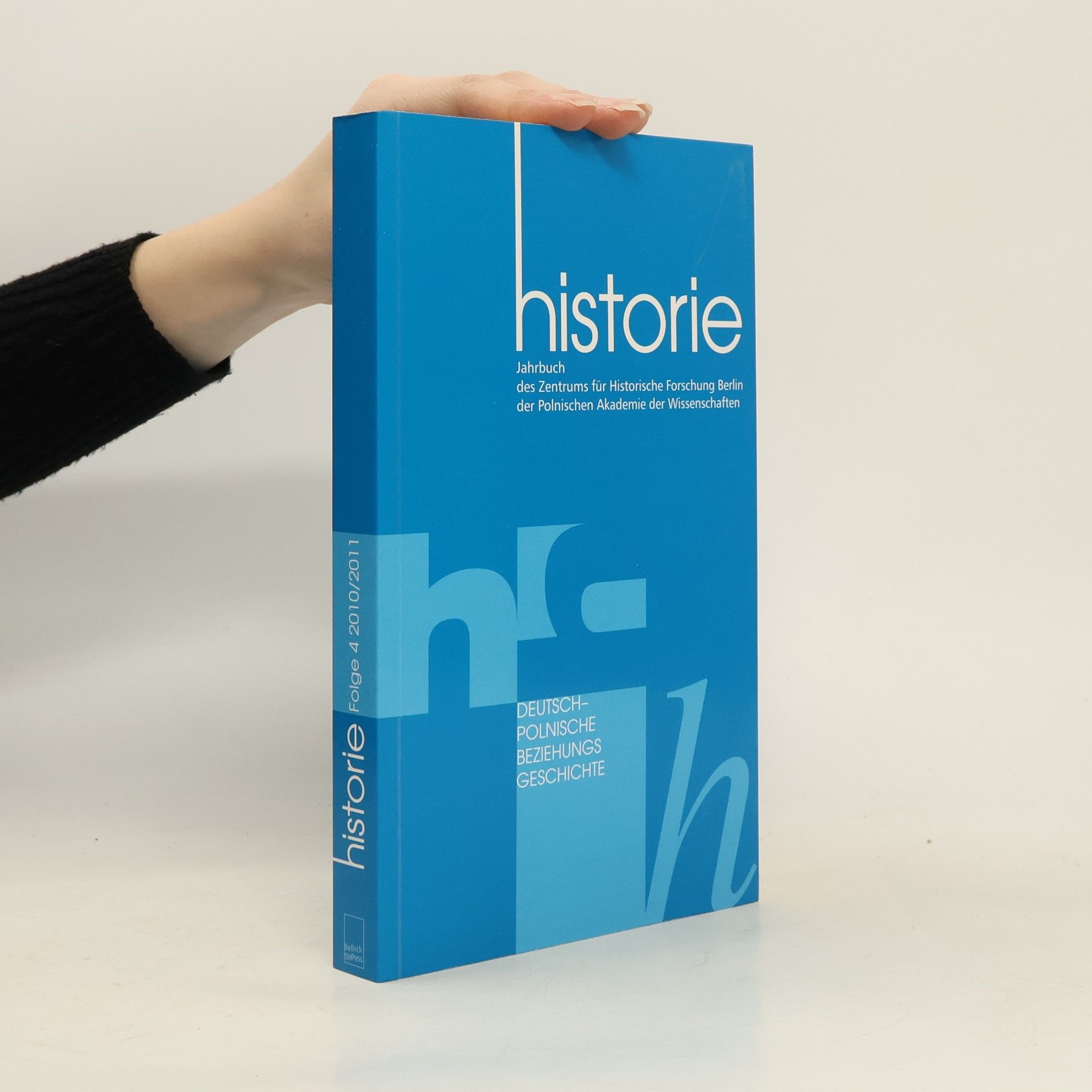
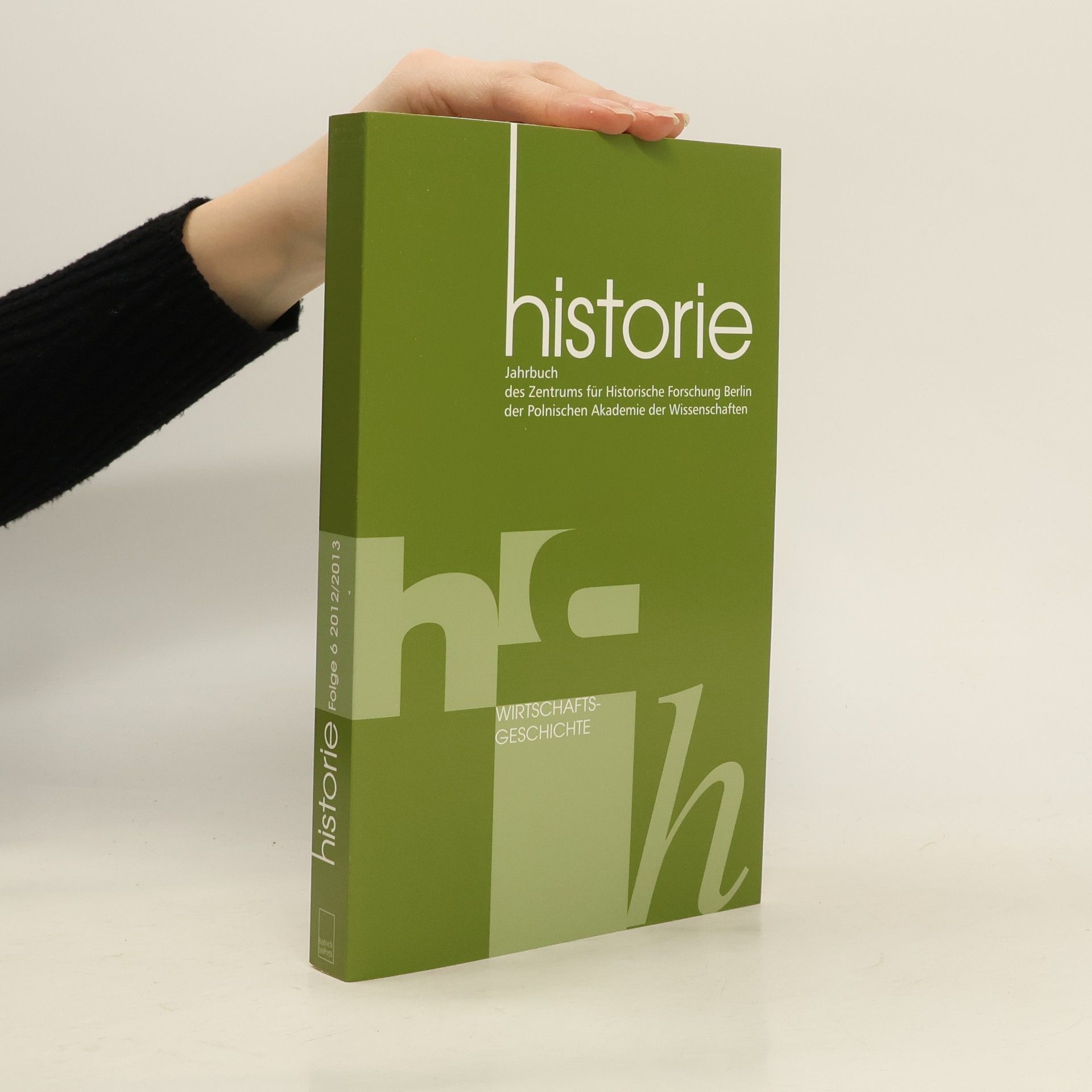
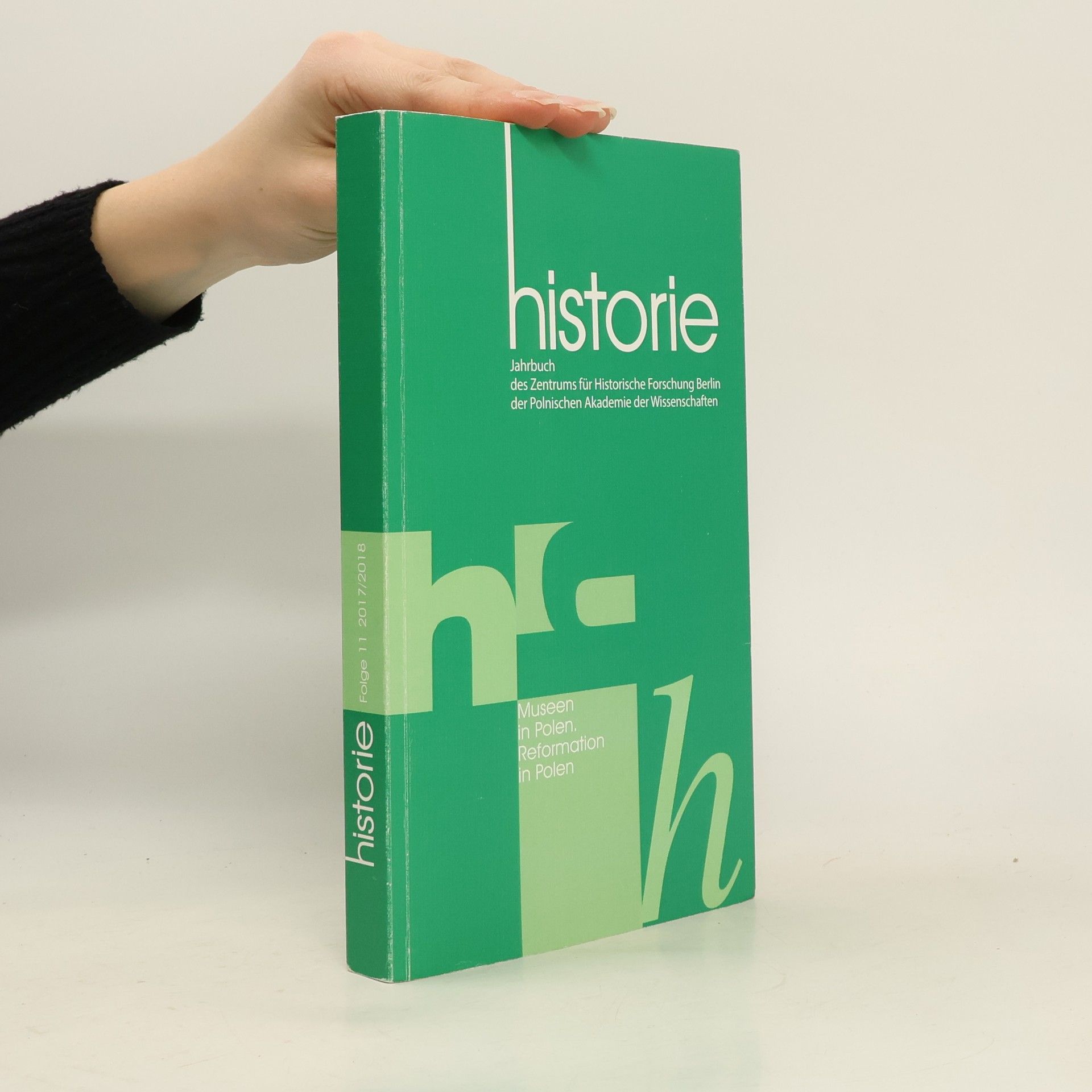
Die Wirtschafts- und Sozialgeschichte entwickelt sich häufig fernab der wichtigsten historiografischen Strömungen. So wie viele andere Interessengebiete der Geschichte sind die polnischen und deutschen Forschungen zur Wirtschaftsgeschichte keinesfalls ein Beispiel für die beiderseitige Kenntnisnahme und Zusammenarbeit von Wissenschaftlern, sondern allenfalls für parallele Erfahrungen. Wie präsentiert sich heute die polnische wirtschaftsgeschichtliche Forschung? Eine Antwort auf diese Frage bietet – wenn auch nur ausschnittsweise – die vorliegende sechste Folge von Historie. Neben der Wirtschaftsgeschichte werden auch Themen der Erinnerungsforschung und der Besatzungsgeschichte behandelt. Gleich drei Generationen polnischer und deutscher Historiker haben zu dieser Folge beigetragen. Mit Beiträgen von: Markus Denzel, Gabi Dolff-Bonekämper, Patrick Giebel, Lucas Elsner, Clara Frysztacka, Michał Galas, Jeannine Harder, Jacek Kochanowicz, Kornelia Kończal, Michał Kopczyński, Marek Kornat, Wolf Lepenies, Cecylia Leszczyńska, Artur Lipiński, Hubert Orłowski, Anna Sosnowska, Maciej Salamon, Henryk Samsonowicz, Katrin Steffen, Niklas Steinert, Robert Traba
Das Leitmotiv der vierten Folge des Jahrbuchs Historie ist die deutsch-polnische Bezie-hungsgeschichte. Wir möchten sie aus zwei Perspektiven vorstellen: zum einen in Form einer Umfrage zu Stand und Perspektiven der Erforschung der deutsch-polnischen Bezie-hungsgeschichte im letzten Jahrzehnt, zum anderen durch die Vorstellung des wissen-schaftlichen Ertrags von Professor Klaus Zernack, dem wir die theoretische Ausarbeitung des Konzeptes einer Beziehungsgeschichte verdanken.
In der Verflechtung von Geschichte und Erinnerung erlangte die Frage nach der Rolle von „Individuum” und „Gemeinschaft”, nicht nur als Akteure der Ereignisse, sondern auch als die Vorstellung von Vergangenheit Gestaltende, zunehmende Bedeutung. Dies ist das Leitmotiv, das die historische Reflexion „seit jeher” begleitet und – abhängig von den ge-gebenen Umständen – einen immer neuen Kontext annimmt. Die in „Historie” versammel-ten Artikel (Marcin Kula, Dariusz Kołodziejczyk, Wojciech Kriegseisen, Tomasz Kizwalter, Włodzimierz Mędrzecki, Kamila Uzarczyk) sind Ausschnitt einer breiteren wissenschaftli-chen Debatte, die zu einer der zentralen Fragen des Polnischen Historikertages wurde.
Ostpreußen - die Konstruktion einer deutschen Provinz
Eine Studie zur regionalen und nationalen Identität 1914–1933
Der Erste Weltkrieg stellte für Ostpreußen einen Wendepunkt seiner Geschichte dar – die russische Invasion und Besatzung zu Beginn des Krieges, die Plebiszite von 1920 und schließlich die räumliche Trennung vom Deutschen Reich nach der Wiedererrichtung Polens. Vor diesem Hintergrund beschreibt und analysiert die Studie den Prozess der Herausbildung einer regionalen und nationalen Identität dieser preußischen Provinz in den Jahren zwischen 1914 und 1933, in denen Ostpreußen zum „Bollwerk des deutschen Ostens“ stilisiert wurde. Auf einer breiten Quellengrundlage geht der Autor den Ausprägungen einer kollektiven Identität in politischen und gesellschaftlichen Organisationen, in Presse und Literatur sowie in der Symbolik politischer Feiern, Denkmäler und von Gedenkveranstaltungen nach. Diese Konstruktion eines „Ostpreußenstums“ wird in ihren Auswirkungen auf die ostpreußische Gesellschaft und die politische Kultur Deutschlands am Vorabend des „Dritten Reiches“ untersucht wie auch im Hinblick auf die nationalen Minderheiten und die besondere Lage der Provinz im deutsch-polnischen Grenzgebiet.
Wir Berliner!
- 335 Seiten
- 12 Lesestunden