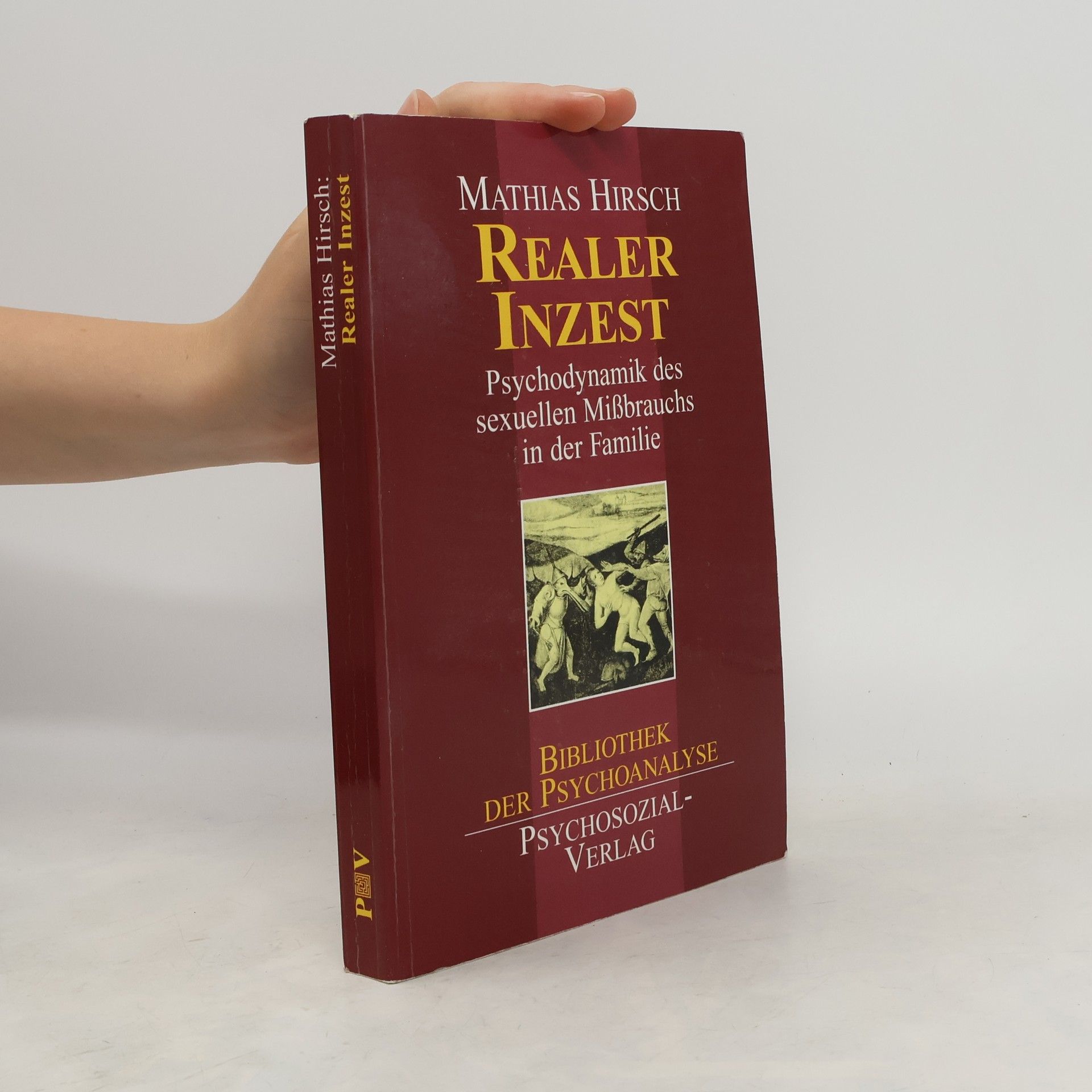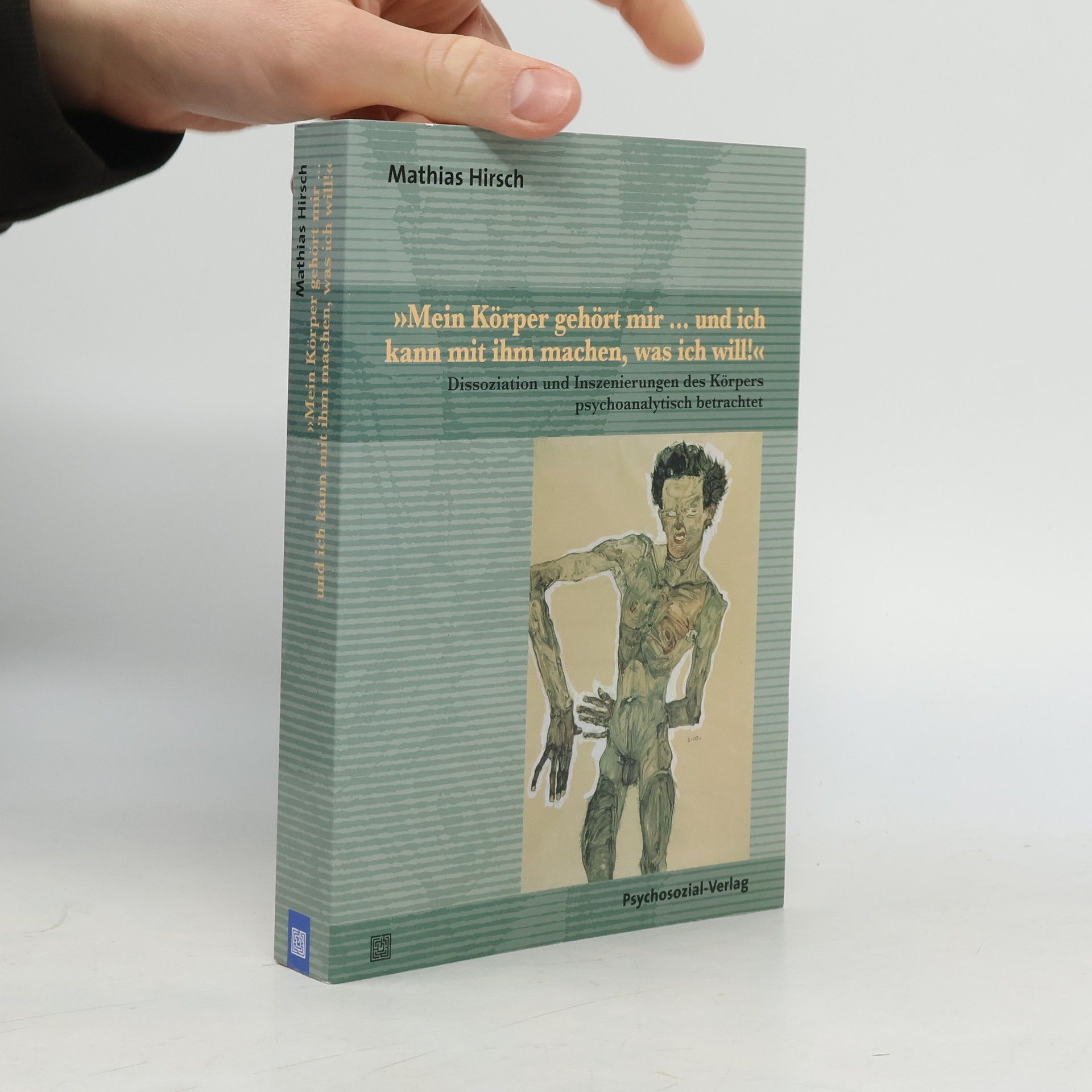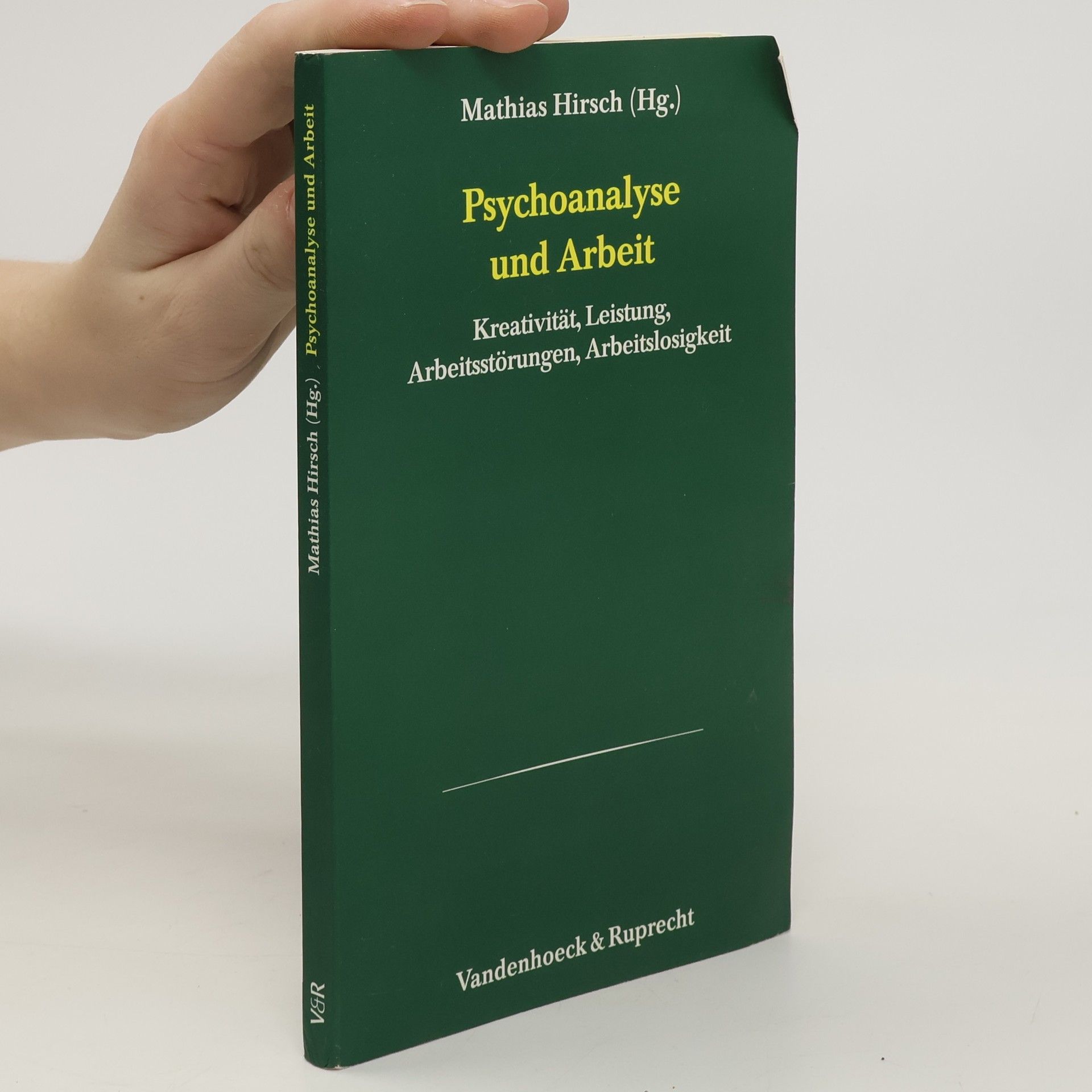Kreativität und Schuld als Wurzeln der Kultur
Mythologie, Literatur, Musik und Film im Spiegel der Psychoanalyse
Aus der Perspektive der Psychoanalyse liegt die Funktion menschlicher Kultur zum einen in der Kontrolle der antisozialen Tendenzen des Menschen. Auf der anderen Seite sieht sie die Kultur in einem engen Verhältnis zum Spiel und zur Kreativität, mit denen der Mensch versucht, Ängste und Ohnmachtsgefühle zu beherrschen. Mathias Hirsch spürt vor diesem Hintergrund dem Verhältnis von Kultur und Psychoanalyse nach: Mit Blick auf Mythologie und Literatur beleuchtet er etwa die Auseinandersetzung mit der Endlichkeit bei Thomas Mann, das Ringen um Schuld und Schuldgefühle in Fjodor Dostojewskijs Romanen oder Formen des Vampirismus. Ein weiterer Fokus liegt auf filmtheoretischen Überlegungen, die die Fragen aufwerfen, welche Wirkung und Funktion der Musik in Filmen zukommt, wie pathologische Trauer inszeniert wird bzw. welche Dimensionen der Deutung im Motiv des Hauses zum Tragen kommen.