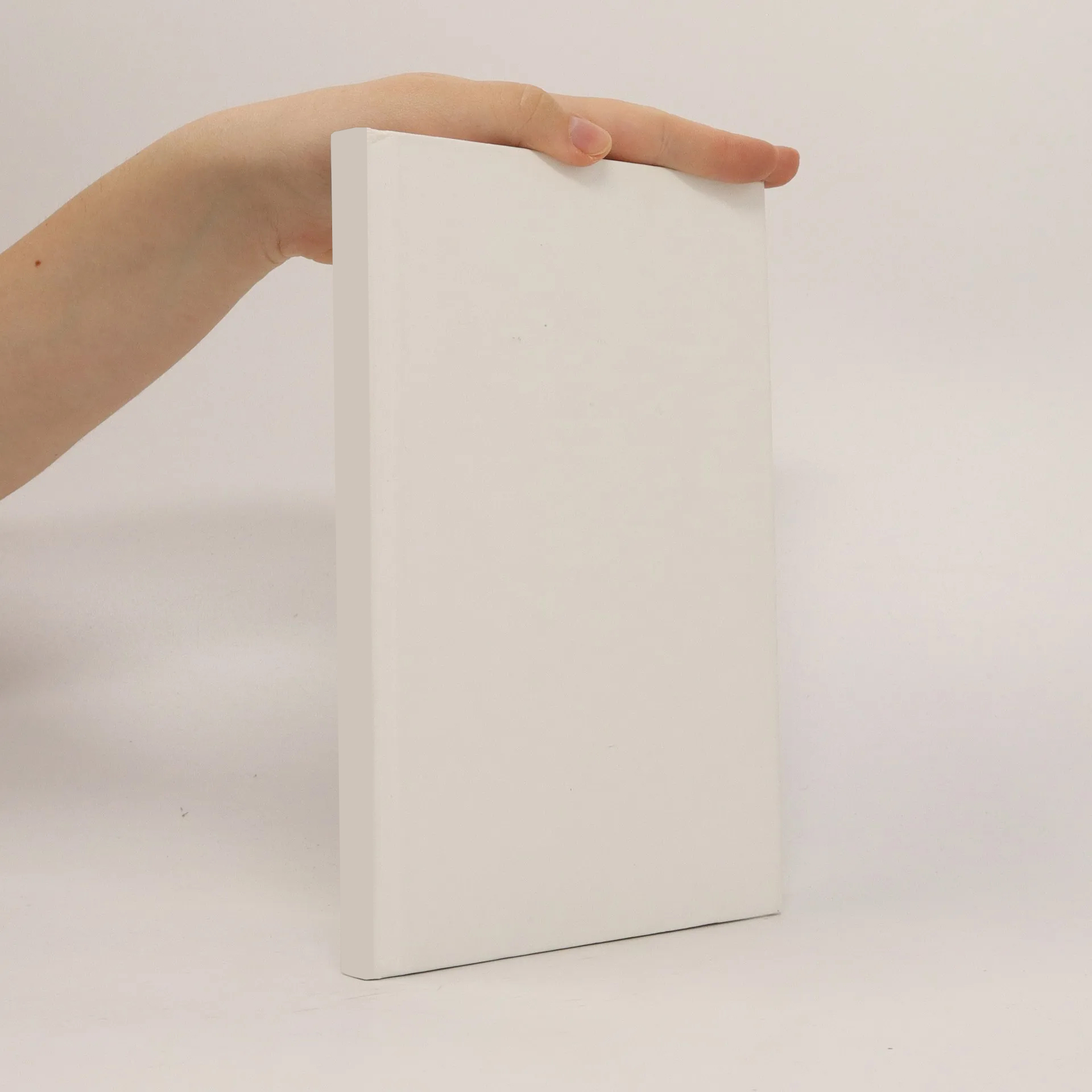
Mehr zum Buch
Medea wird als die Verkörperung der sich „feministisch empörenden Frau“ betrachtet. Ihr Mythos, der die Ermordung ihrer eigenen Kinder im Zorn umfasst, ist ein Paradigma für den Diskurs der Geschlechterbeziehungen. Im 17. und 18. Jahrhundert, als sich der Weiblichkeitsdiskurs entscheidend entwickelte, spiegeln die Veränderungen eines so extremen Weiblichkeitsbildes die Zeit wider. Die Studie zeigt, dass Medeas 'starke', aktive Seite auch in Zeiten auftritt, in denen der herrschende Diskurs die 'schwache', passive Frau forderte. Eine zentrale Frage der Untersuchung ist, mit welchen - auch musikalischen - Mitteln Medeas Zorn präsentiert wird und ob dies geschlechterspezifisch geschieht. Die musikalische Analyse erfolgt unter Berücksichtigung der barocken Affektenlehre. Das frühneuzeitliche Medea-Bild steht in der Tradition der femme forte, die im 17. Jahrhundert eine bedeutende Rolle spielt. Die Neu-Interpretation des Mythos dieser antiken 'starken Frau' stärkt die Tradition der femme forte bis ins späte 18. Jahrhundert. Hier zeigt sich ein positives Weiblichkeitsbild innerhalb der als frauenfeindlich geltenden musiktheatralischen Kunstform. Die Untersuchung behandelt ein Problem der musikologischen Frauen- und Geschlechterforschung und ist interdisziplinär angelegt. Medea-Opern von J.-B. Lully, M.-A. Charpentier, G. F. Händel und anderen werden analysiert. Die Autorin promovierte an der Universität Bremen.
Buchkauf
Medeas Zorn, Corinna Herr
- Sprache
- Erscheinungsdatum
- 2000
- product-detail.submit-box.info.binding
- (Paperback)
Lieferung
- Gratis Versand in ganz Österreich
Zahlungsmethoden
Keiner hat bisher bewertet.