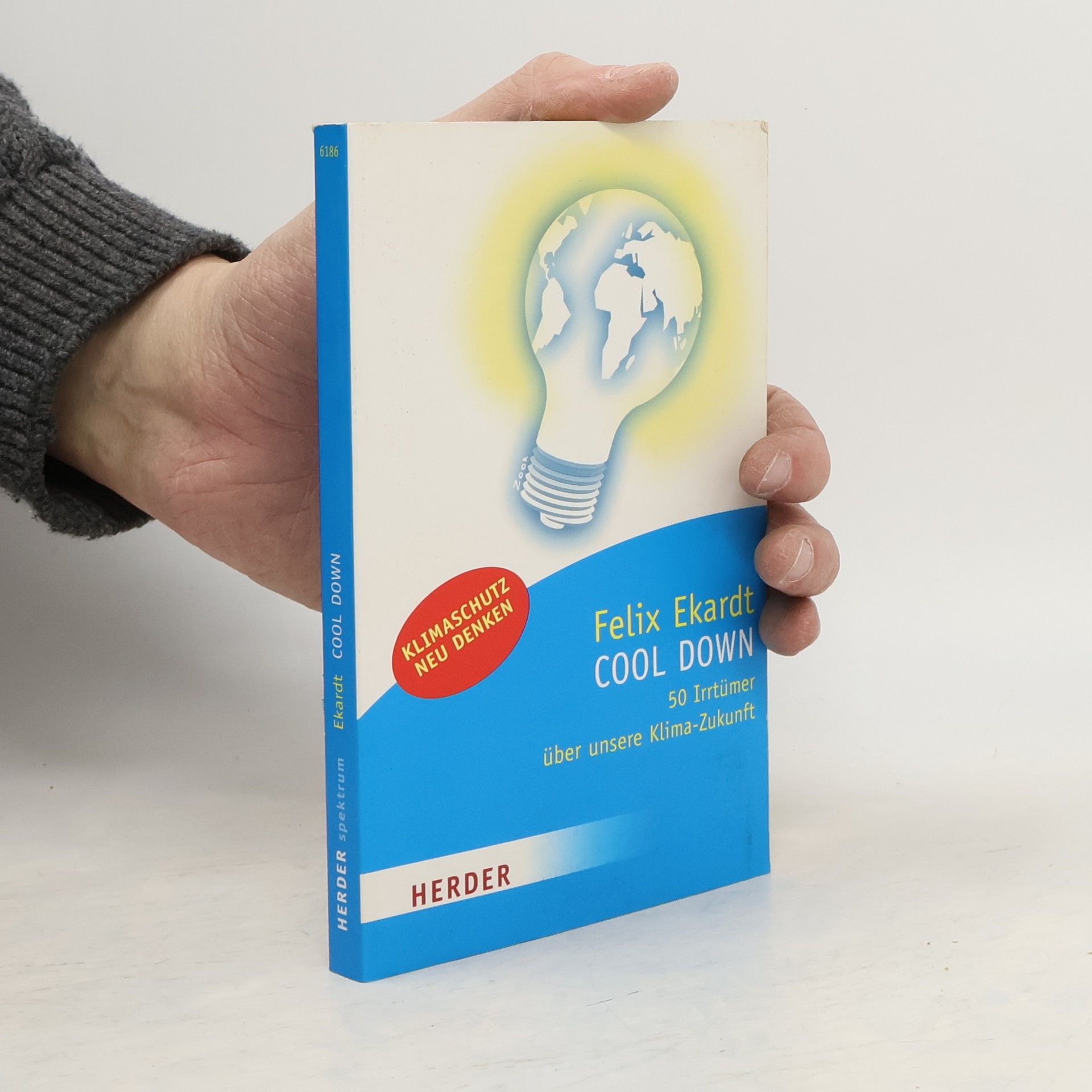Focusing on a transdisciplinary approach, the book explores sustainability and post-fossil societies through the lens of various social sciences. It addresses pressing political concerns related to autocracies and the challenges of transformation towards sustainability. Key questions include the EU's role as an environmental leader, the limits of technical solutions, and the impact of capitalism on sustainable practices. The text critiques existing frameworks like the Paris Agreement and suggests a need for radical reforms in emissions trading and integrated policies across climate, biodiversity, and agriculture.
Felix Ekardt Reihenfolge der Bücher (Chronologisch)



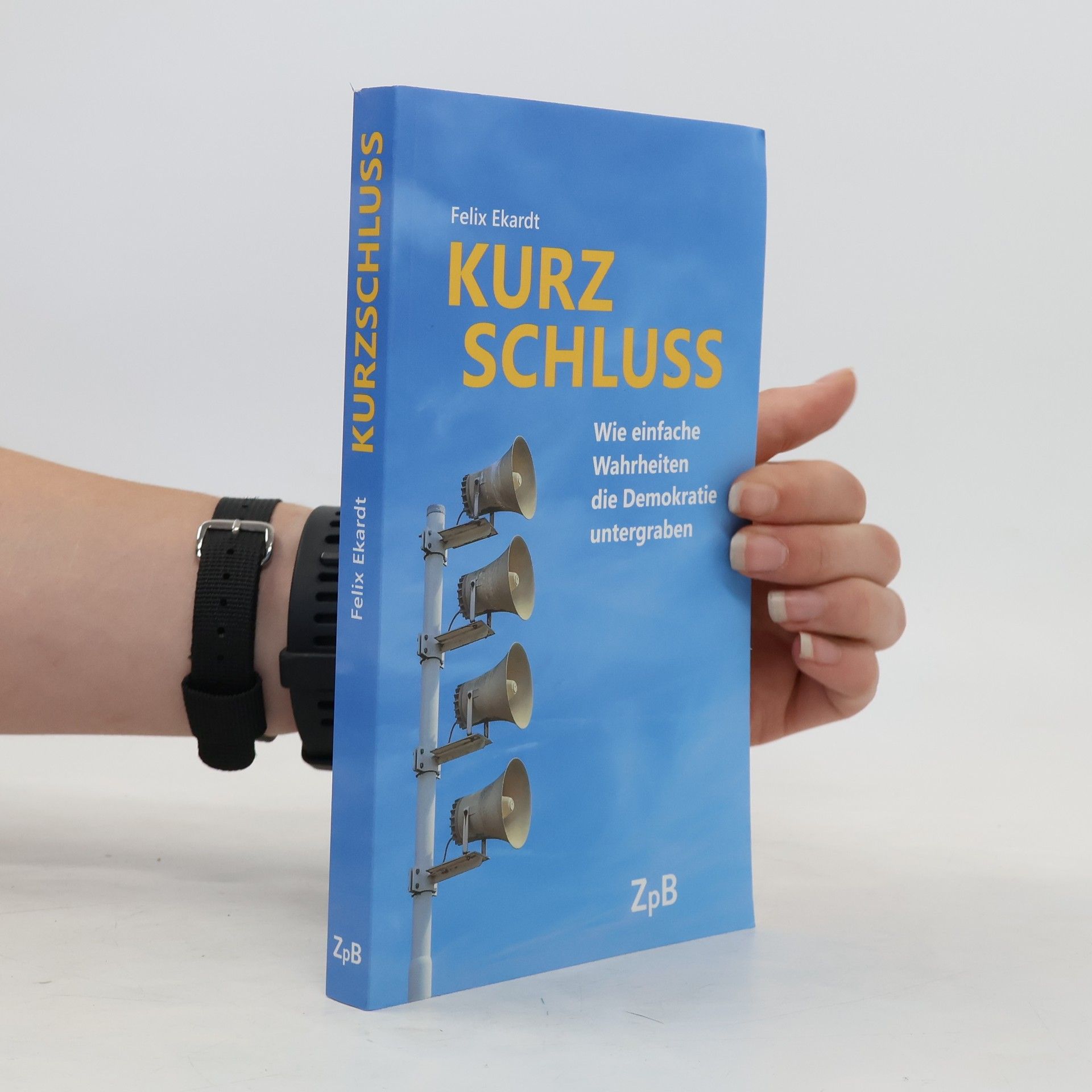
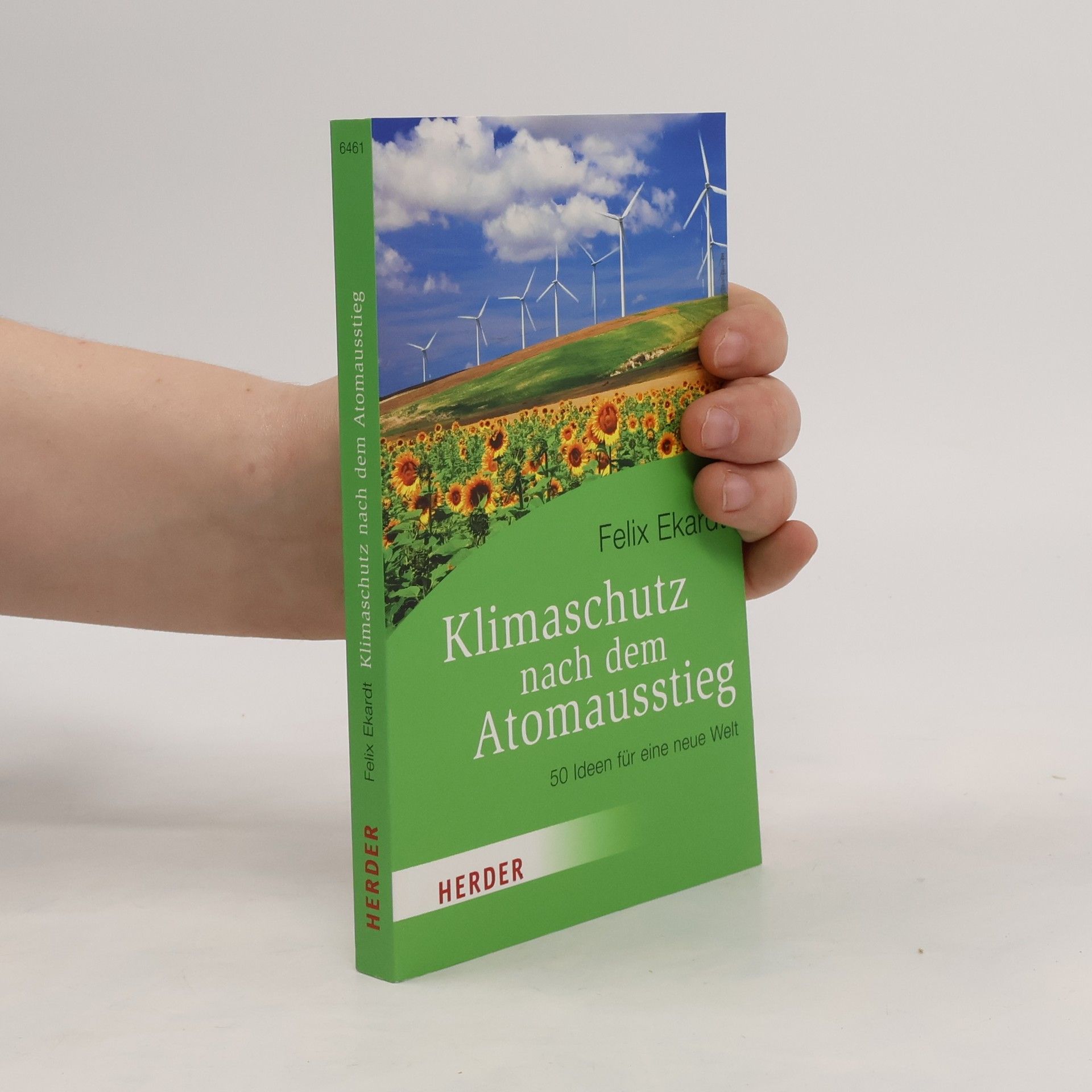
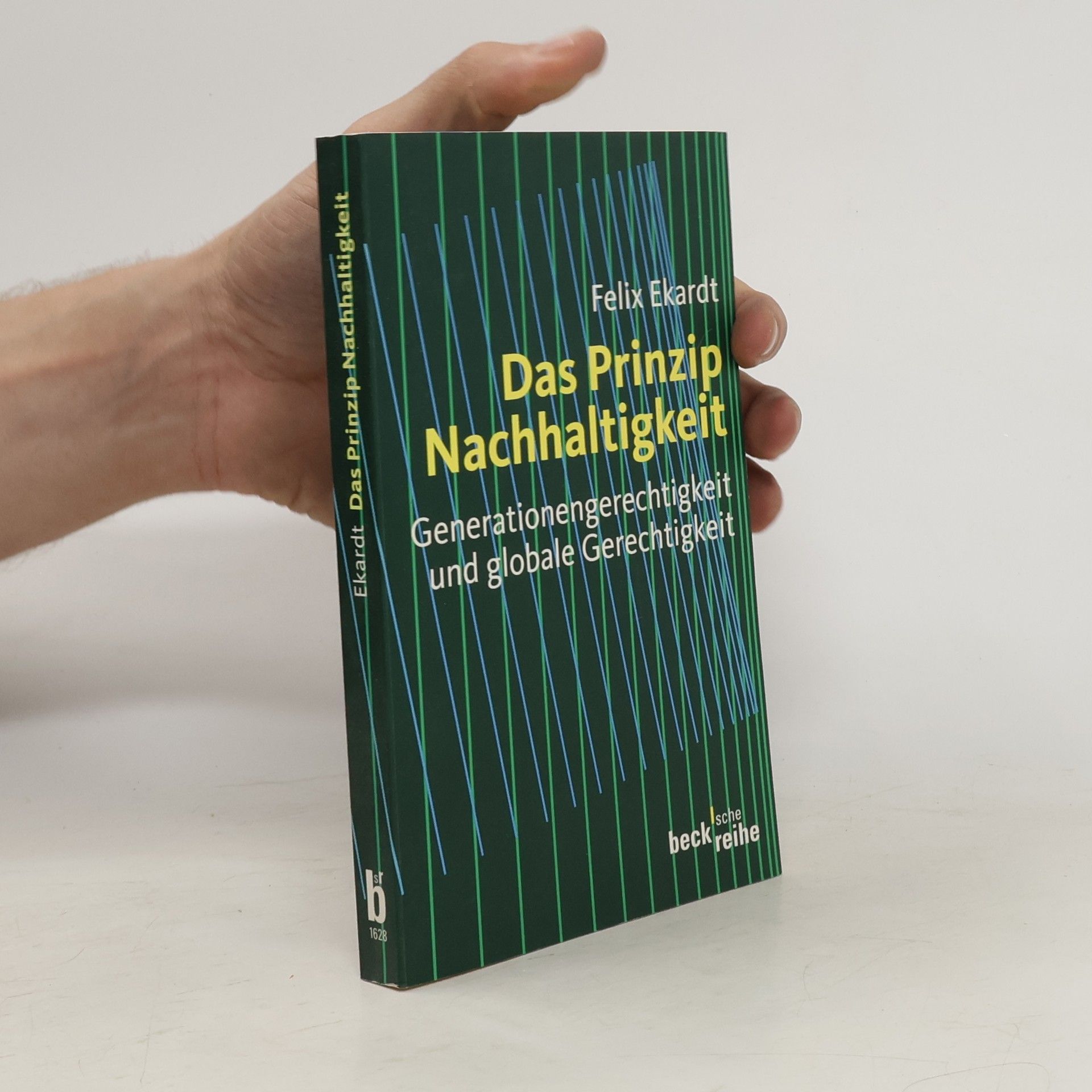
Economic Evaluation, Cost-Benefit Analysis, Economic Ethics
A Review with Regard to Climate Change Figures in the Sustainability Discourse
- 172 Seiten
- 7 Lesestunden
The book explores the role of cost-benefit analysis in decision-making, particularly in relation to climate change and sustainability. It critiques the normative underpinnings of this economic approach, arguing that it faces significant theoretical and practical challenges, especially concerning distributive justice and democratic principles. The author highlights conflicts between cost-benefit analysis and liberal-democratic values, as well as its limitations in practical applications, suggesting that while it may offer useful insights, it should not be the sole basis for ethical or legal decisions.
Forest Governance
Overcoming Trade-Offs between Land-Use Pressures, Climate and Biodiversity Protection
- 252 Seiten
- 9 Lesestunden
The book critically explores forest policy and governance, emphasizing the historical context and the potential of afforestation and reforestation for climate mitigation. It argues that ambitious climate and biodiversity targets necessitate resilient, biodiverse forests as effective carbon sinks. The analysis reveals shortcomings in current European and international governance approaches, proposing a series of policy measures. Key strategies include quantity governance systems targeting deforestation drivers, regulatory protection for old-growth forests, and a shift towards public funding for conservation efforts.
Theorie der Nachhaltigkeit
Ethische, rechtliche, politische und transformative Zugänge - am Beispiel von Klimawandel, Ressourcenknappheit und Welthandel
- 777 Seiten
- 28 Lesestunden
Die Frage nach Deutschlands Rolle als Umweltvorreiter steht im Mittelpunkt der Diskussion über Nachhaltigkeit. Das Buch untersucht, ob dauerhaft tragfähige Lebensformen technisch umsetzbar sind und welche Konsequenzen dies für die Wachstumsgesellschaft hat. Es beleuchtet die Herausforderungen und Widersprüche, die mit der Umsetzung von Umweltzielen verbunden sind, und regt dazu an, über die Zukunft des Wachstums und die Möglichkeiten einer nachhaltigen Entwicklung nachzudenken.
Kurzschluss
Wie einfache Wahrheiten die Demokratie untergraben
»Vernunft ist nicht der Feind, sondern der Grund der Freiheit.« In einer immer komplizierteren Welt sind aktuell Kräfte auf dem Vormarsch, die einfache Wahrheiten und Lösungen versprechen. Doch nicht nur Populisten und ihre Anhänger, sondern wir alle tragen latent die Neigung zu vereinfachten, verzerrten und bequemen Ansichten in uns, auch die intellektuellen Weltverbesserer. Nur werden wir mit einfachen Wahrheiten die Probleme einer globalisierten Welt nicht lösen, sondern dramatisch scheitern. Wenn wir Uneindeutigkeit und Komplexität nicht aushalten, hat die offene Gesellschaft dauerhaft keine Chance. Felix Ekardt lotet in seinem neuen Buch aus, wie wir Vernunft und Demokratie langfristig fördern und bewahren können - und warum sie in der Gefahr stehen, eine historische Ausnahmeerscheinung zu bleiben.
Wir können uns ändern
Gesellschaftlicher Wandel jenseits von Kapitalismuskritik und Revolution
Warum fällt es uns so schwer, uns zu ändern? Warum gelingt die Transformation zu einer nachhaltigen Gesellschaft nicht? Scheitern wir mit unseren Vorsätzen an unseren Genen? Ist der Kapitalismus an allem schuld? Wer verstehen will, was Menschen und Gesellschaften antreibt, was Wandel ermöglicht oder blockiert, darf nicht bei mangelnder Bildung oder Hirnforschung stehen bleiben. Viel wichtiger ist es, menschliches Verhalten in all seinen Facetten zu beleuchten – und das ist in hohem Maße emotional gesteuert, von Eigennutzen getragen oder von kulturellen Werten geprägt. Felix Ekardt liefert eine gleichermaßen kompakte wie ganz neue Wege einschlagende Analyse zum Thema »Wandel und Veränderung«. Indem er die Erkenntnisse aus zahlreichen Forschungsrichtungen zusammenführt, legt er nicht nur den Grundstein für ein besseres Verständnis von Wandel. Er zeigt auch auf, wie wir ihn tatsächlich herbeiführen können.
Die Energiewende ist eine Jahrhundertaufgabe. Doch die bisherige Energie- und Klimapolitik greift viel zu kurz. Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung sind Deutschland und Europa beispielsweise von ihren Klimazielen meilenweit entfernt. Unbequeme Wahrheiten, wie die Notwendigkeit zur konsequenten Verteuerung der fossilen Brennstoffe, werden nicht diskutiert. Felix Ekardt setzt sich mit der Frage auseinander, wie Gesellschaften und der Einzelne sich verändern und so zu einer echten globalen Energiewende beitragen können, obwohl unsere alltäglichen Wünsche dem oft entgegenstehen. Er beschreibt, warum ein deutsches beziehungsweise europäisches Vorangehen (auch ökonomisch) sinnvoll sein könnte - und warum neue Lebensstile keine Einschränkung sind, sondern Freiheit und soziale Gerechtigkeit erst ermöglichen.
Klimaschutz nach dem Atomausstieg
50 Ideen für eine neue Welt
Herder Spektrum: Cool down
50 Irrtümer über unsere Klima-Zukunft - Klimaschutz neu denken
- 192 Seiten
- 7 Lesestunden
Die bisherige Klimapolitik ist weitestgehend gescheitert, erste Auswirkungen eines dramatischen Klimawandels sind bereits spürbar. Was ist zu tun? Felix Ekardt zeigt, warum wir die Jahrhundertaufgabe Klimaschutz ganz neu denken müssen. Und wie ein anderer globaler Klimaschutz und neue Lebensstile uns zufriedener machen können - jenseits des Glaubens ans grenzenlose Wirtschaftswachstum.
Wird die Demokratie ungerecht?
- 213 Seiten
- 8 Lesestunden
Die Reformdebatten über Steuern, Arbeitsmarkt, Sozialsystem und Demographie verfehlen gespenstisch unsere Kernprobleme: Nationalstaatliche Politik ist zunehmend machtlos. Und der bisherige westliche Lebensstil, basierend auf Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung, ist weder dauerhaft noch global lebbar. Auch mit mehr Leistung und mehr Gemeinsinn wird Deutschland nicht wieder „Weltspitze werden“. Politiker, Talkshows und liberal-konservative Vordenker lenken von den eigentlichen Fragen ab: Wie können wir allen Menschen in einer globalisierten Welt (und auch künftigen Generationen) faire Chancen geben - und wie verhindern wir, daß unsere Freiheit von ökonomischen Sachzwängen schleichend zerstört wird.