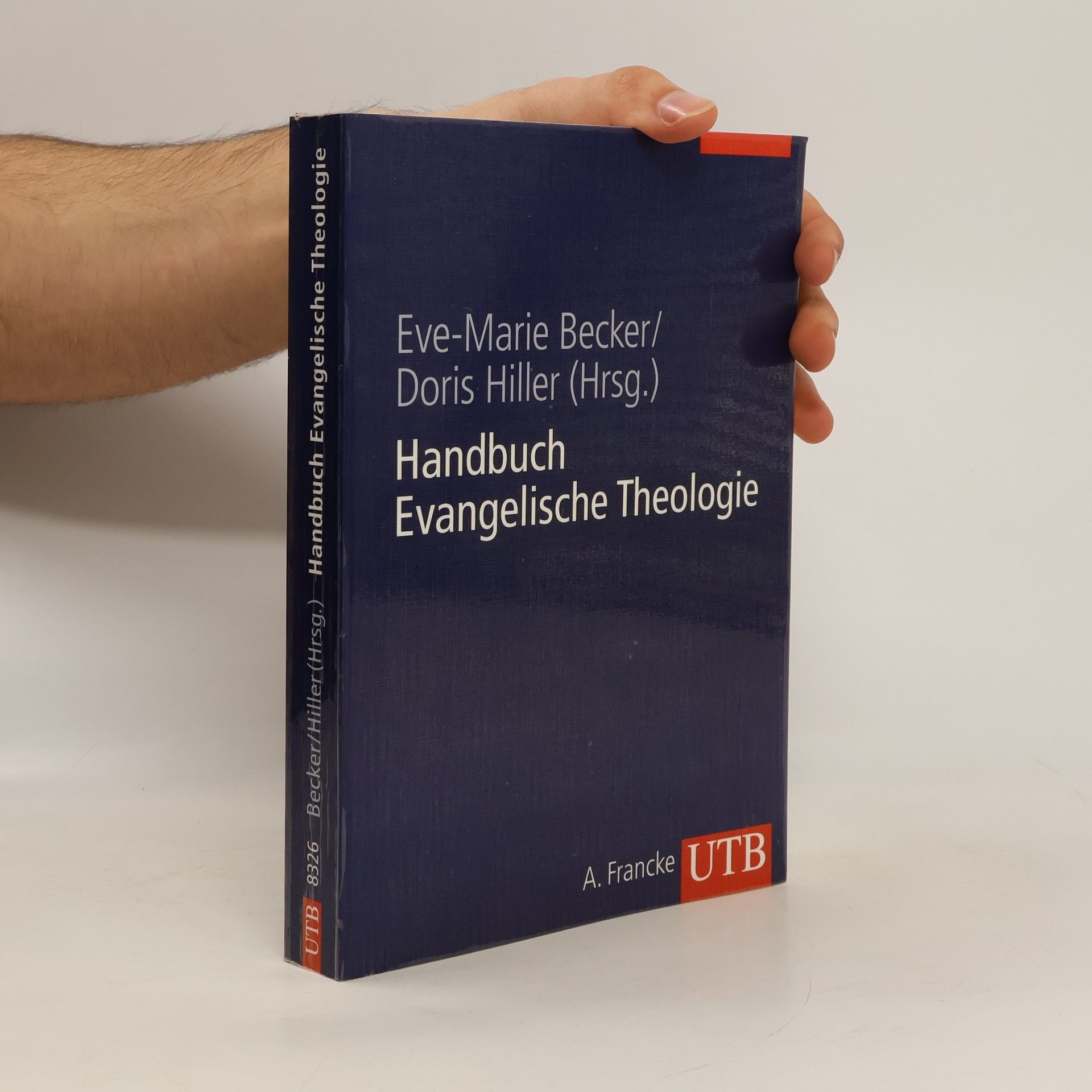Ursprünge der christlichen Geschichtsschreibung
Von Markus bis zum lukanischen Doppelwerk
- 270 Seiten
- 10 Lesestunden
Die Studie von Eve-Marie Becker beleuchtet das frühchristliche Geschichtsbewusstsein und dessen literarische Entwicklung im Kontext der hellenistischen Erinnerungskulturen und Geschichtsschreibung. Sie untersucht die Entstehung der neutestamentlichen Schriften zwischen dem ersten und frühen zweiten Jahrhundert und identifiziert bereits bei Paulus Ansätze eines geschichtlichen Denkens. Becker analysiert die konzeptionellen Ursprünge der Geschichtsschreibung von Markus bis Lukas und zeigt auf, wie die früheste christliche Erzählliteratur das Verständnis von Geschichte im Christentum entscheidend prägt.