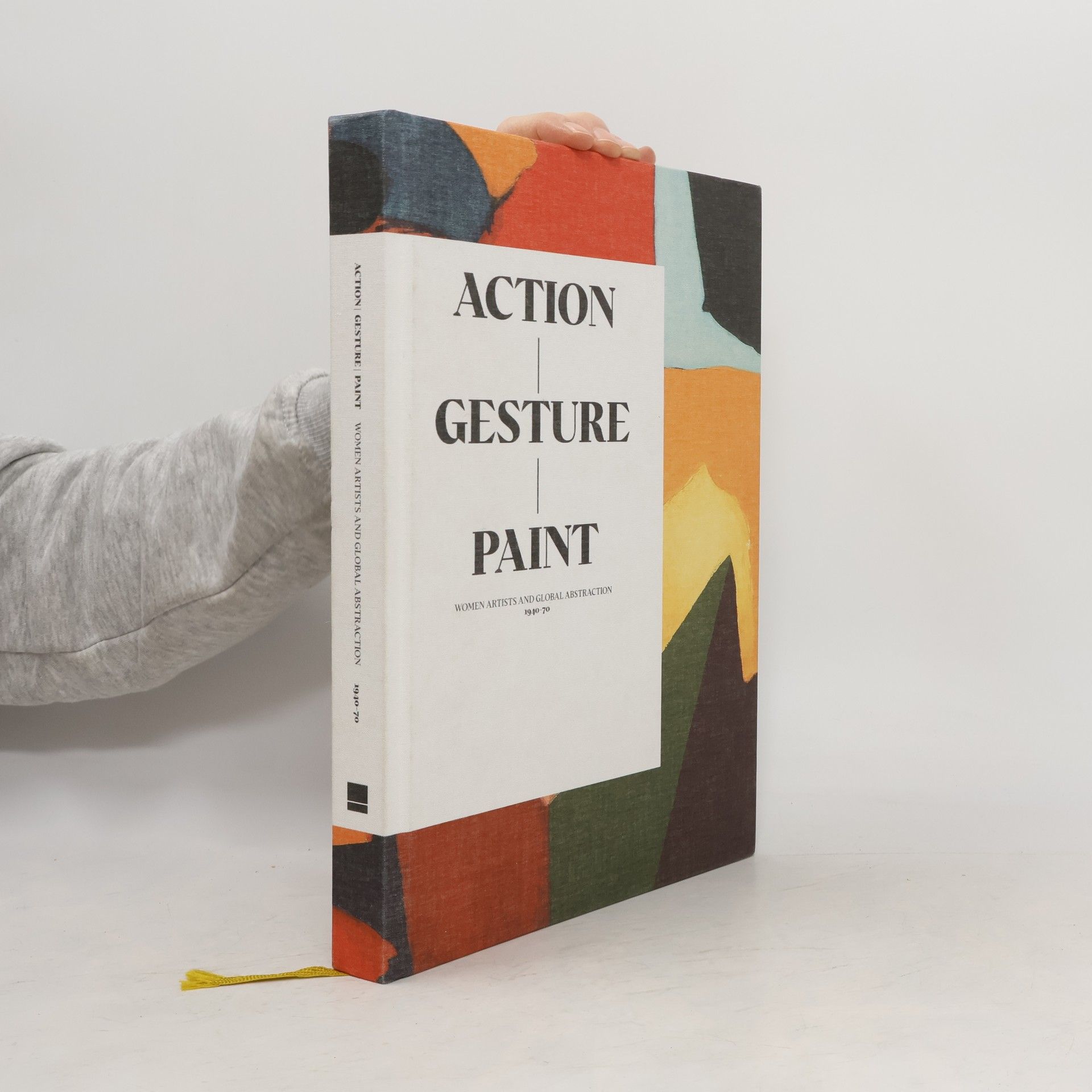Leben mit Borderline für Dummies
- 400 Seiten
- 14 Lesestunden
Borderline ist eine ernsthafte, aber oft vernachlässigte Persönlichkeitsstörung, die das Leben der Betroffenen und ihrer Angehörigen massiv beeinträchtigen kann. Betroffene leiden häufig unter Impulsivität, gestörter Selbstwahrnehmung und raschen Stimmungsschwankungen oder sie haben Schwierigkeiten, stabile Beziehungen zu führen. Das Buch hilft Betroffenen und Angehörigen dabei, Symptome richtig zu deuten, liefert Techniken, um zerstörerisches Verhalten unter Kontrolle zu bekommen, erläutert moderne Therapieformen und zeigt Wege auf, um langfristig ein normales Leben führen zu können.