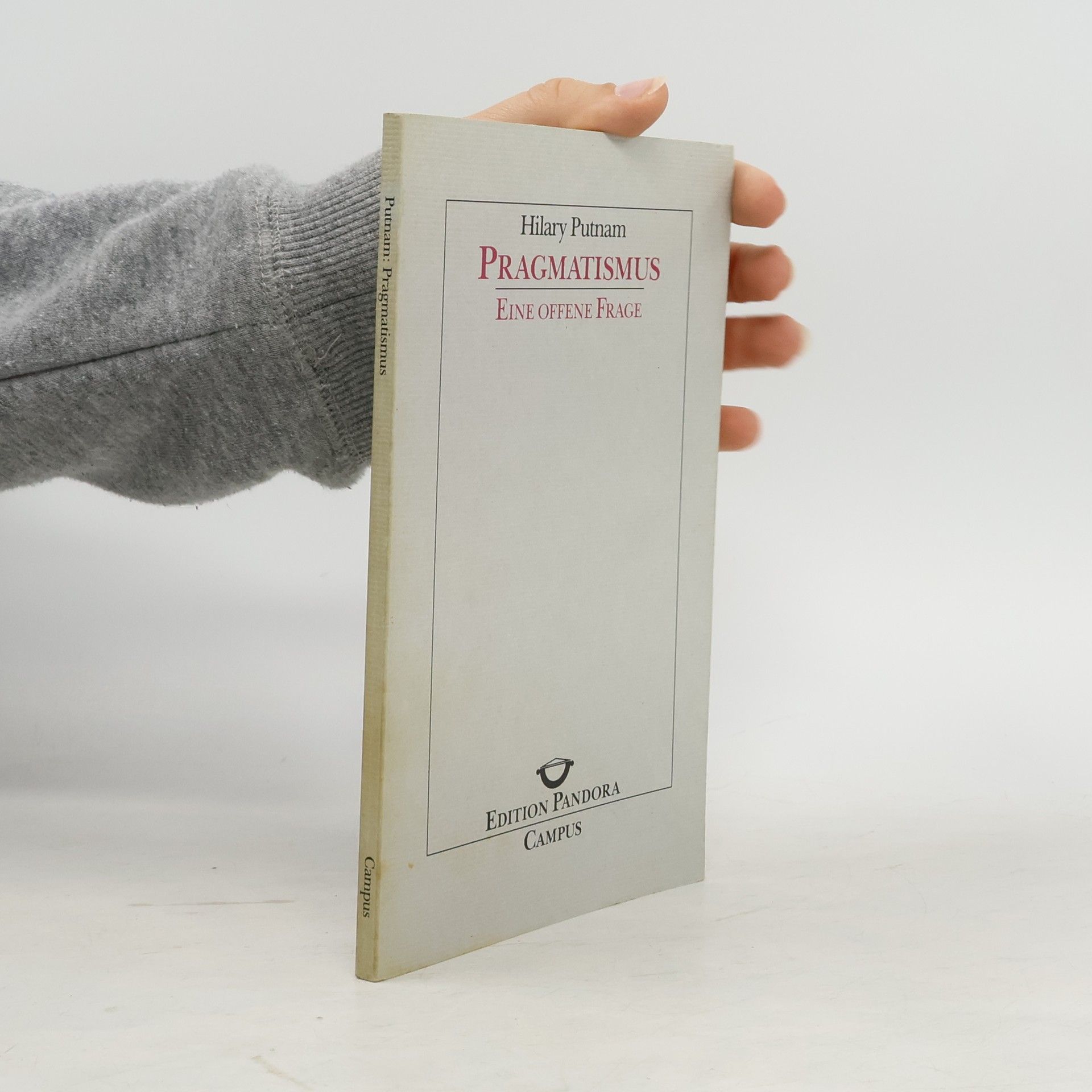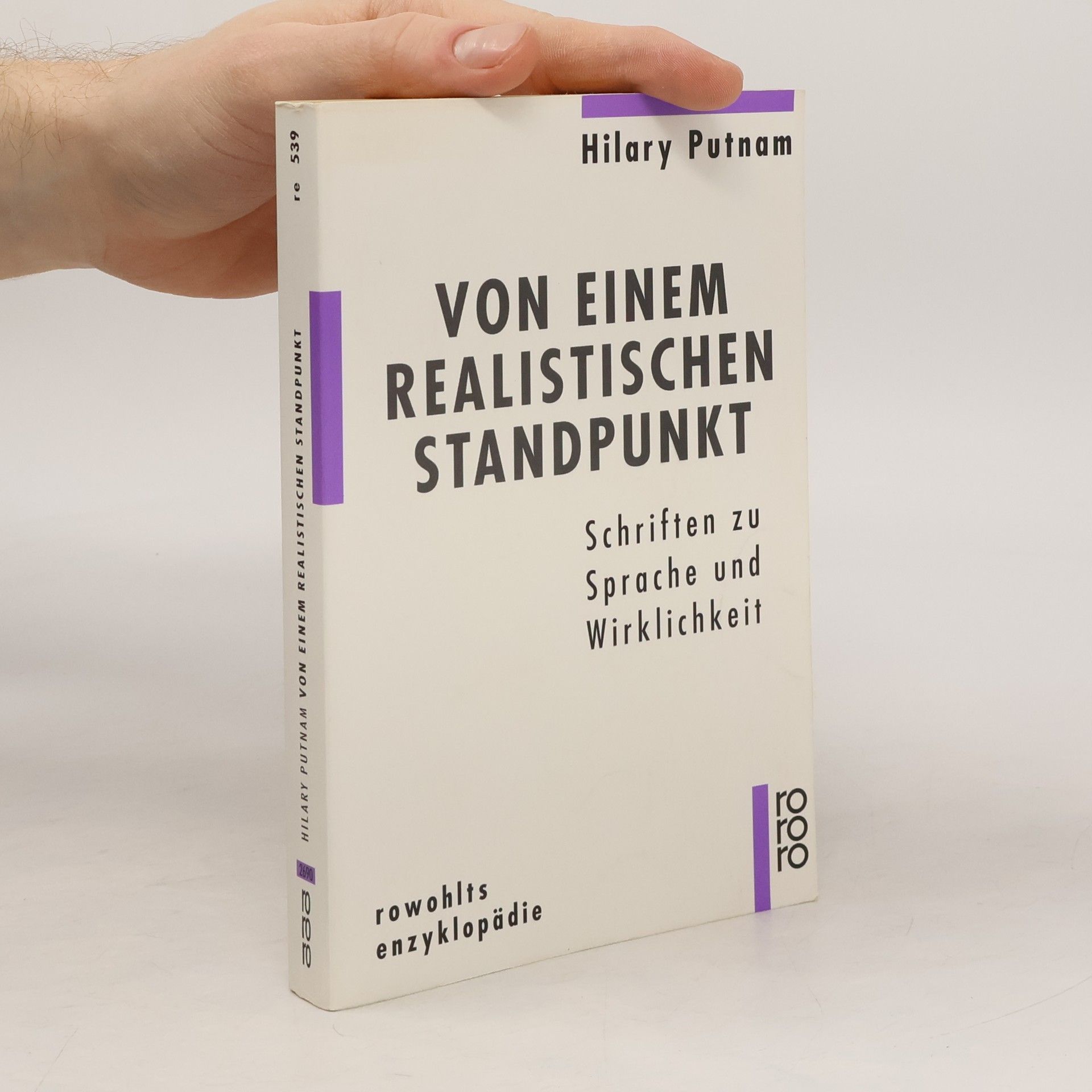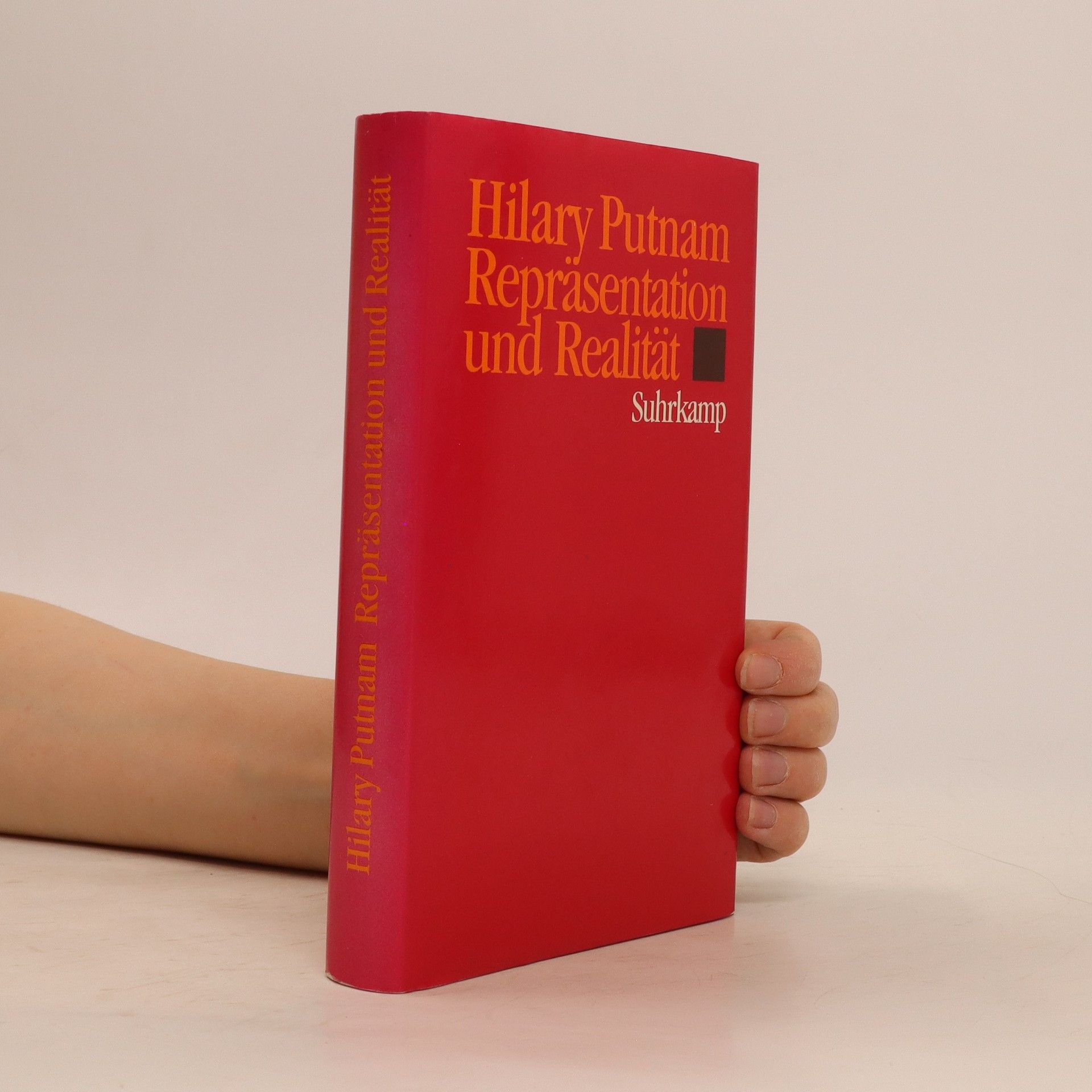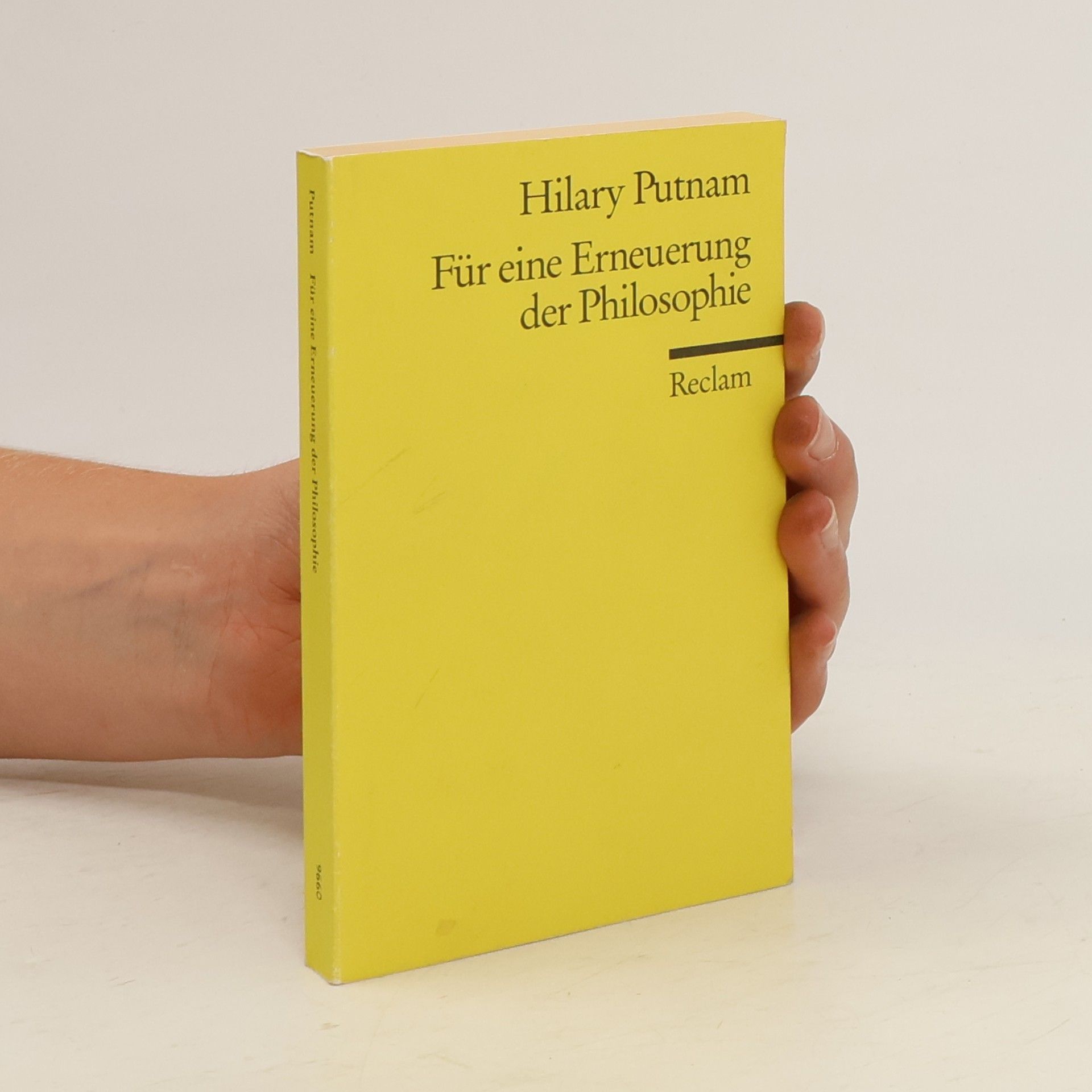Für eine Erneuerung der Philosophie
- 284 Seiten
- 10 Lesestunden
Der Harvard-Professor Hilary Putnam zählt mit Quine, Davidson und Rorty zu den bedeutendsten amerikanischen Philosophen der Gegenwart. Putnam liefert in diesen Essays „eine Diagnose der gegenwärtigen philosophischen Situation“ und weist „die Richtungen, die eine Erneuerung der Philosophie einschlagen müsste“. Die Themen: Das Projekt der künstlichen Intelligenz - Erklärt Evolution Repräsentation? - Eine Referenztheorie - Materialismus und Relativismus - Bernard Williams und die absolute Vorstellung von der Welt - Irrealismus und Dekonstruktion - Wittgenstein über den religiösen Glauben - Wittgenstein über Referenz und Relativismus - Deweys Demokratie neu betrachtet.