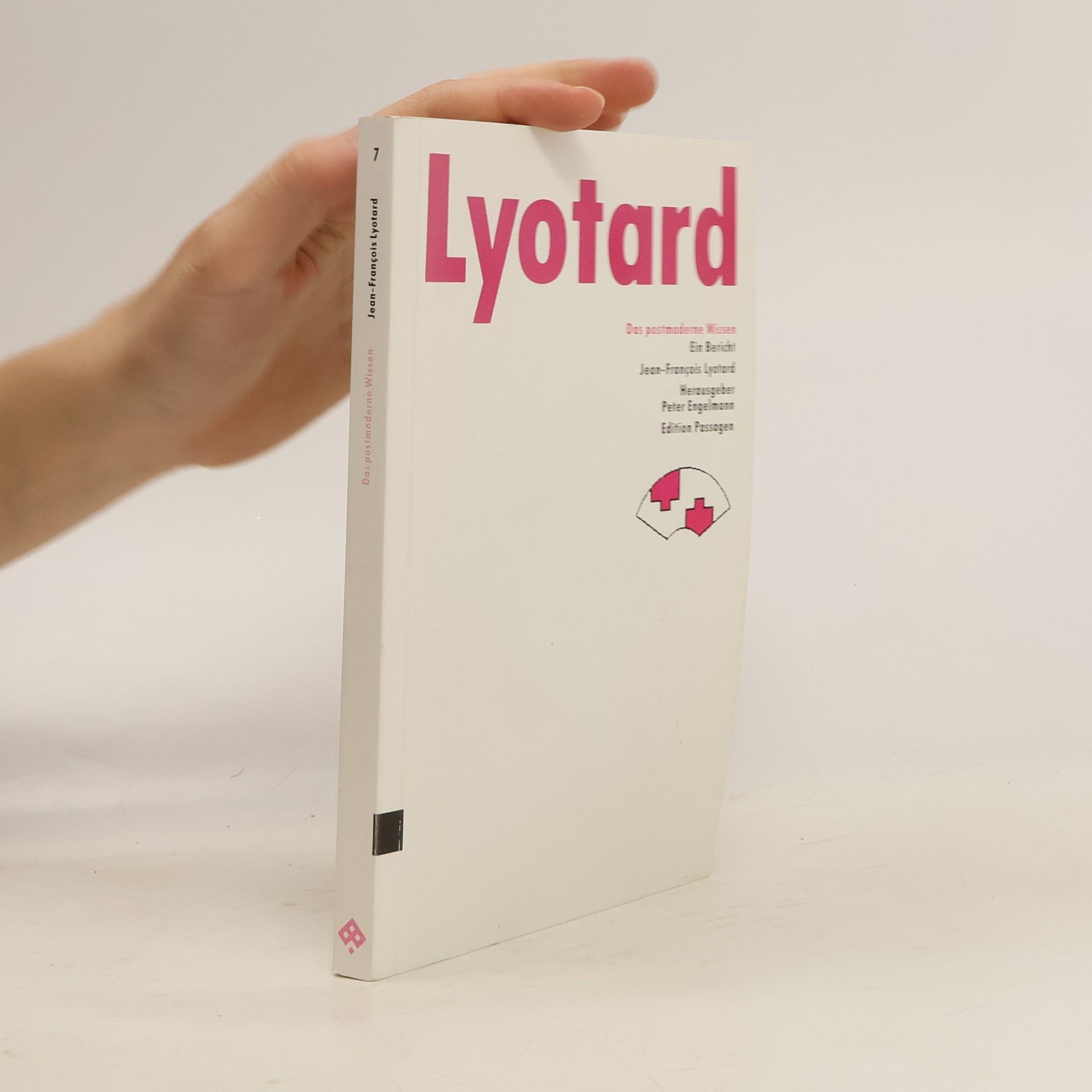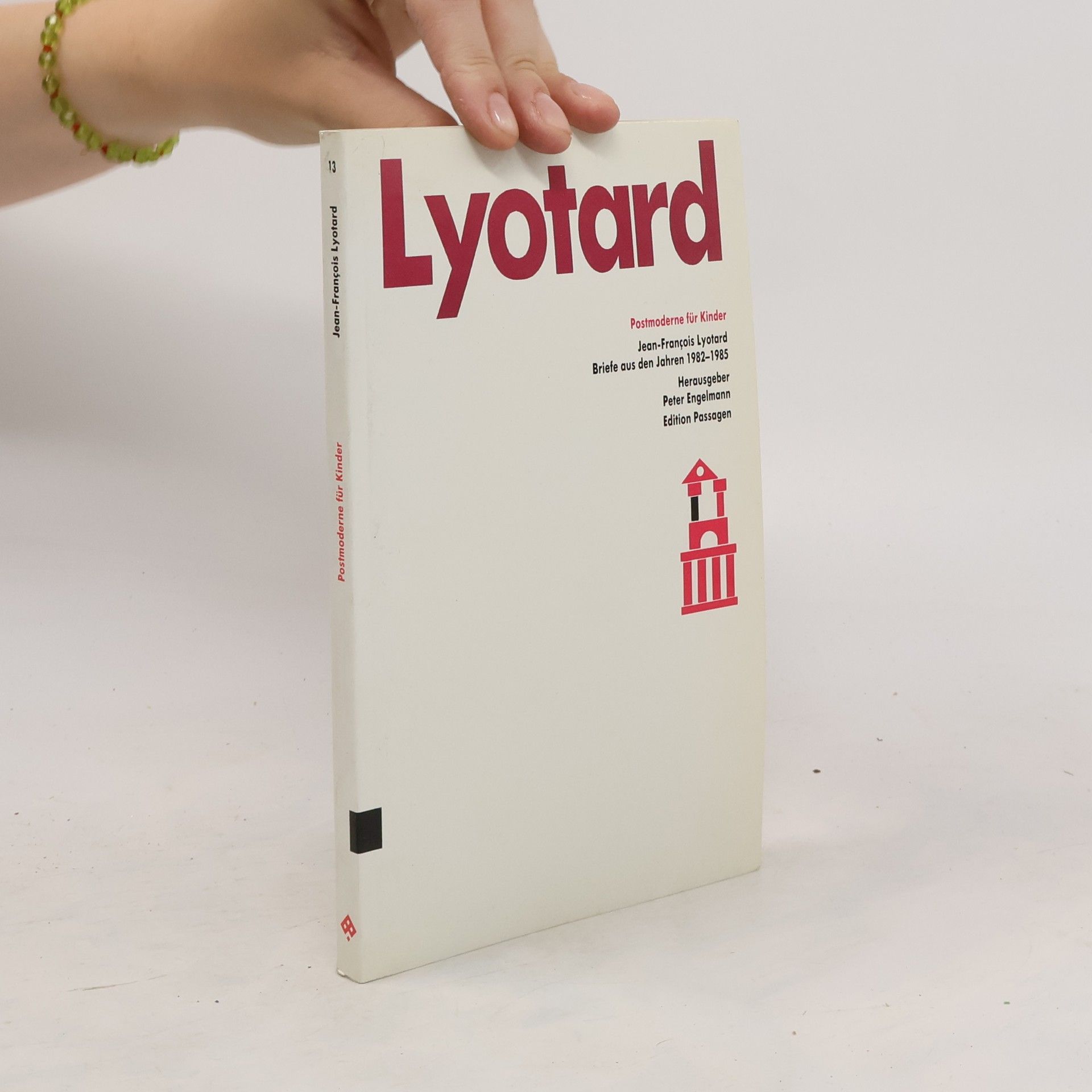Der Streit, von dem Lyotard spricht, ist ein "Widerstreit" zwischen ungleichförmigen Diskursarten, zwischen Sätzen, die verschiedenen heterogenen Regelsystemen angehören Argumetieren, Erkennen, Beschreiben, Erzählen, Fragen, Befehlen usw. "Der Begriff des Streits bezeichnet eine ontologische Situation des richterlichen Urteilens. Richterlich, insofern der Richter angesichts der von jeder Partei vorgebrachten Beweisführung nicht entscheiden kann, denn er verfügt über keine Regel, die auf beide Fälle anwendbar wäre. [...] Er verhält sich so, als gebe es zwei Rechte und kein Meta-Recht" (Change International, 2/1984). Was sich hier abzeichnet, ist eine Philosophie der Diaspora, der Heterogenität von Diskursarten, die nicht ineinander übersetzbar sind. Ihr Kontext: "Die Sprachwende der abendländischen Philosophie (die letzten Werke Heideggers, das Eindringen anglo-amerikanischer Strömungen ins europäische Denken, die Entwicklung von Sprach-Technologien); im Verein damit der Niedergang der universalistischen Diskurse (der metaphysischen Doktrinen der Moderne: der Erzählung [récist] vom Fortschritt, vom Sozialismus, vom Überfluß, vom Wissen). Die Theorie-Müdigkeit und die elende Erschlaffung, die sie begleitet (Neo-dies, Neo-das, Post-dieses, Post-jenes). Die Stunde des Philosophierens."
Jean-François Lyotard Bücher
- François Laborde
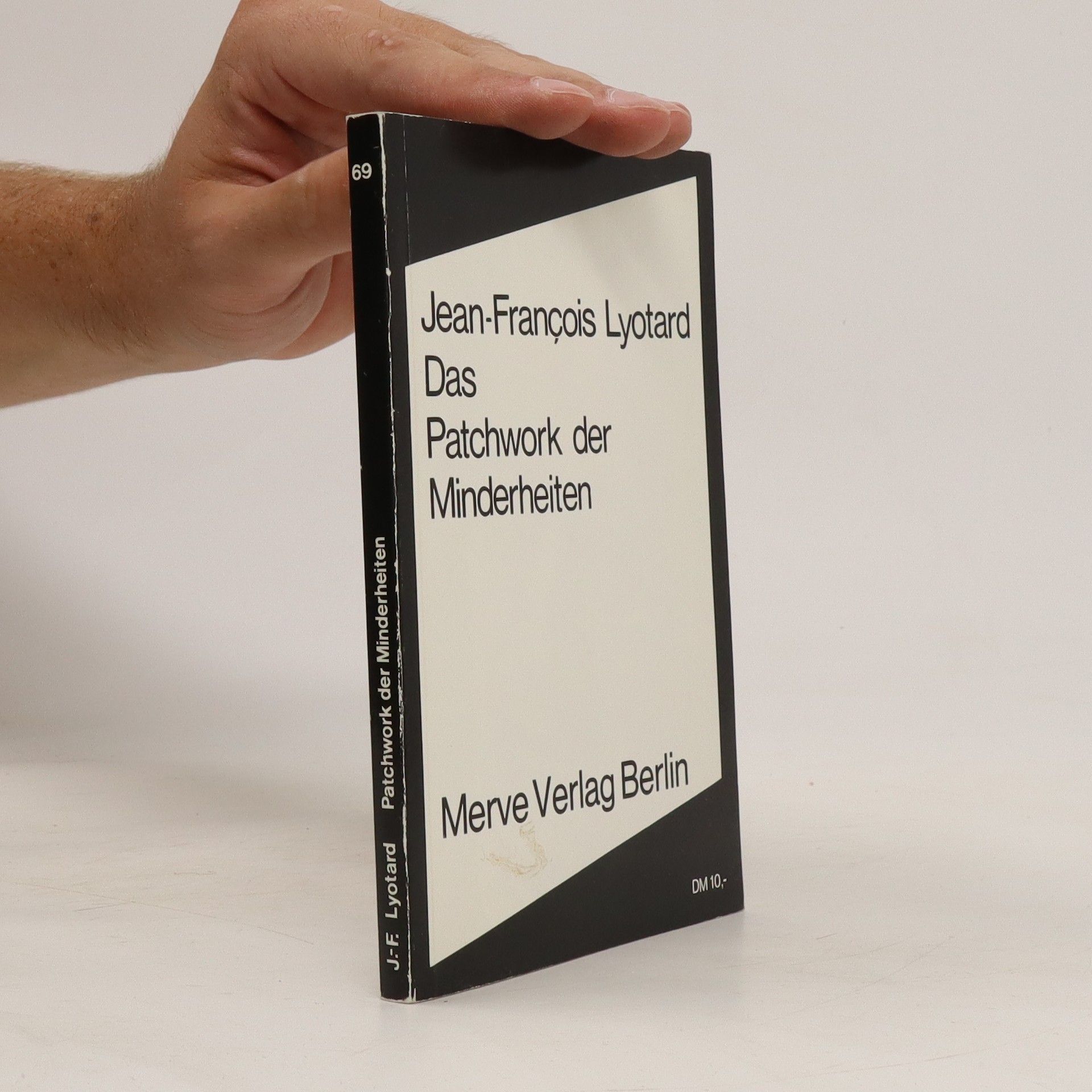

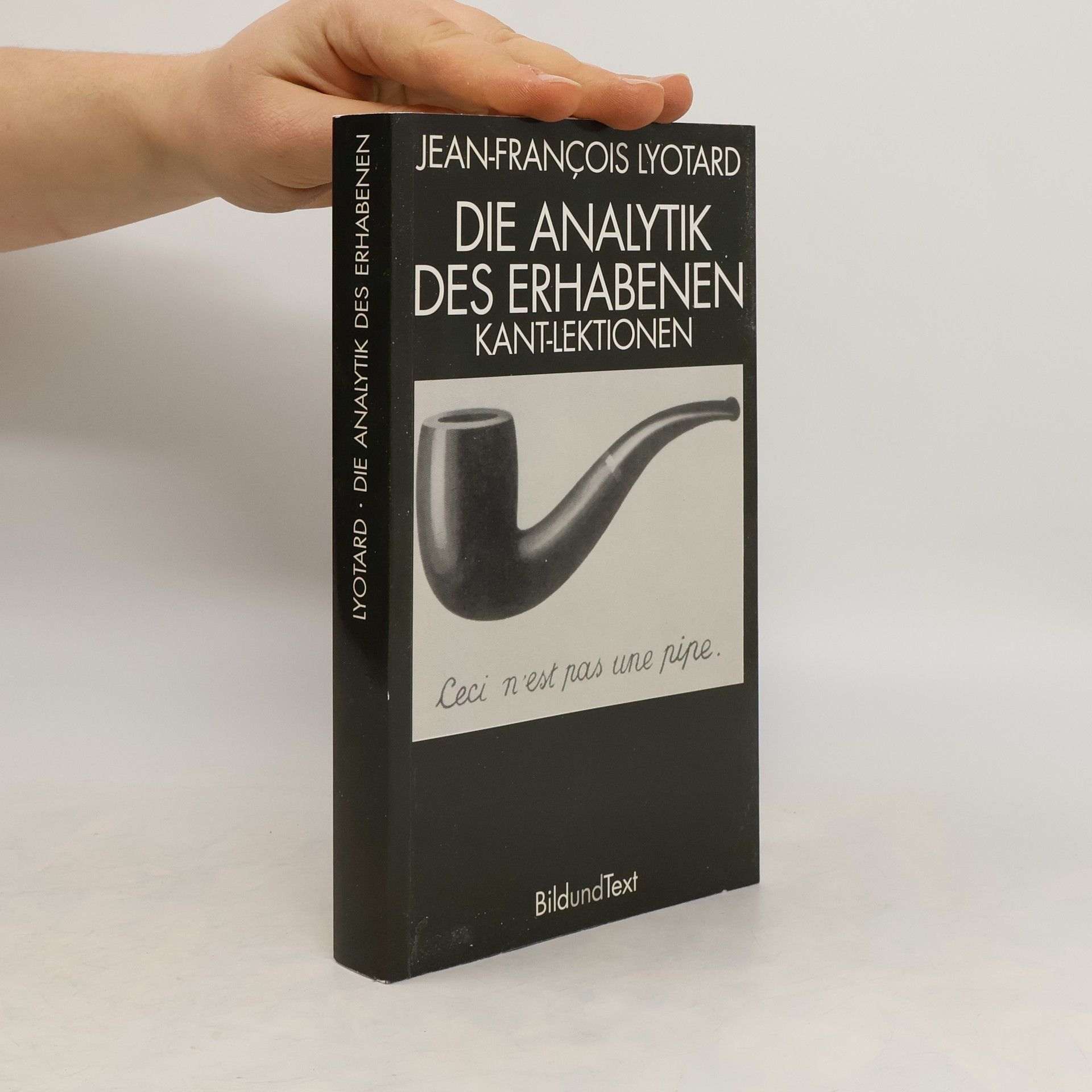
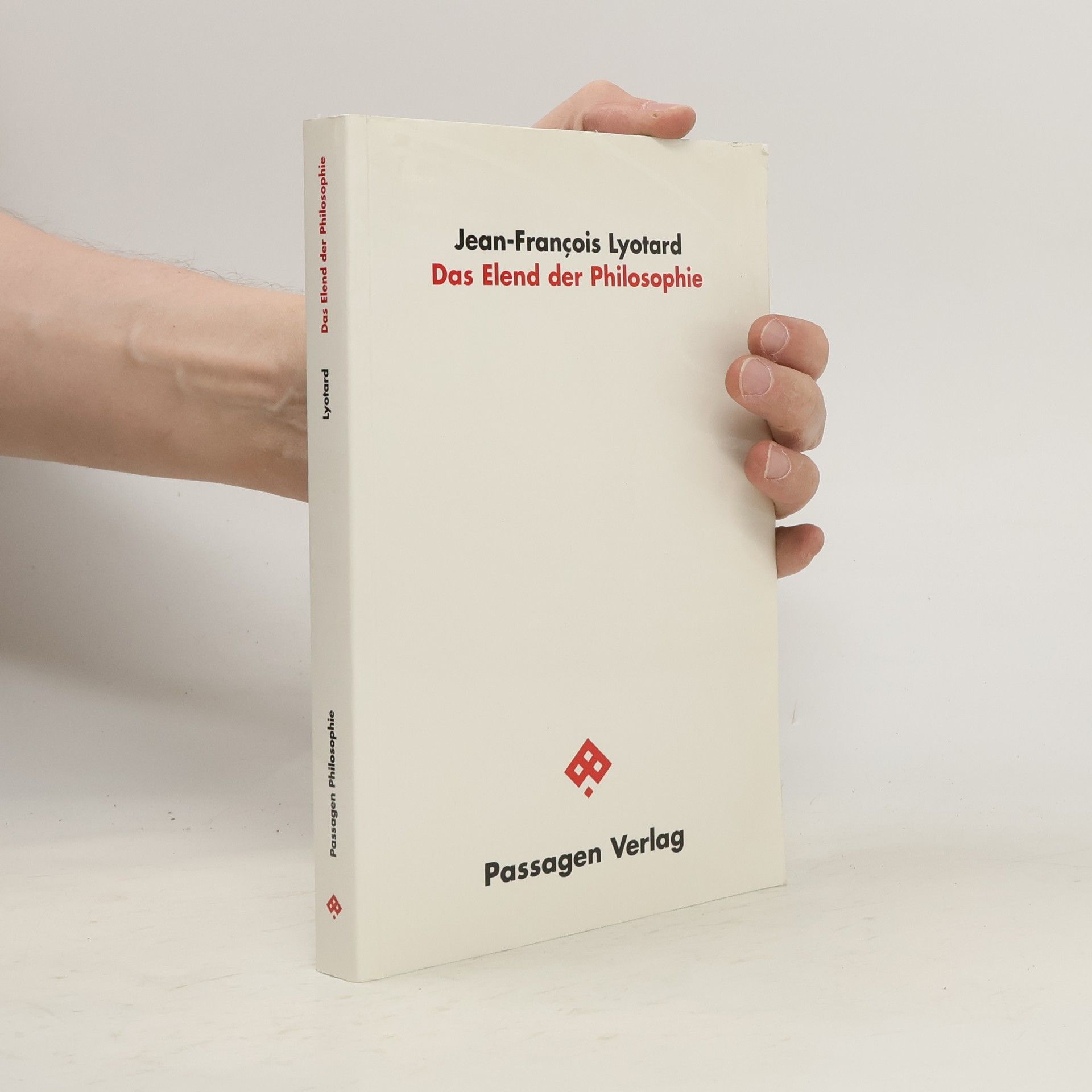
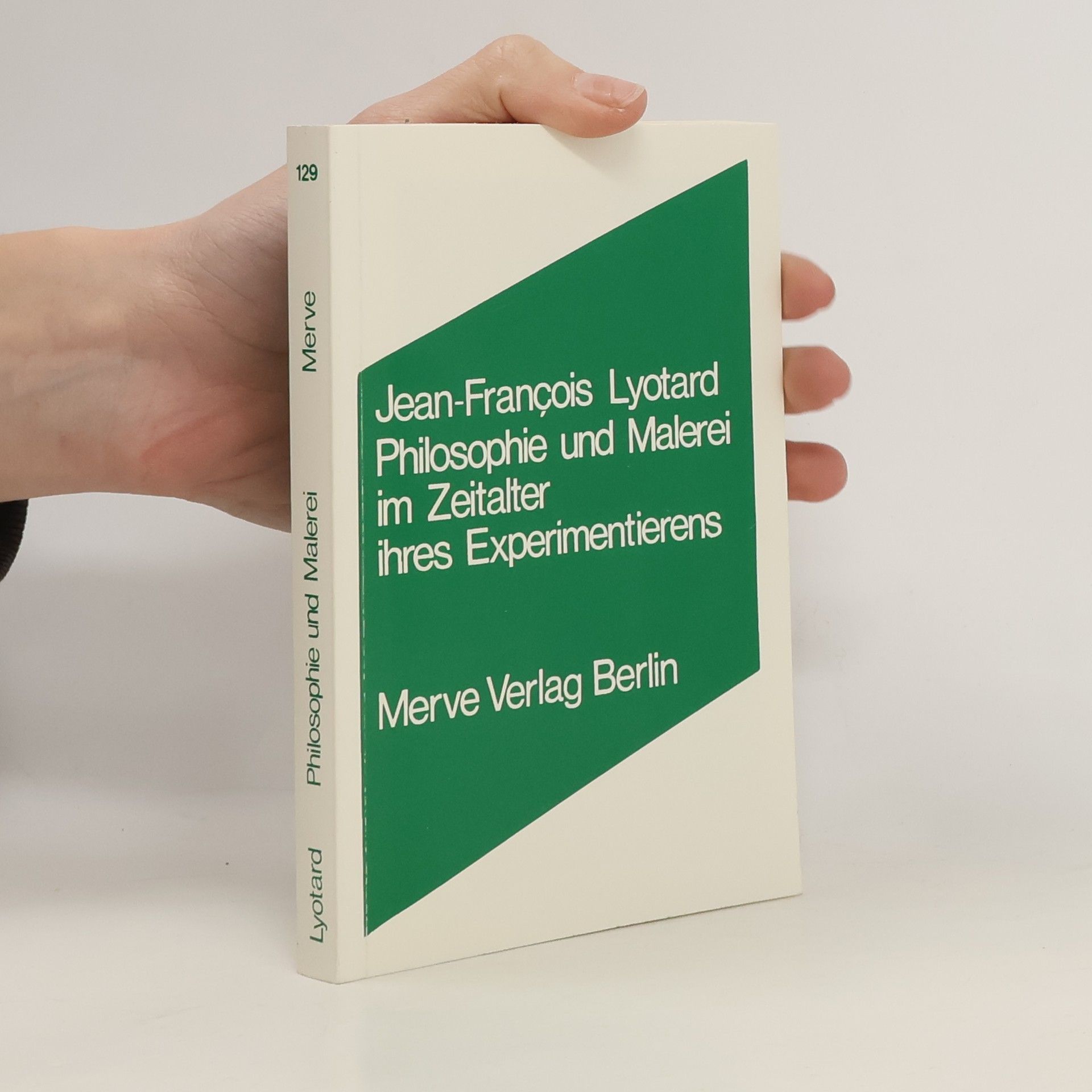

Gibt es heute noch Gründe, die Größe des Denkens zu schätzen? Versteht man die Macht des Geistes als einen die Realität restlos verschlingenden Alptraum, dann kann Denken heute nur heißen, der Herausforderung der Demut standzuhalten: „Elend der Philosophie“. Ob sie nun Kunst, Literatur, Psychoanalyse, Religion oder ihre eigene Praxis im Namen des Juden- oder Christentums, im Namen von Bataille, Freud, Quignard, Kant, Châtelet oder Skira befragt – Lyotards „philosophie en acte“ akzentuiert „ihren Sinn der Trennung“. Die Erfahrung hat kein ihr immanentes Konzept, man muss sie dekonstruieren und rekonstruieren. An erster Stelle steht die Sensibilität, eine passive und unüberwindliche Endlichkeit des ganzes Wissens. Nichts wird ohne Rest gedacht, ohne Verlust gelebt. Was bleibt, ist die Ausübung des Widerstreits, „der Geist in Alarmbereitschaft, durch das alarmiert, was ihm geschieht und was ihn verstört.“
Die Analytik Des Erhabenen
- 273 Seiten
- 10 Lesestunden
Grabmal des Intellektuellen
- 89 Seiten
- 4 Lesestunden
Lyotard versucht, Antworten auf die Fragen nach dem Status, der Rolle und der Funktion des Intellektuellen zu finden. Wie Michel Foucault geht auch Lyotard davon aus, dass sich der Intellektuelle heute nicht mehr mit universellen Subjekten identifizieren kann. Anders als viele kritische Intellektuelle in Deutschland betrachtet er den Zerfall der Idee der Universalität aber nicht als Katastrophe, sondern als eine Möglichkeit, sich von der Obsession der Totalität zu befreien und endlich zu einem neuen Selbstverständnis kritischer Intelligenz zu kommen. Zudem setzt sich Lyotard mit der „Lektion in Sachen Progressismus“ auseinander, die Habermas den französischen Philosophen glaubte erteilen zu müssen. Darin erweitert er seine Überlegungen zur Postmoderne um eine politische Dimension und stellt klar, dass der angebliche Neokonservatismus der französischen Philosophen eine Erfindung deutscher Theoretiker ist, die um ihr Kritikmonopol bangen.
Jean-Francois Lyotard, 1925 geboren, während des Algerienkriegs in der linksradikalen Gruppe um die Zeitschrift "Socialisme ou Barbarie" engagiert, dann in Nanterre, jetzt an der Universität Paris-Vincennes Ordinarius für Philosophie - er ist inzwischen wohl eher ein Barbar im "Reich" des Sozialismus, und nicht nur dort, ein Fremdling, der die Grenzen des Imperiums durchlöchert und die Kategorien des Zentrums zerfleddert.In den Texten, die hier zusammengestellt sind, schreibt er über die Minderheiten, über das viel förmige und prekäre Patchwork, das sie bilden. Er folgt ihren Listen und Finten, die die monotonen und zentralisierten Räume verdrehen, ihren Bewegungen in der verzwickten Zeit des Begehrens und schleicht sich mit ihnen in ökonomische, politische Diskurse ein, um Paradoxa zu installieren, die deren Ordnung und Logik platzen lassen. Diese Operationen sind durch und durch bejahend, und ihre Methode ist weniger die Kritik als ein raffiniertes Speil mit Fallen, Intensitäten und Perspektiven.
Lyotard fragt in diesem Buch, wie die Künste des Sehens, der Schrift und des Tones in der eigentümlichen Entwicklung, der die Menschen unterliegen, ihre paradoxale Wahrheit bewahren. Die Menschen werden heute durch das "verwaltete Leben" (Adorno) in eine unmenschliche Entwicklung hineingerissen, die man längst nicht mehr Fortschritt nennen kann. Denn das "verwaltete Leben" vernichtet die entscheidenden menschlichen Fragen nach der Zeit, dem Gedächtnis und der Materie, indem es diese programmiert. Politische und philosophische Alternativen zu diesem Prozess sind heute verschwunden. Die einzige Möglichkeit sich dagegen zu wehren, scheint eine andere menschliche Haltung zu sein: die Selbst-Enteignung, die in jedem schlummert, die Rückkehr in seine unbezähmbare Kindheit. Diese Strategie, welche die Neo-Humanismen vermitteln, ist jedoch banal und führt nicht zu den entscheidenden Fragen zurück. Lyotard geht auf diese ein, indem er zeigt, wie die Künste des Sehens, der Schrift und des Tones ihre paradoxale Wahrheit bewahren.
Die »Économie libidinale« ist Lyotards frühes Hauptwerk und zugleich seine problematischste Schrift. Erschienen 1974, blieb das Buch in Deutschland trotz einer ersten deutschen Ausgabe (1984) weitgehend unbeachtet, obwohl es einen Meilenstein in Lyotards Philosophie darstellt. Es markiert seine Abkehr von der Gruppe »Socialisme ou barbarie« und seinen Bruch mit dem Marxismus. Dieser Bruch zeigt sich in einem im akademischen Bereich ungewohnten Ton, den Lyotard selbst als »bösartig« bezeichnete. Seine scharfe Kritik an den Marxisten mündet in eine Theorie der Leidenschaften, die das Theoretische auf beinahe selbstzerstörerische Weise meidet und eine skandalöse Verteidigung des libidinösen Austauschs über alle Grenzen hinweg bietet. Der Leser begegnet einem zerrissenen Text, der die Leidenschaften in der politischen Ökonomie und das Politische in den Leidenschaften verortet, während er sich gleichzeitig einer Festlegung entzieht. Die aggressive Vervielfältigung von Stilen und Schreibweisen eröffnet dem Text verschiedene konkurrierende Lesarten und Anwendungsformen: Ein Text, der als große Haut-Fläche, als umgestülpter Körper oder als Möbiusband erscheint – heute aktueller denn je.
In deutscher Sprache erstmals 1982 in einer Zeitschrift veröffentlicht, avancierte „Das postmoderne Wissen“ – wie zuvor schon in Frankreich, Amerika und Italien – zum entscheidenden Schlüsseltext für die gerade erst beginnende Diskussion um die Postmoderne. Ausgehend von Wittgensteins Theorie der Sprachspiele entwickelt Jean-François Lyotard Ansätze zu einem völlig neuen, philosophischen Begriff der Postmoderne. Mit der Verwendung des Begriffs in der Architektur hat Lyotards philosophischer Postmoderne-Begriff nur noch den Namen gemein. Er versucht vielmehr, den zu Ende des 20. Jahrhunderts einsetzenden, fundamentalen Umbruch der Gesellschaftstechnologien zu erfassen. Das prognostizierte Ende der „großen Erzählungen” von Freiheit und Aufklärung erschüttert den eingefahrenen Glauben an Konsens und Wissenschaft als interessefreien Raum und führt konsequent die Aporien des „Projekts Aufklärung” vor. Das Werk Jean-François Lyotards bestimmt auch gegenwärtig eine der wichtigsten philosophischen Diskussionen um Ethik und Handlungsfähigkeit im nächsten Jahrtausend.
Das Wort Postmoderne ist inzwischen zu einem Schlüsselbegriff für das Verständnis unserer kulturellen, sozialen und politischen Umwelt geworden. Mit seinem Buch „Das postmoderne Wissen“ hat Jean-François Lyotard die weltweite Diskussion um die Postmoderne in Gang gebracht. Mit der „Postmoderne für Kinder“ führt der Pariser Philosoph seine Arbeit am Postmoderne-Begriff weiter und klärt Missverständnisse auf. Das literarische Prinzip, seine Essays, Briefe und Polemiken an Kinder seiner Freunde zu adressieren, macht diese Klärung zu einem Lesevergnügen. Diese Textsammlung ist sicherlich die beste Einführung in das philosophisches Werk von Jean-François Lyotard.